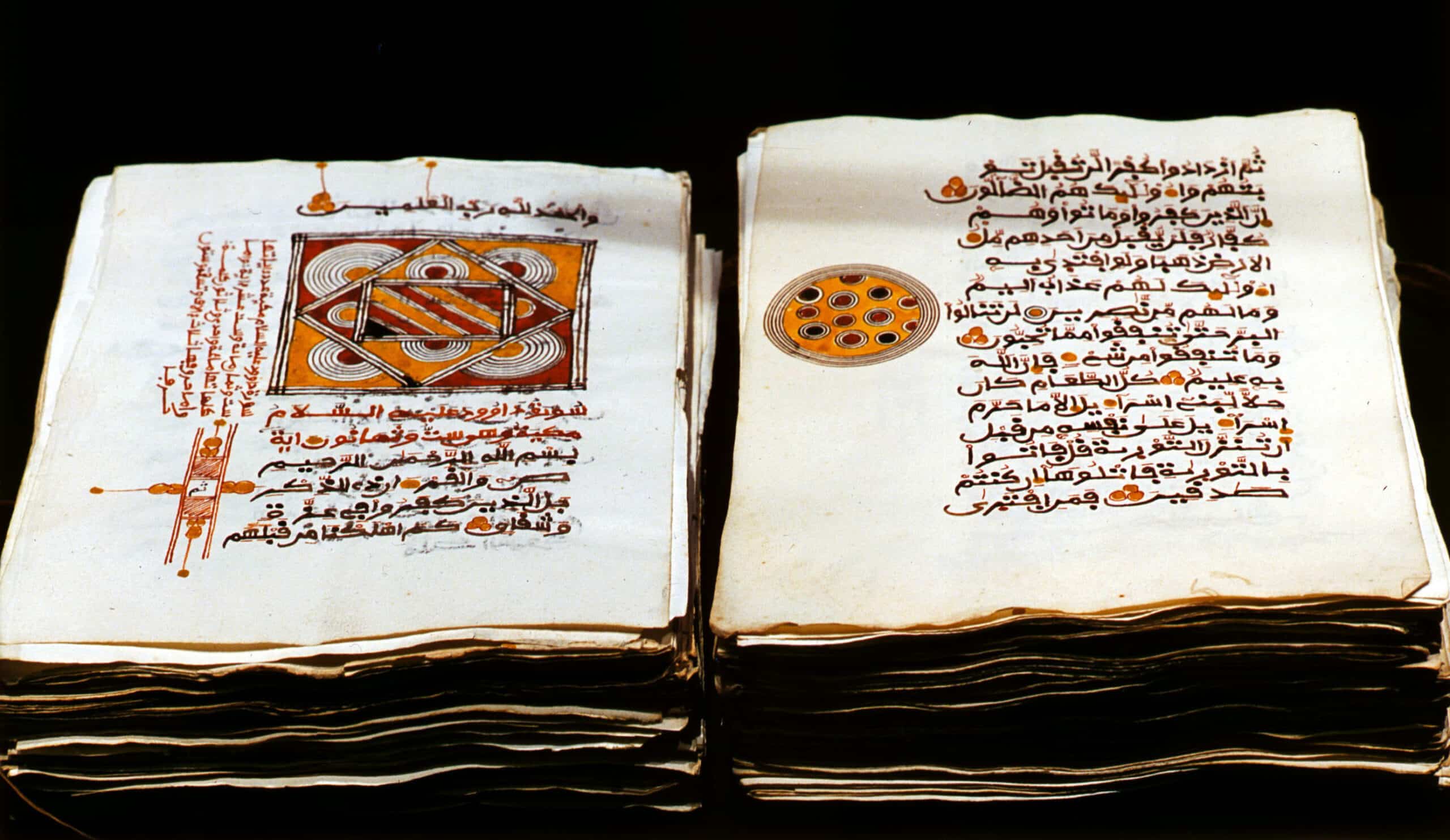Der ägyptische Literaturwissenschaftler und Koranhermeneutiker Nasr Hamid Abu Zaid vergleicht den Koran, verstanden als geschriebenen Text, mit einer „stummen“ Partitur, die erst durch Intonation und Interpretation durch ein Orchester zu einem lebendigen Phänomen, nämlich zur Musik wird. Nasr Hamid Abu Zaid formuliert so in seinem Text „Den Koran neu denken. Eine humanistische Hermeneutik“, in: ders., Gottes Menschenwort. Für ein humanistisches Verständnis des Koran, ausgewählt, übersetzt und mit einer Einleitung von Thomas Hildebrandt. Das Buch erschien in Freiburg i.Br. im Jahr 2008.
Abu Zaid ruft hier ins Gedächtnis, was für das koranische Selbstverständnis grundlegend ist, aber heute nicht zuletzt in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Koran oftmals weitgehend in den Hintergrund tritt: Der Koran spricht – wie bereits die Wortbedeutung des arabischen, aus dem Syrisch-Aramäischen stammenden Wortes al-qurʾān impliziert – von sich selbst in erster Linie als Rezitation oder Vortrag, womit er zugleich auf die Art und Weise verweist, in der er nach islamischer Auffassung zu den Menschen herabgesandt wurde. Diese für den Islam eigentümliche Form der Offenbarung ist unter anderem in Sure 96 (al-͑alaq), deren Anfang als erste Offenbarung gilt, mit überliefert.
Sure 96
- Trag vor im Namen deines Herrn, der schuf,
- den Menschen aus Anhaftendem schuf!
- Trag vor! Denn dein Herr ist’s, der hochgeehrte,
- der mit dem Schreibrohr lehrte,
- den Menschen, was er nicht wusste, lehrte.
Über den Kontext dieser zweimaligen Aufforderung vorzutragen, gibt unter anderen die Überlieferung von aṭ-Ṭabarī Auskunft, der den hier angegebenen Moment der Berufung wie folgt in den Worten des Propheten Muhammads überliefert: Darauf sprach Gabriel: Lies! Ich entgegnete: Was soll ich lesen? Da packte er mich und presste mich dreimal so, dass mir alle Kraft ausging, dann sagte er: Trag vor im Namen deines Herrn, der schuf. Da trug ich es vor.
Nach islamischer Auffassung ist der Koran also das Wort Gottes, das durch den Engel Gabriel (Jibrīl) dem Propheten Muhammad mündlich mitgeteilt wird, der wiederum den Auftrag erhält, diesen zunächst nachzusprechen, um ihn dann den Menschen vorzutragen. Die Berufung wird dabei als ein mitunter gewaltsamer Akt beschrieben, aus dem es kein Entrinnen gibt. Die Last des Auftrags lässt Muhammad zu Anfang schier verzweifeln, so dass er den Entschluss fasst, sich das Leben zu nehmen, was jedoch durch das Eingreifen Gabriels verhindert werden kann. Bei aṭ-Ṭabarī ist zu lesen: „Darauf fasste ich den Entschluss, mich von einem Berg herabzustürzen, doch als ich nahe daran war, es zu tun, erschien er (Gabriel) mir und sagte: Mohammed! Ich bin Gabriel und du bist der Gesandte Gottes“.
Muhammad ist nach islamischem Verständnis also nicht der Urheber des Korans, sondern vielmehr das Medium, durch das Gott sich über die Vermittlung Gabriels den Menschen zunächst mündlich mitteilt. Im Koran erklingen damit drei Stimmen unisono: die des Propheten, des Engels Gabriel und die Stimme Gottes.
Dieses Modell ist dem Christentum nicht fremd. Die heute umstrittene Lehre von der Verbalinspiration, d.h. der Vorstellung, dass die Heilige Schrift durch Vermittlung des Heiligen Geistes den Evangelisten nicht nur der Sache nach, sondern Wort für Wort „diktiert“ worden sei, wurde auch in der lutherischen Orthodoxie entwickelt, um das Prinzip der „sola scriptura“ zu stärken. Konsequenterweise ging man dann im Protestantismus auch dazu über, den griechischen Text des Neuen Testamentes als textus receptus zu verwenden und nicht mehr, wie zuvor seit Jahrhunderten üblich, die Vulgata.
Dass die griechische Sprache im Christentum allgemein jedoch niemals den Stellenwert erhalten hat wie die arabische Sprache im Islam, hat eine Reihe theologischer und historischer Gründe. Der entscheidende Grund aus christlicher Sicht ist aber, dass nicht der biblische Text selbst, sondern die Person Jesus Christus als Mitte der Offenbarung verstanden wird. Aus der Sicht des Islams ist dies ein Missverständnis. Im Islam ist Jesus, der Sohn Marias, ebenso wie vor ihm Mose und nach ihm Muhammad, der Empfänger des Wortes Gottes. So wie auf Mose die Tora und auf Muhammad der Koran herabgesandt wurde, so ist Jesus, der Empfänger und Verkünder des Evangeliums, sie es in Sure 5:46 heißt.
Sure 5:46
In ihren Spuren ließen wir folgen, Marias Sohn;
er bestätigte, was vor ihm von der Tora bestand.
Ihm gaben wir das Evangelium.
Darin ist Rechtleitung und Licht,
und es bestätigt, was vor ihm von der Tora bestand,
und es ist Rechtleitung und Mahnung für die Gottesfürchtigen.
Man könnte dies nun so verstehen, dass Gott sein Wort – um das Bild Abu Zaids nochmal aufzugreifen – entweder als drei Abschriften derselben Partitur oder als drei Weisen des Vortrags derselben Partitur herabgesandt hat. Für die zweite Variante spricht zum einen die ursprüngliche Mündlichkeit des Korans wie auch Sure 43:3–4.
Sure 43
3 Siehe, wir machten es zu einer Lesung [qurʾān] auf Arabisch,
vielleicht begreift ihr ja.
4 Siehe, es ist ein Urbuch bei uns,
wahrhaft, erhaben weise.
Der Koran ist somit das Wort Gottes in arabischer Sprache, die Gott als Sprache gewählt hat, damit ihn die Menschen, an die er primär gerichtet ist, nämlich die Araber verstehen. Zugleich verweist der Koran auf „Stimmen“ außerhalb seiner selbst, in denen das Wort Gottes als Leitung und Mahnung den Menschen in deren Sprache mitgeteilt wurde.
Die Botschaft Gottes an die Menschen selbst, so heißt es in 43:4 ist als „Urbuch“ bei Gott. Den arabischen Ausdruck umm-u l-kitāb-i („Mutter des Buches“), der an dieser Stelle verwendet wird, findet man auch an zwei weiteren Stellen (3:7 und 13:39) und auch die Vorstellung, dass ein Koran in Form einer gut „verwahrten Tafel“ (85:21–22) existiert, gehört in diesen Kontext.
In welchem Verhältnis „Urschrift“ und „Niederschrift“ respektive „Urbuch“ und „Vortrag“ zueinanderstehen, ist Gegenstand zahlreicher Debatten, die vermutlich niemals abgeschlossen sein werden und im Kontext der unterschiedlichen Stimmen der drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam nochmal eine Neubewertung erfahren.