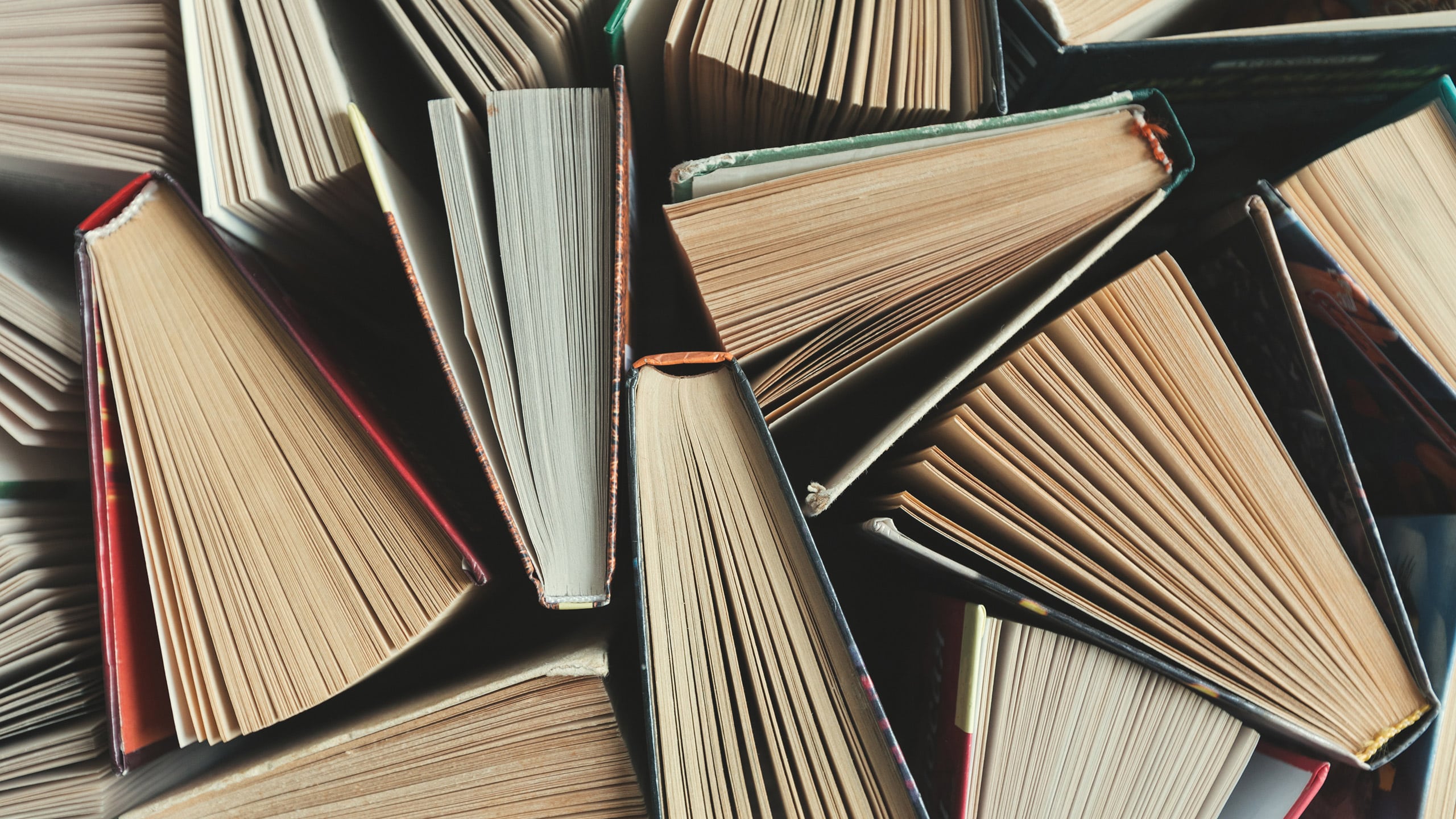Ein Kosmos der Schrift, so heißt die Festschrift, die Imma Klemm – die Frau von Ortheil – zu seinem 70. Geburtstag herausgegeben hat. Es handelt sich um ein dreitägiges Gespräch mit seinem Lektor Klaus Siblewski, in dem beide dem Kosmos des Schreibens nachgehen. Ortheil begreift das Gespräch zugleich als eine Graphoanalyse seines Lebens: Wie kam es zu diesem existentiellen Akt des Schreibens in seinem Leben?
Zu diesem Kosmos des Schreibens gehört ein ganz eigener Kosmos des Lebens. Vier Geschwister von Hanns-Josef Ortheil sind gestorben, bevor er geboren wurde. Diese Last ruhte nicht nur auf ihm, sondern auch auf seinen Eltern, besonders auf seiner Mutter: Es hat ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen.
Was sie rettete, war nicht nur ihre Tätigkeit als Bibliothekarin, sie war und blieb zeitlebens eine Lesende, sondern auch das Klavier. Für Ortheil, der ebenfalls lange ohne Sprache blieb, war dieser Augenblick, als ein Klavier in die Wohnung in Köln kam, ein entscheidender in seinem Leben: Plötzlich erlebte er die Mutter ganz anders, fähig zum Ausdruck ihres Inneren: Das Klavierspiel befreite sie. So wurde aus dem symbiotischen Kosmos mit der Mutter, der vor allem einer des Rückzugs war, plötzlich ein Kosmos des gemeinsamen Aufbruchs: Hanns-Josef lernte mit ihr ebenfalls das Klavierspielen. Der Vater war in diesem Kosmos für das Außen verantwortlich: Er brachte am Abend das Draußen mit, die Arbeitswelt: Er war von Beruf Geodät. Mit dem Vater lernte er auch Schrift und Sprache kennen, er war sein erster Sprachlehrer und Hanns-Josef Ortheil behauptet, sein Schreibprogramm in Hildesheim als Professor für Kreatives Schreiben sei nur eine professionelle Kopie des Privatkurses seines Vaters mit ihm gewesen.
I.
Aus diesem Schreiben entstand dann allmählich ein Schreibarchiv, eines der größten in der deutschen Literaturgeschichte: Zunächst waren es mit Zeitungsartikeln vollgeklebte Kladden versehen mit eigenen Aufzeichnungen, auf die Ortheil bis heute immer wieder zurückgreifen kann. Neben dem Schreiben wurde für Ortheil das Klavierspielen sein wichtigster Lebensausdruck. Nach dem durch eine Krankheit erzwungenen Abbruch seiner Pianistenkarriere – das nächste große Trauma in seinem Leben – begann er das Literaturstudium in Mainz und wurde nach der Promotion freier Schriftsteller.
Entscheidend für seinen Lebenskosmos war seine Heirat mit Imma Klemm, mit ihr zusammen erwarb er das Gartenhaus in Stuttgart, ein aufgegebenes Bahnwärterhaus: Adresse der Blaue Weg. Es folgte nun die blaue Phase im Leben von Ortheil: So wie Yves Klein in Nizza beim Blick in den Himmel den Himmel einfach mit seinem Namen signierte und damit das Yves-Kleinblau patentierte, so patentierte Ortheil das Blau des Himmels mit seiner ganz eigenen Lebensgeschichte: Immer wieder kommt er in seinen Romanen darauf zu sprechen: Ich nenne stellvertretend nur Die Erfindung des Lebens (2009), Das Kind, das nicht fragte (2012) und Der Stift und das Papier (2015).
Besonders erwähnen möchte ich sein Tagebuch Blauer Weg, das 1996 zum ersten Mal erschienen war und das Ortheil 2014 mit einem ganz neuen Vorwort neu herausbrachte. Dieses Vorwort gehört meines Erachtens zu den persönlichsten Texten von Ortheil. Er deutet darin nach der Phase des Blauen Wegs auch den Schwarzen Weg an, den es für ihn gab: Es war der Weg der tiefen Trauer nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1988, wovon ihn dann der Ruf nach Washington als Writer in Residence, seine Berufung nach Hildesheim an die Stelle für Kreatives und Literarisches Schreiben und das Stipendium in der Villa Massimo in Rom erlöste. Die Neuherausgabe des Blauen Wegs zeigt auch die literarische Methode von Ortheil, es ist nicht Wiederholung im banalen Sinn, sondern Wieder-holung, Wieder-herholen, Wiederherauf-holen, Er-innern, eine Art Retractatio, wie Augustinus es nennen würde. Schon erschienene Texte werden noch einmal neu kontextualisiert.
Ein Text im Blauen Weg hat mich besonders berührt, der in einer Katholischen Akademie nicht unerwähnt bleiben sollte: Katholisch. Katholisch meint bei ihm keine konfessionelle Engführung, sondern eine Sozialisation ins Offene, in die Weite: Er sagt von sich, dass er eine Art Brunnenwesen sei, dass etwas Meister-Eckhart’sches an seiner Seele hafte, eine Freude an der Sprachmagie, eine unergründliche und auch unausschöpfbare Anziehung durch stille Bilder und die Inspiration eines frei schwebenden Klangs der Polyphonie der Tradition.
II.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, diesen ganz eigenen und schon oft beschriebenen Kosmos hat Ortheil durch eine herausfordernde Lebenssituation neu vermessen müssen: durch seine lebensbedrohliche Herzerkrankung im Jahre 2019. Davon handelt sein Roman Ombra, aus dem er heute lesen wird.
Ombra ist das Gläschen Wein, das man zu den Cicchettis, einem venezianischen Fingerfood, im Schatten trinkt und genießt: eigentlich eine Situation der Heiterkeit und der Entspanntheit. Aber es meint auch noch einen ganz anderen Schatten, den Schatten des Todes. Davon erzählt Ortheil in seinem Roman.
Da Ortheil am liebsten an einem kleinen Tisch liest, auf dem sich nichts anderes befindet als eine Lesebrille und ein Glas Wasser, haben wir das so für ihn vorbereitet. Die Lesung ist für ihn eine Art Meditation und eine konzentrierte Vertiefung in den Zauber seines Textes.
Nun freuen wir uns auf Ihre Lesung, Herr Ortheil: Die Stadt draußen knistert vor Hitze, der Saal drinnen knistert vor Spannung: Noch einmal herzlich willkommen an der Katholischen Akademie.