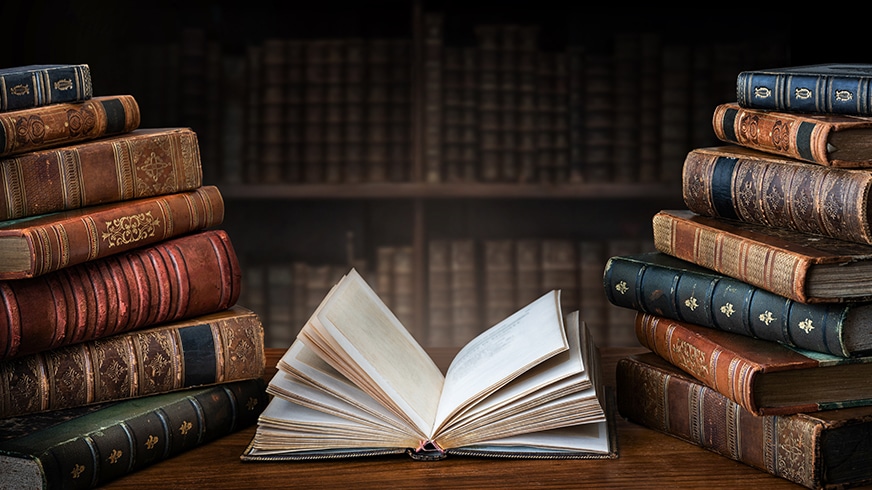„Über die Männlichkeit in der bayerischen Geschichte sind schon Bibliotheken geschrieben worden und die bayerische Geschichte ist fast zu Gänze patriarchalisch-männlich verstanden und gedeutet worden.“ Als der bedeutende Historiker Karl Bosl 1981 diese Formulierung wählte, begann so allmählich die Erkenntnis, dass ohne die Beachtung des Lebens und Wirkens von Frauen unsere Geschichtssicht „einseitig, eng und verzerrt bleibt.“ Weder in der „Bayerischen Geschichte“ von Karl Bosl, in der von Andreas Kraus noch in der von Benno Hubensteiner werden die bayerischen Königinnen genannt. So hatte ich mich damals entschlossen, die Lebensgeschichte dieser königlichen Gemahlinnen, die aus den führenden Häusern Europas kamen, drei waren evangelisch, aufzuschreiben. Im Folgenden stehen diese drei aus protestantischen Fürstenhäusern stammenden Frauen im Mittelpunkt, kurz erwähnt am Ende sei noch die einzige katholische bayerische Königin. Der fünfte bayerische König, Ludwig II. (reg. 1864 bis 1886) blieb unverheiratet, und die Ehefrau von Prinzregent Luitpold, Auguste Ferdinande von Österreich, war streng genommen keine Königin, so dass sie hier auch keine ausführliche Erwähnung findet.
Markgräfin von Baden – Königin Caroline von Bayern
Friederike Caroline Wilhelmine von Baden und Hochberg (* 13. Juli 1776 in Karlsruhe † 13. November 1841 in München) war eine evangelische Prinzessin von Baden und seit dem 1. Januar 1806 die erste Königin des neu proklamierten Königreich Bayerns. Ihre Eltern waren der badische Erbprinz Karl Ludwig und Amalie Prinzessin von Hessen-Darmstadt, Tochter des Landgrafen Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt und der „Großen Landgräfin“ Karoline, deren Vater wiederum ein Wittelsbacher war, Herzog Christian III. von Pfalz-Zweibrücken. Caroline heiratete am 9. März 1797 den verwitweten Herzog Max von Pfalz-Zweibrücken (* 1756 Mannheim +1825 München); die katholische Trauung fand im Schloss in Karlsruhe statt; Caroline wurde Stiefmutter von vier Kindern und Mutter von acht Kindern.
Es war das Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons bis zum Wiener Kongress, die Zeitspanne zwischen 1795 und 1816, die Mitteleuropa von Grund auf umgestaltete. Auf der Flucht vor den herannahenden Franzosen waren das Haus Baden und Herzog Max von Pfalz-Zweibrücken in Ansbach zusammengetroffen. Der 40jährige Herzog Max wird geschildert als „nachgeborener Prinz von Pfalz-Zweibrücken, leichtlebiger französischer Offizier des Ancien Regime, landloser, von den Revolutionsheeren flüchtender Herzog, einer der letzten Kurfürsten des alten Reiches.“ Er verliebte sich in die 21jährige gebildete Prinzessin Caroline von Baden, die ihn etwas zu alt, aber gutmütig fand. Ihre Mutter meinte dazu: „Der Herzog ist der beste Mensch von der Welt. Ich halte ihn für etwas schwach, aber für einen Ehemann ist das kein Fehler.“
In ihrem Hochzeitsvertrag hatte sich Caroline für ihre zukünftige Kurfürstinnenstellung in Bayern einen protestantischen Prediger zusichern lassen. Der 35jährige Pfarrer Dr. Ludwig Schmidt, Hofdiakon an der Kirche in Karlsruhe, sollte Caroline auf dem Weg nach München begleiten, nachdem dort Kurfürst Karl Theodor, ohne legitime Erben, verstorben war. Das Kurfürstentum Bayern war bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ein rein katholisches Land. Die Einführung der Toleranz und die Parität der Konfessionen in Bayern gehörte zu dem Programm für innere Reformen (das Ansbacher Mémoire), das der spätere Minister Maximilian Graf von Montgelas kurz nach seiner Berufung 1796 in Ansbach erstellt hatte.
„In München waren Protestanten zur Zeit meiner Ankunft eine ganze neue Erscheinung. Die meisten Einwohner hatten in ihrem Leben keine gesehen und glaubten, sie müssten ganz anders aussehen als andere Leute. Darum war die Furcht vor diesen gefährlichen Ketzern und ihr bigotter Intolerantismus wohl begreiflich.“ schilderte Pfarrer Schmidt seine Ankunft in München. Ab 1801 bekamen Protestanten Bürgerrechte in München und protestantische Pfälzer bekamen zur Kolonisierung der bayerischen Moore für zehn Jahre kostenlos Land zur Verfügung gestellt, in der Moorkolonie Groß-Karolinenfeld.
Mit dem Kabinettsprediger Ludwig Friedrich Schmidt an ihrer Seite fand ohne „legale Existenz“ am 12. Mai 1799 der erste evangelische Gottesdienst auf Schloss Nymphenburg, der Sommerresidenz des Kurfürstenpaares statt. Schritt für Schritt entstand nun eine Gemeinde. Schmidt hatte auch die Erlaubnis, Kinder von protestantischen Eltern zu taufen. Die Taufgebühren gingen aber an die katholischen Pfarrer, denn die Protestanten galten noch als Mitglieder der katholischen Kirche.
Die Angst vor den „Gefahren des protestantischen Gottesdiensts für katholische Zuhörer“ hatte sich aber längst gelegt. Die evangelische Königin Caroline galt wegen ihrer Fürsorge für das Volk als sehr beliebt. „Geht Dir die Not bis obenhin, dann geh‘ doch zu der Caroline.“ Da die Königin und ihre Kinder von ihrem Gemahl mit hohen Geldbeträgen ausgestattet worden waren, konnte sie zusammen mit Pfarrer Schmidt bei Unglücks- oder Todesfällen völlig unbürokratisch Hilfe leisten.
Die Zeit, in der Caroline nach Bayern gekommen war, war gekennzeichnet von einer einzigartigen Toleranz. Doch es gab immer wieder Rückschläge. Der Abschluss des Konkordats 1817 weckte die Sorge um die beiderseitigen Rechte. So trugen auch die Gedächtnisfeiern zum Reformationsjubiläum 1817 dazu bei, die konfessionellen Gegensätze stärker sichtbar werden zu lassen.
Im Jahr 1825 zerbrach das Glück der Königin Caroline. König Maximilian I. Joseph verstarb. Carolines Stiefsohn, nun König Ludwig I., fürchtete ihren Einfluss am Hof und wies ihr als Witwensitz Würzburg zu. Sie aber kehrte nach München zurück und lebte auf Schloss Biederstein.
Und am Lebensende der Königin 1841 begann eine Epoche des konfessionellen Fanatismus. Die Beisetzung dieser Fürstin wurde zu einem schrecklichen Eklat. Am 13. November war die Königin sanft entschlafen, umgeben von vielen Familienmitgliedern. Da König Ludwig I. die Aufbahrung der Toten in der evangelischen Kirche nicht gestattete, erfolgte sie in einem Saal hinter der Kapelle der Maxburg.
Schon zu Lebzeiten der Verstorbenen war das Problem der Bestattung einer protestantischen Landesmutter in einer katholischen Kirche in München erörterte worden. Aus dem Jahr 1830 lag ein Gutachten von acht bayerischen Bischöfen vor über die Bestattung einer protestantischen Fürstin in einer katholischen Fürstengruft. Evangelische Geistliche sollten zugelassen werden als Zeugen der Beisetzung. Die Beisetzung selbst sollte vom katholischen Klerus vollzogen werden. Freiherr von Gebsattel, der Erzbischof von München und Freising, hatte dieses Gutachten erstellt.
Für das Protokoll der Leichenfeier war Graf von Rechberg, ein gläubiger Katholik und ehrlicher Freund des Königs zuständig. Rechberg wurde kurz bevor sich der Zug von der Maxburg in Richtung der Hof- und Stiftskirche St. Cajetan in Bewegung setzte, mitgeteilt, dass das Zeremoniell nicht, wie abgesprochen ablaufen würde. 16 evangelische Geistliche gingen vor dem Sarg her. Dem Sarg folgte Ludwig I., König von Bayern, zu seiner Rechten der evangelische König von Preußen Wilhelm IV. und der evangelische Ludwig Erbherzog von Hessen. An der Kirche angekommen öffnete sich das Portal der Kirche nicht. Der Sarg musste vor der Kirche abgestellt werden und der Dekan und erste Stadtpfarrer Boeck hatte die Aussegnung trotz schlechten Wetters vor der Kirche vorzunehmen. Dann erst konnte der Sarg den Priestern des Kollegiatstifts von St. Cajetan übergeben werden, die nur gewöhnliche Straßenkleidung angelegt hatten. Die Trauergäste, die in die Kirche folgten, konnten es kaum fassen, dass die Kirche ohne jeden Schmuck war. Den evangelischen Pfarrern war der Zutritt in die Kirche nicht gestattet.
Der Trauergottesdienst wurde erst am folgenden Tag abgehalten, allerdings in einer schmucklosen Kirche ohne Kerzen, ohne Orgelspiel und ohne Gesang. Der Geistliche Rat Hauber, der die Königin sehr verehrte, hielt einen „rührenden Vortrag“, der aber nicht den Charakter einer Predigt hatte, weil er ohne Amen schloss. Es ist offensichtlich, dass der hochbetagte Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel alle diese Anordnungen getroffen hatte. Und auch die „Ultras“ mit Friedrich Windischmann an der Spitze und der Minister des Königs, Karl von Abel, wollten die Beerdigungsfeierlichkeiten so zu einer Kundgebung konfessioneller Prinzipienfestigkeit nützen.
Wie feierlich waren dagegen die Totenfeiern für die beliebte Königin Caroline etwa in Tegernsee bei den Barmherzigen Schwestern und bei der Bruderschaft der Herrschaftsdiener. Würdige Leichenfeiern fanden statt in Würzburg, Regensburg, Bamberg und Scheyern, Peter von Richarz, der Bischof von Augsburg, wünschte seiner Trauerfeier auch „äußerlich den Eindruck jener Ehrfurcht und Liebe zu geben, welche der hohen Würde und dem edlen Charakter der allerdurchlauchtigsten Verstorbenen entsprechen.“ Sogar ein Trauergeläut aller Kirchen in Augsburg von 12 bis 1 Uhr für den Zeitraum von sechs Wochen ordnete er an.
Das feierliche Amt für die Fürstin brachte dem Bischof dann eine strenge Rüge von Papst Gregor XVI. ein, weil dieser ihm vorwarf, dass er sich nicht gescheut hatte, für eine „Fürstin, die in der Ketzerei wie aufs Offenbarste gelebt und so ihr Leben beschlossen hatte“ unangebracht sei. Er rügte auch, dass er den Anschein erwecke, „dass ein dem katholischen Glauben und der katholischen Gemeinschaft fremder Mensch könne wenn auch so gestorben zum ewigen Leben gelangen.“ Bei der Beisetzung der goldenen Urne in St. Cajetan hatte König Ludwig I. der katholischen Geistlichkeit angedroht, ihnen eigenhändig die liturgischen Gewänder anzuziehen, sollten sie dies nicht freiwillig tun. Der Trauerakt wurde sehr feierlich begangen, den evangelischen Pfarrern aber wurde die Teilnahme daran nicht gestattet.
Die Kinder der evangelischen Königinnen wurden katholisch getauft. Sie durften aber oft mit der Mutter in den evangelischen Gottesdienst gehen. Von Prinzessin Ludovika, einer Tochter des ersten bayerischen Königspaares, stammt der Ausspruch: „In unserer Jugend waren wir alle ein bisschen angeprotestantelt.“
Die Wettinerprinzessin aus Thüringen – Königin Therese von Bayern
Therese Charlotte Luise Friederike Amalie von Sachsen-Hildburghausen ( * 8. Juli 1792 im Jagdschloss Seidingstadt; † 26. Oktober 1854 in München) war eine Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen und 1810 durch ihre Heirat mit Kronprinz Ludwig von Bayern (1786-1868) später Königin von Bayern und Mutter von sieben Kindern.
Therese war evangelisch aufgewachsen in der „großzügigen, europäisch orientierten Gesellschaft des alten Reiches“. Die Eltern der Prinzessin waren Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen (1763-1834) und Charlotte (1769-1818), Tochter des Großherzogs Karl II. von Mecklenburg-Strelitz. Thereses Vater folgte 1826 im Herzogtum Sachsen-Altenburg als Landesherr. Theresens Mutter Charlotte zählte zu den „vier schönen Schwestern auf dem Thron“, wie dies der Dichter Jean Paul in dem diesen Damen gewidmeten Roman Titan, ausdrückte: Herzogin Charlotte, Königin Luise von Preußen, Mathilde Therese von Thurn und Taxis und Königin Friederike von Hannover.
Wie kam nun der bayerische Kronprinz dazu, sich 1810 eine Wettiner Prinzessin aus Sachsen-Hildburghausen als Gemahlin zu erwählen? Er hatte miterleben müssen, wie seine Schwestern Auguste und Charlotte unter dem Druck des französischen Kaisers Napoleon mit Partnern verheiratet wurden, die sie sich nicht gewünscht hatten. Der damals 24jährige Kronprinz fürchtete daher, ebenfalls aus politischen Überlegungen Napoleons, zu einer Heirat gezwungen zu werden. Ludwigs Vater Maximilian I Joseph hatte ihm angedeutet, „eine Prinzessin vom Hildburghausen aus sächsischem Stamme sei lieb, freundlich und gütig und könnte eine ausgezeichnete Ehefrau abgeben. Freilich, viel Geld und Gut wird sie nicht in die Ehe bringen, die Kleinheit des in den Rheinbund hinein gezwungenen Landes macht aber die Heirat politisch unbedenklich.“
Als Kronprinz Ludwig um die evangelische Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen warb, wollte er sie zur Konversion bewegen, sie blieb aber ihr Leben lang ihrer Konfession treu. Es wurde keine glückliche Ehe. „Ludwig besaß ein äußerst erotisches Temperament“, schwer zu vereinbaren mit seinem Herrscheranspruch und seiner Religiosität. Therese litt an „seinem Mangel an Zartgefühl“, wie dies Königin Caroline beschrieb. Des Königs Abenteuer spielten sich zu sehr in der Öffentlichkeit ab und er hatte keine Skrupel, seine langjährige italienische Geliebte an den Hof in München einzuladen. Therese litt auch sehr unter dem Geiz ihres Mannes, wenn es um ihre privaten Wünsche ging.
Auf vielen Umwegen schaffte es dann die verwitwete Königin Caroline mit ihrer ebenfalls evangelischen Schwiegertochter Königin Therese, gegen harten Widerstand, König Ludwig I. davon zu überzeugen, dass die auf 1200 Personen angewachsene evangelische Gemeinde ein eigenes Gotteshaus bekommen sollte. Beide Königinnen stifteten aus ihrem Privatvermögen große Summen für die Kirche, die im August 1833 eingeweiht werden konnte und die erst 1877 den Namen St. Matthäus Kirche erhielt.
Leider wurde Königin Therese 1854 ein Opfer der in München wütenden Cholera. Der am 25. Oktober gerufene Leibarzt erkannte die die Anzeichen der Krankheit nicht bei der Königin und am 26. Oktober entschlief die Königin nachdem ihr Pfarrer Berger das Abendmahl gereicht hatte. Ludwig und Therese waren 44 Jahre verheiratet gewesen.
Bereits zwei Tage nach dem Ableben der Königin verließ König Ludwig I. München. Er reiste mit seiner Tochter Großherzogin Mathilde von Hessen-Darmstadt und seinem Sohn Adalbert nach Darmstadt. Sie nahmen alle drei nicht an der Beerdigung der Königin teil. Es hat den Anschein, dass sich der König bei der Bestattung seiner evangelischen Gemahlin in einer katholischen Fürstengruft nicht noch einmal einem Eklat aussetzen wollte, wie dies 1841 bei seiner Stiefmutter Caroline der Fall war.
Die Aufbahrung war in der Maxburg erfolgt, dann der feierliche Zug zur Theaterkirche. Die Trauerrede dort hielt der königliche Hofkapell-Direktor und Stifts-Propst Dr. Ignaz Döllinger.
Ursprünglich hatte Ludwig I. geplant, in dem 1838 wieder begründeten Benediktinerkloster Scheyern, eine Grabkapelle als Grablege für das Königshaus zu erbauen. Das Projekt scheiterte daran, dass im Vorfeld von Rom bestimmt wurde, dass für die evangelische verstorbene Königin kein Trauergottesdienst abgehalten werden dürfe. 1857 wurde der Sarg der Königin in die St. Bonifaz-Kirche, vom König zu seiner Grablege bestimmt, überführt. Der Sarg durfte aber nicht durch die katholische Kirche getragen werden. So wurden die Stufen am Kirchenportal abgetragen und der Katafalk durch eine Öffnung in der Außenmauer in die Gruft geschoben.
Fast 150 Jahre ruhte Königin Therese von Bayern in ihrer Gruft unter dem Sarkophag Ludwig I. Um das Jahr 2000 gab es Überlegungen, Königin Therese umzubetten. Dafür stark gemacht hatten sich sowohl Pater Augustinus Bauer, der Pfarrer von St. Bonifaz, als auch der evangelische Regionalbischof Martin Bogdahn. Dieser fragte im Haus Wittelsbach an, ob die protestantische Königin nicht aus ihrer „herabwürdigenden Lage“ befreit werden könnte. Der Bischof fand Gehör und es begann die Planung für eine Umbettung der Königin.
Am 12. November 2002 war es dann soweit: Thereses inzwischen stark beschädigter Zinksarg wurde in aller Stille und ohne großes Protokoll aus der Gruft hochgeholt und in einen eigens angefertigten Marmorsarkophag gelegt, der in der Rückwand hinter dem Königssarkophag eingelassen wurde. Der evangelische Landbischof Johannes Friedrich und Odilo Lechner, der Abt von St. Bonifaz, segneten die neue Grablege der Königin. Das Haus Wittelsbach hatte zwei schlichte grüne Kränze bringen lassen. Franz Herzog von Bayern, der Chef des Hauses Wittelsbach, verfolgte die Zeremonie, zu der 15 Mitglieder des königlichen Hauses gekommen waren. Es sei doch eine „recht unschöne Situation“ gewesen, sagte der Herzog, wie seine Vorfahrin bestattet gewesen war.
„Die Königin ist rehabilitiert“, freute sich der Landesbischof Johannes Friedrich. Es ehre die Nachfahren des Königs. dass sie Königin Therese „in einer Zeit, in der sich das Verhältnis von Protestanten und Katholiken grundlegend geändert hat, posthum Gerechtigkeit widerfahren lassen.“
Die Hohenzollernprinzessin aus Berlin – König Marie von Bayern
Prinzessin Marie Friederike Franziska Auguste Marie Hedwig von Preußen (*15. Oktober 1825 Berlin † 17. Mai 1889 im Schloss Hohenschwangau) wurde durch Heirat mit dem späteren König Maximilian II. Joseph (1811-1864) im Jahr 1842 später Königin von Bayern und Mutter von zwei Söhnen.
Die evangelische Marie aus der Dynastie der Hohenzollern hatte eine bedeutende Ahnenreihe aufzuweisen. Sie kam aus der Familie König Friedrich II. von Preußen, den man den Großen nennt. Ihr Großvater war Friedrich Wilhelm II. von Preußen (1744-1797). Aus dessen zweiter Ehe mit Friederike von Hessen-Darmstadt stammte Maries Vater Wilhelm (1783-1851). Maries Mutter war Prinzessin Marianne von Hessen-Homburg (1785–1846), Tochter des Landgrafen Friedrich V. von Hessen-Homburg und seiner Ehefrau Caroline von Hessen-Darmstadt (1746-1821).
Mit 29 Jahren beschloss Maximilian, Kronprinz von Bayern, sich mit der 15jährigen Marie von Preußen zu vermählen. Die Verlobung im Januar 1840 musste allerdings verschoben werden, weil Marie zu diesem Zeitpunkt an Masern erkrankt war. Bevor an die Hochzeitsfeier gedacht werden konnte, stand noch ein anderes Fest ins königlich preußische Haus: die Konfirmation der Prinzessin. Zur großen Freude der ganzen Familie reiste der katholische Kronprinz von Bayern zur Konfirmation seiner Braut nach Fischbach in Schlesien, dem Sommersitz der hessischen, preußischen und russischen Verwandtschaft. Über die Konfirmation schrieb Schelling, bei dem der Kronprinz einst studiert hatte: „Welch eine Thatsache, dass der Erbe des bayerischen Thrones bei dem öffentlichen aus innerstem Herzen abgelegten Religionsbekenntnis der evangelischen Prinzessin, seiner Braut, nicht als gleichgültiger und kalter sondern als theilnehmender selbstbewegter Zeuge zugegen war!“
Die feierliche Vermählung fand am 5. Oktober 1842 im königlichen Schloss in Berlin statt. Bei der evangelischen Prokurativtrauung in Berlin kniete an der Seite der Braut ihr Vetter Wilhelm Prinz von Preußen – der spätere Kaiser Wilhelm I. – als Vertreter des bayerischen Bräutigams.
Sieben Tage nach der evangelischen Trauung wurden Marie und Maximilian in der Allerheiligen-Hofkirche in München von Erzbischof von München-Freising Lothar Anselm von Gebsattel getraut. Nun begann eine Ehe, die durchaus einem Gleichklang der Seelen glich. Drei Jahre nach der Vermählung kam Erbprinz Ludwig zur Welt, in den Revolutionswirren von 1848 Prinz Otto. Da Maximilian II. wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustandes oft in Italien weilte, schrieb er seiner Frau 243 Briefe.
Königin Marie wurde in Bayern zur Sympathieträgerin. König Ludwig I. nannte sie, die einzige seiner Schwiegertöchter, die eine Bayerin geworden ist. Marie war überzeugt, dass es eine der wichtigsten Aufgaben der Zeit sei, einer zunehmenden Armut im Land entgegenzuwirken. Marie förderte tatkräftig die evangelische Gemeinde in München, war an der schnellen Entwicklung der „Inneren Mission“ und der Ansiedlung der Diakonissen federführend und es kam zur Gründung vieler Hilfsvereine. Die Königin trat für die Abschaffung der Kinderarbeit ein, was allerdings zu jener Zeit an dem „heiligsten Recht“ der Eltern in der Verfügung über ihre Kinder scheiterte. Das strahlende Glück zerbrach jäh am 10. März 1864. König Maximilian II. lag auf der Totenbahre. Nur 22 Ehejahren waren dem Paar beschieden und Marie wurde mit 39 Jahren Witwe.
Maries Witwensitz wurde Schloss Hohenschwangau. Was sie dort sehr vermisste, das waren ein evangelischer Pfarrer und ein evangelischen Gottesdienst in unmittelbarer Nähe. Marie hielt sich damals oft in Elbigenalb, dem sogenannten Residenzdorf der Königin, auf und schloss sich dort dem Lechtaler Priester Georg Lechleitner an. Er gab ihr Religionsunterricht nach katholischem Verständnis und gewann großen Einfluss auf sie. Im Oktober 1874 besuchte sie Dr. Daniel von Haneberg, Bischof von Speyer, in Hohenschwangau. Die Gespräche mit den geistlichen Herren scheinen endgültig dafür ausschlaggebend gewesen zu sein, dass sich die Königin entschloss, zu konvertieren. Als Tag ihrer Konversion wählte sie ihren 32. Hochzeitstag, den 12. Oktober 1874 – der zugleich der Namenstag ihres verstorbenen Gemahls war, und zwar In der Pfarrkirche von Waltenhofen in der Gemeinde Schwangau. Am 28. Oktober stimmte Papst Pius IX. der Konversion zu.
König Ludwig II. missbilligte den Schritt seiner Mutter, sein Bruder Otto, der in Waltenhofen anwesend war, nannte es, „eine rechte Gnade von Gott! Die Mutter war gleich nach dem Übertritt heiter und man sah ihr die innere Zufriedenheit u. Seelenruhe gleich an! – Gott segne sie immerdar!“
Zwei Tage nach der Konversion, am 22. Oktober, vollzog der Bischof von Augsburg, Pankratius von Dinkel, die Firmung der Königin. Ihre Firmpatin war Ludovika, Gemahlin von Herzog Max in Bayern.
Traurig reagierte in Berlin Kaiser Wilhelm I., nachdem ihn Marie von ihrem Schritt unterrichtet hatte. Der Kaisers Antwortbrief hat zwei Schwerpunkte. Im ersten spricht er von der evangelischen Familientradition und im zweiten Teil geht es um den gewählten Zeitpunkt der Konversion mitten im Kulturkampf.
Marie hatte sieben Jahre wegen der Konversion mit sich gerungen und auch immer wieder mit dem evangelischen Oberkonsistorialrat Dr. Burger in München das Gespräch gesucht. Als sie nach vielen Jahren die Konversion rückgängig machen wollte, musste ihr Dr. Burger mitteilten, dass man das „Bekenntnis nicht wechseln könne wie ein Hemd.“
Nach ihrer Konversion wurde Marie Mitglied der Rosenkranz-Bruderschaft, des Gebetsapostolates, der Corpus-Christi-Bruderschaft, des Ingolstädter-Meßbundes. Sie ließ sich in die Bruderschaft der Sieben Schmerzen Mariä aufnehmen. „Schmerzensmutter“ nannte das bayerische Volk, als sie nach Altötting pilgerte, um in der Gnadenkapelle vor der Herzurne ihres geliebten Sohnes Ludwig zu beten.
Am 18. Mai 1889 schloss Königin Marie für immer die Augen, drei Jahre nach dem tragischen Tod ihres Sohnes Ludwig II. In ihrem Testament hatte sie bestimmt, dass sie im schmucklosen Kleid des Dritten Ordens vom Heiligen Franziskus mit dem Rosenkranz in der Hand bestattet werden wünsche.
Auf der erst einen Monat später eröffneten Bahnlinie Füssen-Biesenhofen trat die tote Königin ihre Fahrt nach München an. Marie ruht in der Theatinerkirche an der Seite ihres Gemahls.
Am 21. September 1889 berichteten die Zeitungen ausführlich von der Überführung des Herzens der Königinmutter Marie von Bayern nach Altötting, die Prinzregent Luitpold angeordnet hatte. Die Silberurne dort trägt das Wappen Bayerns, überragt von der Königskrone und ist geziert mit einem Kranz von Alpenrosen und Edelweiß. Die Herzen der evangelischen Königinnen von Bayern blieben in München.
Exkurs: Die Habsburger Prinzessin aus Wien – Königin Marie Therese von Bayern
Marie Therese Henriette Dorothea, Erzherzogin von Österreich-Este und Prinzessin von Modena
(*2. Juli 1849 Brünn +3. Februar 1919 Schloss Wildenwart) war die einzige katholische bayerische Königin. 1868 wurde sie die Gemahlin von Prinz Ludwig von Bayern (1845-1921), dem späteren König Ludwig III. von Bayern (1913-1919). Mit 68 Jahren erst wurde sie dann Königin von Bayern und somit die von vielen lang ersehnte katholische Landesmutter. Dem Königspaar wurden 13 Kinder geboren.
Marie Therese war ihrer Abstammung nach gleich in mehrfacher Hinsicht Habsburgerin. Ihre Mutter war Elisabeth, Erzherzogin von Österreich (1831-1903), ihr Vater Ferdinand Erzherzog von Österreich-Este, Prinz von Modena (1821-1849), der im Jahr der Geburt von Marie Therese eine Typhusepidemie zum Opfer fiel. Durch die zweite Vermählung ihrer Mutter mit Erzherzog Karl Ferdinand (1818-1874) bekam Marie Therese die Halbgeschwister Christine, die spätere Königin von Spanien, und die Erzherzöge Friedrich, Karl Stephan und Eugen. Am 5. November 1921 wurde das tote Königspaar nach einem 51jährigen Treuebund in der Wittelsbacher Fürstengruft im Dom zu Unserer Lieben Frau in München beigesetzt.