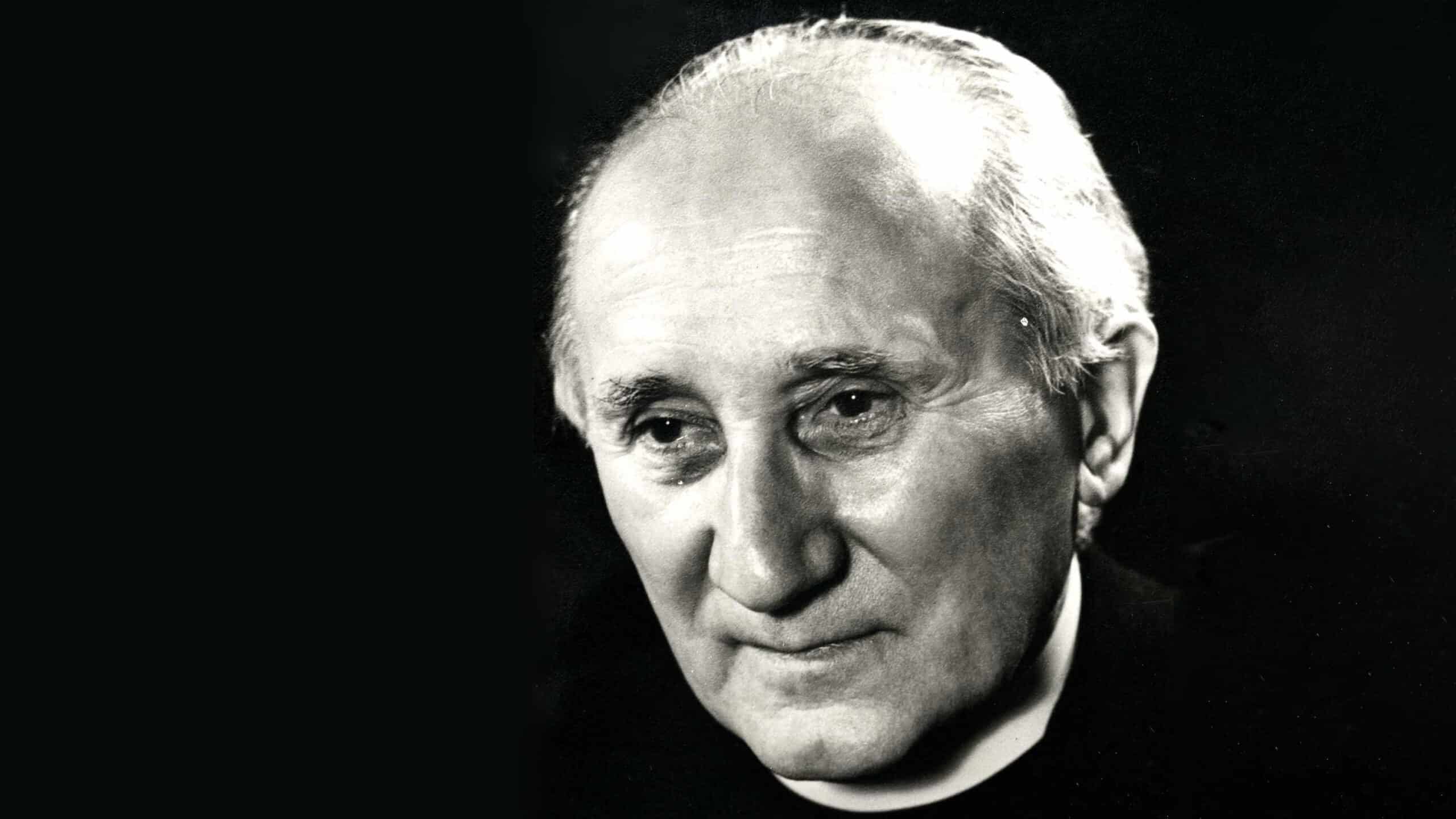Leib ist der Lieblingsweg der Gnade. Anders: Leib ist Vorschule der Liturgie. So lautet einer der grundlegenden Gedanken des Klassikers „Vom Geist der Liturgie“, vor allem im vierten Kapitel über „Liturgische Symbolik“. Mit diesem Kapitel greift Guardini vor die Liturgie zurück, denn: Aus der Symbolik des Leibes entfaltet sich zunächst eine großgedachte Anthropologie. Aber sie läßt sich sich weiterdenken: Anthropologie führt auf eine erhellende Weise zur Liturgie.
Das schmale Kapitel 4 kann diese Anthropologie nur andeuten, daher werden noch weitere, spätere Aussagen Guardinis hinzugezogen, bevor der Überschritt in die Liturgie wieder zurückführt zu seinem Erstling.
Leiblichkeit als Leitfaden zur Anthropologie
„Der ganze Körper ist Werkzeug und Ausdruck der Seele. Die ist nicht bloß im Leibe drinnen, wie einer in seinem Hause sitzt, sondern wohnt und wirkt in jedem Glied und jeder Faser. Sie spricht aus jeder Linie und Form und Bewegung des Leibes. In besonderer Weise aber sind Antlitz und Hand Werkzeug und Spiegel der Seele.“ So beginnt, 1920 erstveröffentlicht in der Zeitschrift „Quickborn“, der Aufsatz über die Hand, selbst ein kleines Meisterwerk. Im Unterschied zu anderen „heiligen Zeichen“ geht es dabei nicht um die Freilegung der Dinge wie Kerze, Schwelle, Glocke, sondern um die Selbstaussage des eigenen Leibes. Es ist entscheidend, in dem, was „auf der Hand liegt“, bereits das Ganze des menschlichen Daseins umrisshaft abnehmen zu können. Walter Dirks formulierte rückblickend: „Er hat unseren Sinn für den Leib und für das Spiel in eine theologisch-anthropologische Vorstellung des ganzen Daseins eingeordnet.“
Worauf deutet diese Anthropologie? Keineswegs ist menschlicher Leib aus einem flachen Materialismus zu verstehen. Der Leib „äußert“ vielmehr grundsätzlich eine Relation. Er ist stoffliche Ausprägung eines Innen, ist die sinnliche Seite von Sinn. Mit dem Leib ist kein naiver Naturbegriff verbunden, sondern an ihm zeigt sich die schöpferische Überführung von Natur in seelisch kultivierte, angenommene und aufgeschlossene, gestaltete Natur.
Wie gelingt diese schöpferische Umsetzung von innen nach außen, wie mißlingt sie? Im 4. Kapitel „Vom Geist der Liturgie“ unterscheidet Guardini zwei Leibverständnisse, die je typisch beschränkt und noch nicht gelungen sind. Beide fragen zunächst dasselbe: „Wie vom Ich innerhalb der eigenen körperlich-geistigen Persönlichkeit das Verhältnis zwischen Geist und Körper erlebt wird.“ Das erste Verhältnis grenzt das Körperliche jedoch scharf vom Geistigen ab. Beide werden als „zwei Ordnungen empfunden, die nebeneinander liegen, zwischen denen wohl ein Verkehr besteht, aber ein solcher, der eher wie ein Übersetzen aus der einen in die andere denn als ein unmittelbares Zusammenwirken erscheint“. So wird der Körper Werkzeug, „Hilfsmittel“, „Beimengsel“ und „Unvollkommenheit“, aber kein einleuchtender Ausdruck des Seelischen.
Im zweiten Verhältnis wird umgekehrt das Körperlich-Sinnliche „führend“ und lässt das Geistige unmittelbar ins Leibhafte überströmen. „Dieses Eins-Gefühl des Körpers und Geistes vermag sich auch über den Bereich der eigenen Persönlichkeit auszudehnen und die Außendinge in sich hineinzuziehen.“ Guardini könnte hier auf das magische, auch auf das kindliche Weltverhältnis anspielen, in welchem die dinghaften Elemente Herrschaft über das Empfinden und Urteilen ausüben. „Das Innenleben ist in beständigem Fluß begriffen, verändert sich fortwährend.“ Selbstand des Geistes ist damit unmöglich, auch eine Stetigkeit der Verhältnisse im eigenen polar gebauten Dasein. Es fehlt die „Fähigkeit, bestimmte geistige Gehalte an bestimmte äußere Formen zu binden“. Das Hin und Her zwischen Leib und Seele, Außen und Innen, ist ungestalt, unscharf, noch nicht selbstmächtig.
Deutlich wird bereits, dass Guardini die beiden Leibverständnisse nicht einfach verwirft, sondern sie aneinander misst. Vom ersten behält er die Prägnanz des Geistigen gegenüber dem Körper, vom zweiten die stärkere Verbindung beider, die allerdings der klärenden Unterscheidung bedarf. Unausgesprochen ist der Gegensatzgedanke darin mächtig, der Würdigung, Kritik und letztlich Balance des Gegensätzlichen miteinander verbindet.
Bei diesen Ausführungen wird noch nicht deutlich zwischen den Ausdrücken Leib und Körper – oder auch zwischen Geist und Seele – geschieden, wie es Guardini an anderen Stellen später macht, zum Beispiel in der großen Passage: „Von beiden Seiten her muß die Wahrung aufgebaut werden: vom Geist und vom Körper. Der Trieb muß vom Geiste her Scheu und Zucht; Intellekt und Wille müssen vom Körper her Demut und Bindung annehmen. Die Aufgabe ist aber durch ihre Kraft allein nicht zu lösen, sondern bedarf des Herzens. Im Herzen begegnet der Geist dem Körper und macht ihn zum ‚Leibe’; im Herzen begegnet das Blut dem Geiste, und er wird zur ‚Seele’.“
Diese Wandlung des (eher mechanisch gedachten) Körpers zum lebendigen Leib kraft des Herzens wird aber in der Frühschrift 1918 noch nicht eingehalten. Festzuhalten ist für den weiteren Gedankengang nur die unbedingte Wechselwirkung zwischen Leib/Körper/Außen und Seele/Innen.
Schließlich fasst Guardini in „Welt und Person“ 1939 – trotz des schmalen Umfangs von 160 Seiten eine seiner wichtigsten Schriften – den menschlichen Leib unter der Qualität des Gespannt- und Gerichtetseins. Der Mensch ist keine Sache, sondern eine Richtung, ein Aufgetansein, eine Zuwendung. Das zeigt sich schon in der leiblich-phänomenalen Hinwendung im Sprechen, im Ansehen, im Begegnen, immer in Wendung zu einem Gegenüber, zu einem Du oder Wir oder auch Es. Leib selbst ist angelegt auf Beziehung oder verweigert sie in der Abwendung.
Der Hauptgedanke von „Welt und Person“ lautet, „daß der Mensch nicht als geschlossener Wirklichkeitsblock oder selbstgenugsame, sich aus sich selbst heraus entwickelnde Gestalt, sondern zum Entgegenkommenden hinüber existiert“. Anders: Dieses Entgegenkommende setzt eine Dynamik frei, ein „Hinüber“; es lässt die Lehre vom Menschen als Monade ebenso wie eine aufklärerische Autonomie des Subjekts als unzureichend erscheinen; sie sind nur als Momente in einem aufsprengenden Gesamtvorgang einzusetzen. Schon in seiner Räumlichkeit ist Leib ein Spannungsgefüge zwischen innen – außen – oben, er verleiht der Wendung des Ich zu einem Gegenüber Ausdruck. Dorthin, in eine personale Beziehung, transzendieren die anschaulichen „Äußerungen“ des Leibes.
Zwischenruf: Gebrochenheit des Leibes
In „Geist der Liturgie“ ist angedeutet, daß der Geist selbst unlebendig bleibt, wenn er nicht inkarniert (80); dass seine „Sprödigkeit“ sich „gegen den Ausdruck des Seelischen im Körperlichen wehrt“. Umgekehrt: Der Leib kann zu harmonisch, als Ankunft in sich selbst verstanden werden. Was hier nur gestreift wird, wird durch einen Blick auf spätere Gedankenkreise klar, die nach Gesundheit und Krankheit des Leibes und Geistes fragen.
Ein Vorlesungsfragment von 1931 (in der Bayerischen Staatsbibliothek München) unterstreicht ausdrücklich Nietzsches Forderung im Zarathustra nach dem aufrechten Wuchs. Werden die Welt und mit ihr der Mensch nicht ernst genommen, so verliert alles, fern und dünn geworden, sein Gewicht, ein unwahres Ressentiment bleibt als Bodensatz. Hier setzen im Nietzsche-Zitat und Guardini-Kommentar große Passagen ein über das Bruchstückhafte, Fruchtlose, Kümmerliche des modernen Menschen, entsprungen einer Leibverachtung, die zugleich Geistverachtung hervortreibt – ist doch der Geist selbst gehaltlos, dem Leben fremd, im Begriff dürr geworden. Und Leib wäre Sinn, Geist, Seele – alles in einem, wäre die „große Vernunft“, tiefer wissend, von „älterem Adel“ als Urteil und Abstraktion. Erhöhung des Leibes ist Erhöhung des Geistes. Seine Blüte liegt in Gesundheit, Schönheit, Tanz, Lust – oder er blüht eben nicht.
Guardini teilt diese Deutung und denkt von der Sache her, aus Übereinstimmung weiter. Und zwar stellt sich als nächste Frage: Ist die selbstsichere Natur ein Letztes? Baut sich der Mensch aus der Tiefe allein in seine eigene Höhe? Was sichert ihm Würde ohne den wohlgeratenen Leib? Wird dieses Problem wirklich ausgetragen, dann kommt ein Geist-Verständnis ins Spiel, worin der Geist nicht mehr allein Trieb und Blut in Vollendung ist. Geist muß auch Eigenstand gegenüber dem Bios aufweisen, wesentlich Leben sein, „das sich selber ins Leben schneidet“. Wo Geist in dieser zweiten „lebensgefährlichen“ Form erscheint, ist er Widerspruch, unfasslicher Einbruch, Aussetzung – das, was die christliche Erfahrung mit dem Transzendenten bezeichnet. Sprengung des Lebenskreises aus einem höheren Anspruch („Anruf“): und der Angesprochene, die Person, erfährt diese Sprengung ebenso wirklich wie das Vertraute, Selbstsichere, aus sich selbst Aufblühende.
So kann der Geist äußerste Folgerung des schönen Leibes sein – er kann aber ebenso den Leib überwinden, verlassen… Guardini deckt hier einen Ansatz bei Nietzsche auf, der nicht immer gesehen, ja wohl auch Nietzsche selber unheimlich ist: dass der Geist das Leben über sich selbst hinausdrängt. Hier erscheint für Guardini – weit klarer als bei Nietzsche – die Qualität des Personalen: die Würde des Hinauf, Hinaus, Hinüber – von einem anderen gezogen als ich selbst bin. Selbst in mir und Selbst über mir – das Erste aus eigener Fülle, das Zweite aus der Fülle eines anderen (und noch ist ja nicht ausgemacht, ob nicht sogar meine selbstherrliche Fülle von einer anderen gewollt, getragen ist). Ohne das Wort Christentum auch nur zu nennen, tastet sich Guardini in eine von Nietzsche geahnte, zögernd ausgesprochene Wahrheit vor: daß Größe sich aus der Wirklichkeit eines Größeren nährt.
Damit ist der Anfangsgedanke vom Leib und seiner Kraft noch einmal berührt, vom Hiersein in seiner Eigen-Schönheit. So sehr das Dasein, oft unterschätzt, in sich selbst wurzelt, mit sich selbst in höchster Fruchtbarkeit eins ist, so sehr ist es – durch Anruf – noch einmal mehr, größer, gewaltiger. Versagt man sich diesem Mehr, darf der Leib letztlich doch nichts anderes sein als Biologie, Körper, Blut, Animal. Und dies dann nicht neutral, sondern jetzt dämonisch (in der weitest getriebenen Form sogar dumm).
Guardini wird 1945 das Buch „Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik“ herausbringen, den Versuch, die vergangenen zwölf Jahre zu orten. Eine Quelle der zwölf Jahre war die Biologisierung des Menschen, der Kultur, des Staates, der Religion: Geist aus Blut und Boden abgeleitet. Hier fällt – mitverantwortlich – mehrfach der Name Nietzsche. Seine Rückgewinnung des Leibes blieb ortlos: nicht auf das bezogen, was über den Leib hinausdrängt; so suchte sich dieser Gedanke den dämonisch-exklusiven Ort in einer bestimmten Rasse. Damit wurden Leib, Rasse, Aristokratie des Blutes ein tödliches Instrument. Lebenssteigerung, die aus Wirklichkeitsverlust in Tod umschlug.
Liturgie als Schule des Leibes
Ist aber der Leib ein richtig gestaltetes „Gefüge“ von Innen und Außen, dann gehören beide so zusammen, dass „wirklich das äußere Erscheinen in jedem Stück reine und volle Aussprache des Inwendigen“ ist. Elementare Haltungen des Leibes bringen den Un-Fug einer zerfallenen Wirklichkeit in die rechte Ordnung. Sie wehren einem bloß spirituellen Absturz nach innen ebenso wie sie einen leeren Aktionismus nach außen unterbinden.
Guardini beschrieb solche Haltungen und, mehr noch, übte sie mit der ihm anvertrauten Jugend: Sitzen, Stehen, Schreiten, Knien… So entfaltete er in einem ganz ihm eigenen Ton, was Stehen heißt: nicht ein hölzernes Angeschraubtsein, vielmehr: „Stehen ist schwingende Ruhe.“ Knien ist nicht Ausdruck von Unterwürfigkeit, sondern von Demut und Wahrheit bereits in der Gestalt: „schon ist die Hälfte ihrer Höhe geopfert“. Schreiten als eine langsame, gefasste Bewegung ist Ausdruck des Aufrechten: „Frei aufgerichtet, nicht gebückt. Nicht unsicher, sondern im festen Gleichmaß. (…) Leicht und stark, aufrecht und tragfähig, geruhig und von vorandrängender Kraft. (…) Die aufrechte Gestalt, ihrer selbst Herrin, sich selber tragend, ruhig und sicher, die bleibt des Menschen alleiniges Vorrecht. Aufrecht Schreiten heißt Mensch sein.“
Und immer wirkt die Haltung auf die Seele zurück: Sich aufrichten meint schon sich vorbereiten zum Aufrichtigwerden. Ein mündlich überlieferter Satz Guardinis auf Burg Rothenfels lautete: „Man muß einen Saal mit den Schultern betreten“ – nämlich mit erhobenem Kopf dem Saal gewachsen sein, sich von ihm in Weite und Höhe mitnehmen lassen. Anders: in die Gegensatzspannung des Wirklichen eintreten, sich davon aufspannen lassen.
So wird der Leib Zugang zur Wirklichkeit. Unabhängig von den viel später einströmenden asiatischen Übungsmethoden entwickelte Guardini aus europäischer, auch monastischer Erfahrung (immer wieder schöpfend aus dem Benediktinerorden) Übungen des Atmens, des Stillwerdens, der leibhaften Hingabe an das Übernatürliche im Natürlichen.
Programmatische Ausblicke Guardinis lauten: „Der ganze Mensch trägt das liturgische Tun. Wohl die Seele, aber sofern sie sich im Körper offenbart.“ Ziel einer solchen Bildung ist „durchgeistigte Leiblichkeit“, nicht „rein geistige Frömmigkeit“. Hier fällt bereits das viel später zur zögernden Frage umgeformte Wort, der Mensch müsse wieder „symbolfähig“ werden, was auch heißt, die Symbolik des eigenen Leibes wieder wahrzunehmen. Erneut arbeitet Guardinis Denken an der grundsätzlichen Überwindung eines theoretischen Irrwegs: „Wir müssen weg von der verlogenen ‚Geistigkeit’ des 19. Jahrhunderts. Verleibter Geist sind wir.“ „Und welches ist der Sinn des Lebendigen? Daß es lebe, sein inneres Leben herausbringe und blühe als natürliche Offenbarung des lebendigen Gottes.“
Wie gelingt solches „Offenbaren“? Schon in frühen Jahren begleitete Guardini der Aufsatz von Kleist über das Marionettentheater, worin die Frage nach dem Grund der Anmut der Marionette gestellt wird. Die gefundene Antwort lautete, ihre Anmut springe daraus auf, dass die Marionette ihren Schwerpunkt über sich habe. Das leitet zu dem Hinweis über, auch der menschliche Leib könne seinen Schwerpunkt über sich suchen, sich nicht von unten her, von der Schwerkraft weg hochstemmen: Haltung aus Gehaltensein.
Lebendiger Leib offenbart sich, wenn er sich von oben her lebt. Haltungen üben meint, den Schwerpunkt über sich verlegen, sich halten lassen und dadurch Haltung gewinnen.
Liturgische Symbolik des Leibes
Das Durchscheinen der seelischen Haltung im Leib, die Transparenz von Innen und Außen, von Unsichtbarem und Sichtbarem ist die denkbar einfache Grundlage liturgischen Vollzugs.
Guardini erweckt im 4. Kapitel seines Klassikers den Sinn für das Symbol, für das Ganze aus zwei Hälften. Wenn die eine Hälfte, der vollziehende körperliche Ausdruck, fehlt, so ist das Innere nicht nach außen gedrungen, nicht wahrnehmbar, nicht wirklich. Deswegen ist Guardinis Grundbesinnung auf die Liturgie nicht von der Ästhetik – wie ihm unterstellt wurde –, sondern von der Symbolik geleitet. Daraus bezieht sie ihre Stärke, die eben nicht auf einem innerlich gefühlten Erlebnis, sondern auf dem durchdachten, durchreflektierten Wahrnehmen eines Ganzen beruht.
Guardini kennzeichnet unterscheidend die Allegorie als eine nur kulturelle „Übereinkunft“, die einem Ding einen Inhalt zuweist; diese Zuweisung ist aber nicht zwingend, sondern kulturabhängig, auch deutungsbedürftig. Im Unterschied dazu entsteht das Symbol zwingend, als „natürlicher Ausdruck eines wirklichen, besonderen Seelenzustandes.“ Zugleich tritt es aus einem einmaligen Erleben heraus und ins Allgemein-Gültige ein – jeder Kultur in gleicher Weise verstehbar. Im Aufgreifen der beiden dargestellten Schräglagen des Geist-Körper-Bezugs übernimmt das Symbol nun richtig, geraderichtend, „in glücklicher Stunde“ das enge und vertraute Ineinanderspiel der beiden Seiten des menschlichen Daseins, zugleich aber das Eindeutige des geistigen Sehens, die abgegrenzte Form, die durchgestaltete Bedeutung. Symbolisch erwachsende Gebärden werden anschaulich und reich, bleiben dabei aber einfach und lesbar; sie beziehen nicht nur den Leib, sondern auch Dinge mit ein und zeigen sie in gleicher Weise als symbolfähig: Die Gestalt ist unmittelbar durchsichtig auf Sinn.
Ein schönes Beispiel: „So etwa, wenn in einer Opferhandlung die Gabe nicht auf der bloßen Hand, sondern auf einer Schale dargebracht wird. Die Fläche der Schale betont die ausdrückende Wirkung der Handfläche; es entsteht dadurch eine große, nach oben, nach dem göttlichen Wesen hin ausgebreitete, geöffnete Ebene.“ Leibliche Haltung vereint den Trägerstoff mit dem darin wartenden und aufleuchtenden Bild, sie entbindet das Geistige von seiner Spröde, das Körperliche aber von seiner Schwere, seiner bedrängenden Unmittelbarkeit (wie sie die Naturkulte noch pflegen), das Natürlich-Seelische von seiner Unbestimmtheit, strömenden Ungewißheit, Beliebigkeit. „Es wäre der Gegenstand einer sehr fesselnden Untersuchung, zu erforschen, wie die Naturlaute, Naturformen, Naturdinge in der Hand der Liturgie zu Kulturdingen werden.“ Liturgie wird „Schule des Maßes und der seelischen Haltung“. Der Vorgang definiert geradezu Liturgie: Sie formt Natur um zur Kultur.
So ist der Körper selbst, überhaupt das Dingliche, Träger einer Bedeutung, die sich im Tun erst öffnet. Liturgie führt nicht nur zu Gott, sie führt in Welt, die sich für Gott auftut. Das Wort allein ohne das „Fleisch“ der Wirklichkeit wäre nicht stark genug, dieses Freiwerden des Innen zu leisten, wie es der Liturgie gelingt.
Liturgie ist wirklich Schule des Leibes, aber der Leib selbst ist Vorschule der Liturgie.
Das heutige Mißverständnis des Leibes als Körper
Das deutsche Wort Leib verbindet sich in seiner Wortwurzel lb- mit Leben und Liebe. Leib ist immer schon beseelter Leib. Leibhaft ist daher lebhaft. Leib ist aber nicht nur mein Dasein für mich, subjektiv, sondern auch mein Dasein für andere: intersubjektiv. Zur Klärung muss jedoch eine Unterscheidung getroffen werden, die heute zeitgeistig ein Begreifen des Leibes behindert: die Unterscheidung des belebten Leibes vom sachhaften, mechanischen Körper.
Viele Sprachen, so die romanischen, machen keinen Unterschied zwischen Leib und Körper, welcher ein Begriff des Kausal-Naturgesetzlichen und Funktionalen ist, so dass Körper auch das Gegenständlich-Tote sein kann. So nimmt es nicht wunder, dass in der mittlerweile einflussreich gewordenen Gender-Theorie der Körper nur als Werkzeug, als leere Hülle eines abstrakten „Ich“ gesehen wird.
Gender, das nur sozial zugeschriebene Geschlecht, nimmt den Körper als un-wirkliches, passives Objekt einer „Konstruktion“: Er spricht nicht mehr mit, macht selbst keine Aussage mehr über sich. Dieses Verstummen oder Sich-willenlos-überschreiben-Lassen weist auf ein entschieden dominantes Verhalten des „Ich“ zum Körper hin: Keinesfalls ist er mehr „Leib“ mit eigener „Sprachlichkeit“, zum Beispiel in seiner unterschiedlichen Generativität von Zeugen und Empfangen/Gebären oder in seiner unterschiedlichen leibhaften Erotik von Eindringen und Annehmen/Sich-Nehmen-Lassen. Zum „Ding“ reduziert, bleibt er gleichgültig gegenüber dem willentlich Verfügten. Aus Leib wird Körper, und Körper wird zur „tabula rasa“. Seine Symbolik wird nicht fruchtbar, die phänomenale Selbstaussage kastriert.
Die Dekonstruktion des Leibes gerinnt zur Geste des Imperators, der in den Körper wie in ein fremdes unkultiviertes Gebiet eindringt und es besetzt – obwohl er dies doch selbst „ist“. Widerstandslos bietet sich der Leib als „vorgeschlechtlicher Körper“ an.
Folgerecht polarisiert die neue Körperlichkeit dabei nicht mehr weiblich gegen männlich, sondern unterläuft diesen Gegensatz. „Gender nauting“ ist angesagt: das Navigieren zwischen den Geschlechtern. Konkret ist gemeint, dass ein Ausschöpfen aller sexuellen Möglichkeiten von den bisherigen „Konstruktionen“ freisetzen könne. Die eigentliche Stütze der Geschlechter-Hierarchie sei die „Zwangsheterosexualität“, die als bloßer Machtdiskurs entlarvt werden könne. Festzustellen sind mannigfaltige, auch künstlerische Ansätze zur Auflösung und Neuinstallation des Körpers im Sinne einer fortlaufend zu inszenierenden Identität, die sowohl die bisherige angebliche Starre des Körperbegriffs als auch seine Abgrenzung von der Maschine aufhebt – zumindest fiktiv in spielerischer Virtualität (transgender), teils bereits real mit Hilfe operativer Veränderung (transsexuell).
Unsere Lebenswelt ist damit auf dem Weg zur grundsätzlichen Überholung des eigenen Körpers. Nicht mehr nur der Science-Fiction-Leser lässt sich die mögliche Kombination von Mensch und Maschine vorführen. Sie rückt vielmehr in Praxisnähe zum „Cyborg“ = Cyber Organism: einem durch Transplantate und technische Einbauten immer wieder funktionsfähig erneuerten Organismus, zum Einbau von Nanocomputern in den menschlichen Körper, zur High-Tech-Medizin.
Die Frage des alten Guardini drängt sich unabweislich auf, ob eine so konzipierte Spätmoderne überhaupt symbolfähig sei – nicht nur liturgiefähig, sondern leibfähig.
Guardinis nachhallende Wirkung
Zurück zur Leiblichkeit als jenem Grund, auf dessen Ausdrucksgenauigkeit Guardini die Jugend aufmerksam machte.
Leibhaft verstandene Liturgie war für jeden gedacht und denkbar, sie war nicht eine Sache geschulter Mönche. Guardini überbrückte die Kluft zwischen der damaligen monastischen Erneuerung der Liturgie und der für die Laien vollziehbaren – wie Rothenfels überhaupt die Neugestaltung des Lebens aus dem Glauben für die Laien werden sollte und wurde.
Wenn in Rothenfels Versuche in der Neugestaltung des Gottesdienstes unternommen wurden, so nicht von einem beliebigen Konzept aus, sondern immer einleuchtend von der vorgegebenen Aufgabe: als Verwirklichung von Geist in Leib. So konnten dort gefundene Formen, die heute überaus einfach, um nicht zu sagen gewöhnlich wirken, weil sie bereits wieder zur Routine geworden sind, eine geradezu unglaubliche Ergriffenheit auslösen.
Josef Pieper gibt im späten Echo einen Eindruck von einem damals fast umstürzenden Vorgang: „Dies nämlich war das uns am tiefsten Bewegende: wir sahen uns, belehrt und ermutigt durch Romano Guardini, unversehens dazu aufgefordert, jene unerhörten alten Wahrheiten in leibhaftige Realität umzusetzen. Ich bin sicher, daß meine Kinder oder gar meine Studenten es sich schlechterdings nicht mehr vorstellen können, daß und wieso uns einfach der Atem stockte, als Guardini eines Sonntagmorgens die Messfeier damit begann, laut und feierlich zu sprechen: Introibo ad altare Dei, und wir allesamt nicht minder laut und feierlich, antworteten: Ad Deum, qui laetificat juventutem meam.“
Der Vollzug gelang so überzeugend, weil er nicht an die Person, auch nicht an die Person Guardinis gebunden war, sondern weil dieser die sachliche Stimmigkeit des Außen-Innen-Verhältnisses entwickelt hatte.
„Wir lernten begreifen, was ein ‚heiliges Zeichen’ in Wahrheit ist und daß, jenseits aller uns beengenden, geschwätzig moralischen und doktrinären Zudringlichkeit, im sakramental-kultischen Vollzug der Mysterienfeier das als Realität geschieht, wovon sonst bestenfalls geredet wird und daß dies der Kern allen geistig-geistlichen Lebens ist – nicht allein im Christentum, sondern auch in aller vor- und außerchristlichen Religion. Solches Lernen aber spielte sich ab in einer Atmosphäre heiterer, uneingeschränkter Weltoffenheit. Guardini war ein unvergleichlicher Lehrer “.
Was lehrte er, kurz gefasst? Dass der Leib der Lieblingsweg der Gnade, der Lieblingsweg der Liturgie ist.