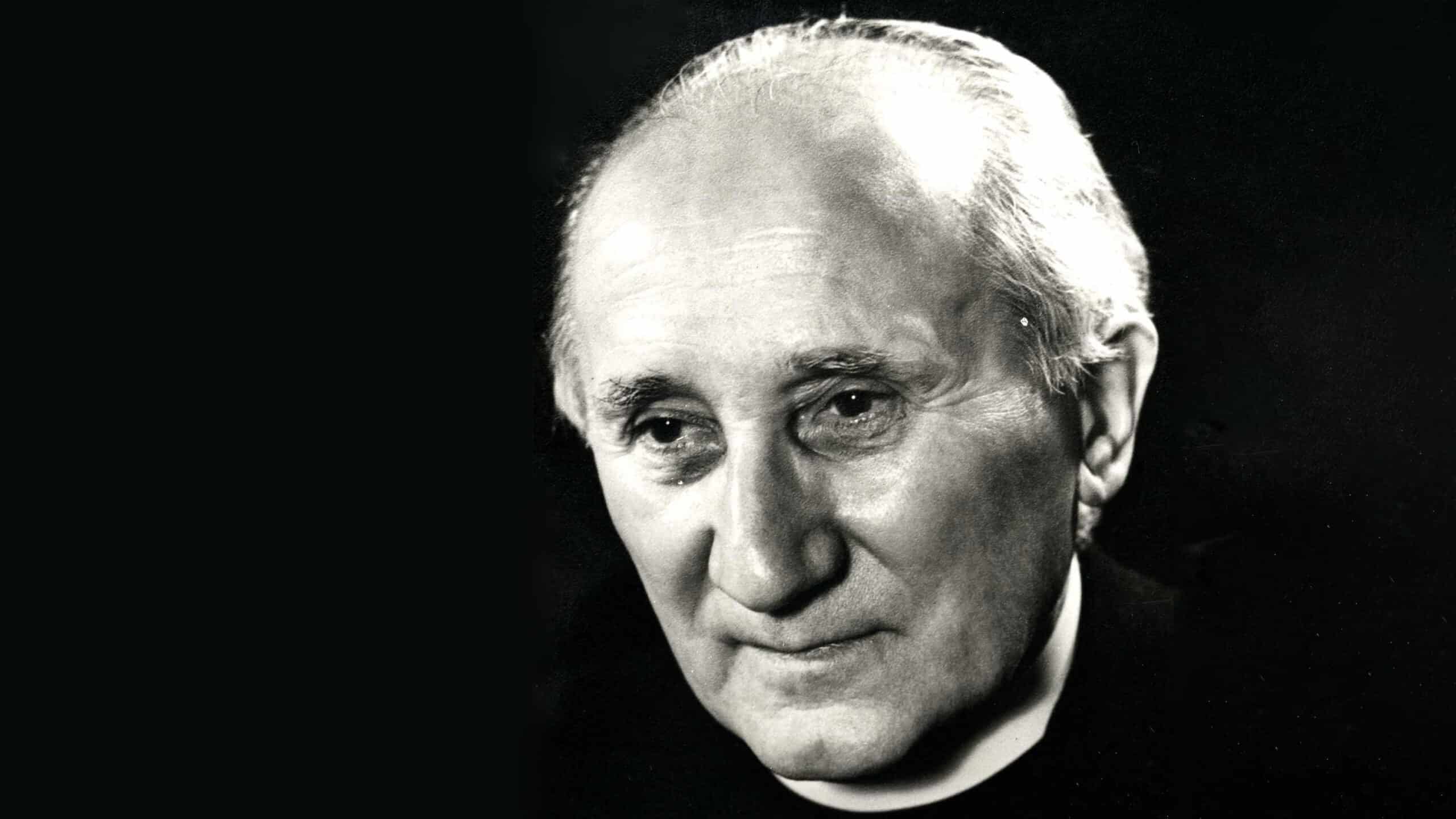Obwohl meine Reflexionen zum Begriff der Person nicht direkt in den Spuren Romano Guardinis gehen, sondern einen ganz unabhängigen Ansatz verfolgen, und obwohl ich gerade nicht die Person im Geleis der traditionellen ‚Gottesebenbildlichkeit’ verstehen möchte, sondern ganz neutral und ohne Bezug auf religiöse Überzeugungen, kann ich doch eine sehr pointierte Wendung Guardinis für meine Überlegungen zum Ausgangspunkt nehmen: „Die grundsätzlich einsame Person gibt es nicht“, so schreibt Guardini in Welt und Person. Und weiterhin: „Hier handelt es sich Reflexionen über einen Problembegriff um eine ontologische Tatsache, daß es grundsätzlich die Person in der Einzigkeit nicht gibt.“
Es ist diese ontologische Tatsache, die mich interessiert und die ich mir zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen machte, um systematisch über Natur und theoretische Physiognomie dieses viele philosophische, ethische und kulturelle Lasten tragenden Begriffs der Person nachzudenken. Gerade ontologische Tatsachen sucht man sonst gerne nur im einzelnen Fall oder einzelnen Individuum einer bestimmten Sorte: Was ist der Mensch? Was ist ein Atom? Gibt es einen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier? Es scheint uns, als würde eine ontologische Tatsache immer in den einzelnen Dingen zu Hause sein: Erst wenn man das Eine von einer Sorte ontologisch erfasst und beschrieben hat, dann lässt sich dies, was man dort gefunden hat, auch auf mehrere gleichartige Fälle und vielleicht alle Fälle dieser Sorte von Dingen übertragen.
Bei der Person scheint es sich dagegen anders zu verhalten: Wir sprechen von der ersten, zweiten, dritten Person, und es ergibt daher gar keinen Sinn zu denken, wir hätten nur eine davon. Ich möchte gar nicht anfangen zu reden von einem Gott in drei Personen; es genügt darauf hinzuweisen, dass die Person, jede Person ursprünglich und immer ein Gegenüber anderer Personen ist: Die ‚Amtsperson’ ohne personales Gegenüber, vor der sie ihr Amt versieht; oder die Person als sprechende und handelnde ohne das Gegenüber, woraufhin gesprochen oder gehandelt wird, wären ein Unding. Die Person ist nur dann nicht ein Unding, wenn es mehrere davon in einem Gegenüber gibt. Personen, so sagte und schrieb auch mein eigener philosophischer Lehrer, Robert Spaemann, „Personen gibt es nur im Plural“.
Meine Frage ist nun die: Wie drückt sich diese ontologische Tatsache (dass es die Person nicht in Einzigkeit gibt) in jeder einzelnen Person aus? Nicht zum Beispiel ja dadurch, dass die einzelne Person spricht und so einen Adressaten oder ein Gegenüber für ihr Sprechen findet. Denn es gibt Personen, die nicht sprechen können (z.B. gerade geborene Kinder oder irreversible Komapatienten). Also kann sich die ontologische Tatsache, dass es mehrere Personen im Gegenüber gibt, nicht so in jeder Person ausdrücken. Auch nicht dadurch, dass die einzelne Person vernünftig ist und sich auf das Allgemeine versteht; denn wiederum mag es Personen geben, die nicht vernünftig sind und sich nicht auf das Allgemeine und die Allgemeinheit hin verstehen. Gerne wird gesagt, dass doch wenigstens die Möglichkeit und das Potential in jeder Person angelegt sei, zu sprechen oder vernünftig zu sein. Doch ist es noch niemandem gelungen zu erklären, wann genau und unter welchen Bedingungen dieses Potential gegeben ist und wann nicht. Hat ein Embryo in der 6. Woche das Potential zu sprechen oder vernünftig zu sein? oder hat er es nicht – das Potential? Hat ein irreversibler Komapatient dieses Potential? Hat vielleicht ein uns persönlich vertrauter Hund, mit dem wir Zwiesprache halten, ein solches Potential oder nicht? Die Rede von dem Potential oder dem Sein in potentia ist nur eine Redensart, mit der wir das, was wir annehmen möchten, in die Sache hineinlegen, in die wir es möchten, aber sie kann nicht ausdrücken oder klar machen, worin eine gewisse ontologische Tatsache wirklich besteht.
Alle Menschen sind Personen – aber vielleicht nicht nur die Menschen
Wenn es so schwierig ist, „die ontologische Tatsache, dass es grundsätzlich die Person in der Einzigkeit nicht gibt“ als eine Realverfassung jeder einzelnen Person zu verstehen, ist es dann nicht doch besser, umgekehrt von den Eigenschaften oder der Natur einzelner Individuen auszugehen und zu sagen, dass Personen und Person-Sein eben in solchen Eigenschaften oder einer solchen Natur bestehe? Also bspw. der Mensch, jeder Mensch ist eine Person, und wir wissen ja, was ein Mensch von Natur aus ist, nämlich ein Exemplar der Spezies homo sapiens. Sagen wir also nicht besser einfach, Person zu sein heiße eben, Mensch zu sein und alles, was die Natur des Menschen besitzt, das ist auch Person?
Jedoch spricht in den Augen vieler Philosophen einiges gegen diese Lösung: Erstens können wir ja nicht ausschließen wollen, dass dann, wenn wir vielleicht irgendwann einmal auf andere intelligente, vernünftige und sprechende Wesen im Universum stoßen würden (oder auch auf der Erde, z.B. wenn wir dereinst auf biotechnischem Wege dienstbare Geister für unser Leben erzeugt hätten, die plötzlich auf die Idee kommen, sie seien ebenfalls Personen, und ihre Rechte einfordern) – wir können also nicht ausschließen, dass wir auf Personen stoßen, die keine Menschen sind, aber trotzdem Personen. So dass es nicht an unserem Menschsein liegen würde, dass wir Personen sind, sondern an etwas anderem. Wieso sollten sie Personen sein, ohne auch Mensch zu sein? Wer dagegen sich entschlösse zu sagen, nur Menschen sind Personen und nur wir bilden den Club, der sagt, was uns sonst noch als eine Person gilt und was nicht – basta! Der wäre so etwas wie ein Rassist: Nur die Mitglieder meiner Rasse oder meiner Ethnie oder eben meiner Spezies gelten als Personen und verdienen deshalb Anerkennung und Respekt als mir selbst Gleiche; alle anderen lasse ich nur von meinen oder unseren Gnaden als solche gelten, aber das überlege ich mir gut von Fall zu Fall! – Es ist wohl allen klar, dass das philosophisch und gedanklich überhaupt nicht anginge.
Das Problem ist, um es noch einmal in seinem Kern zu fassen, dass Status und Ontologie der Person einerseits nicht mit den definierenden Merkmalen einer natürlichen Art oder Klasse von Wesen identifiziert werden sollte (hier lauert die Gefahr des Rassismus oder Speziesismus), er aber andererseits auch nicht durch besondere Tüchtigkeiten (wie Vernünftigkeit, Vertragsfähigkeit oder Sprachfähigkeit) erst zugesprochen werden darf (Gefahr einer diskriminierenden oder selektiven Einschränkung des Personbegriffs). Die ‚Person‘ ist weder ein Naturbegriff (wie bspw. homo sapiens) noch ein bloßer Ehrentitel, den wir nach unserem Gutdünken verleihen, obwohl der Ausdruck mitunter in beiden verfehlten Weisen verwendet wird.
Die zweifache Wurzel des Personenbegriffs
Die Grundidee, die ich hier formulieren möchte, ist, dass ein Mensch oder irgendein anderes lebendiges Wesen, das mit seiner bloßen Existenz unvermeidlich an einer bestimmten Form des Lebens oder Daseins teilnimmt, ebenso unvermeidlich eine Person ist und deshalb auch so angesehen werden muss. Dass es in dieser Lebensform existiert oder zu sein hat, liegt nicht an ihm und daher auch nicht an den Fähigkeiten, die es entweder mitbringt oder sich erwirbt. Es wird vielmehr ab ovo versetzt in diese Form. Dass es hingegen in derselben Form gedeiht und nicht tendenziell zugrunde geht oder verkümmert, das liegt dann weiterhin an ihm selbst und seinen natürlichen und erworbenen Eigenschaften.
Wesentlich für den Begriff der Person ist die Zusammenführung zweier begrifflicher Wurzeln in einem kombinierten oder, pejorativ ausgedrückt, Hybridbegriff: Zum einen ein die Natur oder Ursprungsbeschaffenheit der Person betreffender Sortenbegriff; zum andern (und zugleich) ein die Lebenssituation der Person betreffender Ordnungsbegriff. Jede Person im ursprünglichen Sinne des Worts hat erstens eine Natur in einem noch zu erläuternden Sinn und befindet sich zweitens ab ovo in einem Ordnungs- oder „Beziehungssystem“ (dieser Ausdruck stammt von Robert Spaemann), das von Grund auf die Lebenssituation und daher generell auch die Lebensform der Individuen jener Natur bestimmt. Das gemeinte Beziehungssystem ist nicht zu verwechseln mit einer bestimmten Art sozialer Organisation, die jedem Glied gewisse Rechte und Pflichten auferlegt, sondern besteht, ganz abstrakt gesprochen, in der eindeutigen Bestimmtheit und bleibenden Beachtlichkeit des Platzes in einem Lebensverband, den jemand kraft bloßer Zugehörigkeit zu diesem Verband automatisch einnimmt. Dazu gleich mehr.
‚Natur‘ zu haben bedeutet, abstrakt gesprochen, Empfänger oder Spender der Übertragung eines Lebenserbes zu sein, das die Substanz oder das gesamte Sein der betreffenden natur-besitzenden Entität ausmacht. Etwa so, wie im Falle der menschlichen Person die Zugehörigkeit zur Spezies ‚Mensch‘ eben die Natur dieser Person ist und ihre Substanz oder ihr vorgegebenes Sein ausmacht. Wesentlich ist dabei auch, dass dieses Natur-Erbe durch eine Filiation lebendiger Wesen (d.h. ‚Vertöchterung’ oder Bildung von Nachkommen) an den jeweiligen Einzelfall übertragen wird, so dass gesagt werden kann: Alle ursprünglichen Personen sind Mitglieder von Filiationsverbänden, die eine jeweils gemeinsame Natur als ihr Lebenserbe teilen. Die Person kann deshalb nichts für ihre Natur, und niemand kann etwas daran ändern, dass eine Entität in einem derartigen Filiationsverband eine ‚Person‘ ist, wenn ein solcher Verband überhaupt Beispiele für Personen enthält.
Doppelte Identifizierbarkeit als Basis personaler Existenz
Doch sind natürlich nicht die Mitglieder aller Filiationsverbände überhaupt, die auf die geschilderte Weise eine gemeinsame Natur haben, schon Personen. Die meisten Tiere oder Lebewesen sind es nicht und auch nicht die Pflanzen. Vielmehr muss die schon erwähnte zweite Wurzel des Personenbegriffs hinzukommen, der zufolge alle Mitglieder des betreffenden Filiationsverbands mit dieser Herkunft automatisch in ein bestimmt qualifiziertes Beziehungssystem versetzt sind, das ihre Lebenssituation ausmacht, in der die hochgradig allgemeine Lebensform der Mitglieder dieses Verbands gründet. Dieses Ordnungs- oder Beziehungssystem besteht darin, dass dem jeweiligen Individuum ein im Verhältnis zu allen anderen bestimmter „Platz“ in dem relevanten Ensemble derer zukommt, die ebenfalls zum Filiationsverband gehören. Ein solcher „Platz“ ist nicht hierarchisch oder im Sinne altertümlicher patriarchalischer Gesellschaftskonzepte zu verstehen, sondern ganz neutral wie die eindeutige Position innerhalb eines Koordinatensystems – nur eben innerhalb des entsprechenden Filiationsverbandes und wiederum der Vereinigung solcher Verbände. Dass jede Person einen derartigen ‚Platz‘ einnimmt, der als Platz nicht durch die, die ihn besetzt, definiert sein kann, sondern vielmehr durch das Verhältnis zu allen anderen Plätzen in jenem „Beziehungssystem“ – diese Tatsache kennzeichnet die Lebensweise von Personen: Das einzelne Individuum wird von allen anderen nicht allein in Beziehung auf seine Eigenschaften als ‚dieses‘, das es ist, wahrgenommen, sondern immer auch und zugleich als Platzhalter, der diesen und keinen anderen Platz in dem relevanten Ausschnitt der Personengemeinschaft einnimmt. Da der Platz eine von ihm selbst unabhängige Definition besitzt, könnte er im Prinzip auch von jemand anderem eingenommen werden. Wir kennen diese zweite Wurzel des Personseins aus vielen Umgangsformen und Praktiken, die bei allen Menschen von jeher verbreitet sind, wie z.B. der Praxis, jedem einen Namen zu geben, oder der Praxis, eine Geburtsurkunde auszustellen, d.h. den ‚Platz’ im Filiationsverband festzuhalten, an den jemand gehört. Wichtig ist, dass Name und Urkunde nicht ein Prädikat oder eine Eigenschaft der betreffenden Person sind, sondern nur äußerliche Markierungen ihres Ortes im Beziehungssystem.
Von daher ist eine Person genau die, die sie ist, in einem doppelten Sinn: Zum einen durch die per Filiation ererbte Kombination natürlicher und späterhin erworbener Eigenschaften. Zum andern durch Einnahme und Markierung des bestimmten Platzes im assoziierten Beziehungssystem. Diese doppelsinnige Identifizierbarkeit einer Person prägt ihre Lebensform grundlegend dann, wenn sie durch sämtliche oder hinreichend viele Mitglieder des Filiationsverbandes als solche – nämlich doppelsinnige – wahrgenommen wird. Insbesondere ist nicht erforderlich, dass die doppelsinnige Identität durch das betreffende Individuum wahrgenommen wird, das wahrheitsgemäß als eine Person zu bezeichnen ist.
Bei der doppelsinnigen Identifizierbarkeit und ihrer Wahrnehmung durch Mitglieder des betreffenden Verbands handelt es sich offenbar um eine bloße Formalität, die nicht festgelegt ist auf eine bestimmte Natur oder Spezies. Sie kann deshalb, weil formal, auf ganz unterschiedlichen Spezies oder durch Filiation verbundenen Naturen errichtet sein, bei denen es sich dann immer um ursprüngliche ‚Personen‘ im gleichen Sinn handeln würde. Alle Personen überhaupt würden dennoch – über etwaige Speziesgrenzen hinweg – stets eine einzige Personengemeinschaft als das alle Personen umfassende Ordnungs- oder Beziehungssystem bilden, in der jede genau einen abstrakt definierten Platz einnimmt – so wie de facto auch die verschiedenen engeren Familienkreise von Menschen, die unter sich von Haus aus gar keinen Kontakt miteinander haben mögen, gleichwohl zusammen eine einzige Personengemeinschaft bilden, in der jede Person genau einen abstrakt definierten Platz einnimmt. Sämtliche personalen Filiationsverbände verschmelzen zu einer universalen Sozietät von Personen auch dann, wenn sie sich untereinander nicht einmal kennen. Der Vorwurf des Speziesismus kann folglich an eine solche Konzeption des Begriffs der Person nicht gerichtet werden.
Wir haben damit das meiner These nach typische Charakteristikum der Personalität als eine für alle Personen unaustilgbare Lebensform erreicht: Nämlich zum einen als Mitglied eines Filiationsverbands zu existieren, in dem ihr eigenes Lebenserbe weitergegeben wird, so dass zum andern ein jedes davon durch zwei Identitäten identifizierbar ist: Einmal durch seine natürlichen und biographischen Eigenschaften; zum andern durch seinen für alle andern markierten Platz im Beziehungssystem der alle Personen abstrakt umfassenden Sozietät und seiner konkreten Untergliederungen in Familien oder Filiationsverbände. Lebendige Individuen sind also dadurch Personen, dass sie ab ovo in einem Beziehungssystem existieren, in dem unaustilgbar eine derartige Lebensform – nämlich die der Wahrnehmung einer doppelten Identität ihrer Mitglieder – herrscht.
Die Lebensform als unaustilgbares Gepräge biographischer Existenz
Bei jedem lebendigen Wesen scheint das Wort „Existenz“ eine doppelte Bedeutung zu haben: ‚Existenz‘ eines Lebewesens heißt zum einen, dass es ein Wesen der und der Art und Beschaffenheit ‚gibt‘ oder, anders gesagt, dass mindestens ein konkreter Fall von solcher Beschaffenheit vorkommt. Dies nennt man in der Philosophie die exemplifizierende Existenz, die bei Lebewesen mit der biologischen Existenz zusammenfällt. Zum Beispiel ‚gibt es‘ oder ‚existiert‘ das Pferd, das das letzte Pferderennen von Ascott gewonnen hat. Aber es existiert nicht bspw. der Zentaur, den Herakles mit einem vergifteten Pfeil getroffen hat. Hier bedeutet Existenz, dass der Begriff eines so und so zu charakterisierenden Lebewesens nicht leer ist, sondern eine Erfüllung hat. Alle Prädikate eines Individuums, die in diesem Sinn von irgendwelchen Lebewesen erfüllt werden, sind nicht ausschlaggebend dafür, dass es sich um Personen handelt.
Doch besteht die zweite Bedeutung von ‚Existenz‘ bei Lebewesens darin, dass es nur solange und nur insofern existiert, als es lebt oder lebendig ist. Wir können dies als die biographische Existenz speziell bei Lebewesen bezeichnen: Selbst wenn das Pferd, das das oben erwähnte Pferderennen gewonnen hat, ‚existiert‘ im ersten Sinn, ist nicht sicher, dass es heute auch im biographischen Sinn noch ‚existiert‘, d.h. lebt, wie ein Rennpferd eben lebt. Es könnte vielmehr schon tot oder verendet sein. Es könnte auch den Weg in eine Pferdemetzgerei gefunden haben. Dann gäbe es das betreffende Pferd nicht mehr und es existierte nicht länger als ein Pferd, sondern als Fleischvorrat im Kühlhaus.
Dieser zweite und biographische Sinn von Existenz im Sinne von ‚Am-Leben-Sein‘ darf nicht mit Fällen gleichgesetzt werden, wo wir bloß eine mit der Existenz im ersten Sinn beginnende ‚weitere Karriere‘ eines Dinges durch gewisse Veränderungen hindurch betrachten, während der ihnen gewisse Fähigkeiten oder Funktionen abhanden kommen. Zum Beispiel die Karriere eines staubsaugenden Roboters bis zu dem Punkt, wo er kaputt ist und keinen Staub mehr aufnimmt. In solchen Fällen hängt es nur vom Betrachtungsaspekt ab, ob noch von der Existenz desselben Dinges vor und nach dem besagten Karrierepunkt zu sprechen ist oder nicht. Bei Lebendigem ist dies jedoch nicht betrachtungsabhängig, sondern in der Sache selbst verankert. Denn alles Lebendige verkörpert ein seine gesamte Existenz übergreifendes Interesse an seiner zusammengesetzten Integrität, das es zugleich genau so lange verfolgt und daran festhält, solange es lebt. Der Tod oder die Zerstörung einer solchen lebendigen Struktur ist deshalb definitiv der Fortfall seiner biographischen Existenz.
Der beschriebene zweite Sinn von Existenz als ‚Am-Leben-Sein‘ eines lebendigen Individuums ist es, der bei Gegebenheit einer bestimmten Form, die diesem Leben ihr Gepräge gibt, den Grund dafür legt, dass es sich bei dem betreffenden Individuum um eine Person handelt. Die besagte Lebensform, ist sie als eine Form des Lebens vieler wirklich, steht zu niemandes Disposition. Das heißt, weder das je betreffende Individuum in seinem biographischen Einzelleben noch die anderen unter ihr existierenden lebendigen Individuen entscheiden und disponieren darüber, dass sie Personen sind. Aber dies liegt nicht daran, dass sie als Einzelindividuen bestimmte Charakteristika erfüllen, die andere Lebewesen nicht oder angeblich nicht aufweisen; sondern es liegt daran, dass sie der betreffenden und gleich noch genauer zu beschreibenden Lebensform unterliegen.
Die Form des Lebens, in die ein Wesen mit seiner Existenz eintritt, ist zugleich hochgradig allgemein und stark umgebungsabhängig. Ob sie gegeben ist oder nicht liegt nicht an dem je einzelnen, der mit seinem Lebensbeginn in sie eintritt, sondern an den anderen, die sie schon vorher hatten, sowie an den Bedingungen der ‚Nische‘ und allgemeinen Lebensverhältnisse, in welche der Existenzeintritt eines Lebewesens erfolgt. Natürlich korrespondieren auch die naturgegebenen Merkmale des Mitglieds einer Lebensform den Lebensumständen der Form mehr oder weniger, aber sie entscheiden im individuellen Fall nicht darüber, ob etwas bspw. ein Raubtier ist oder nicht. Ein bestimmter Löwe wäre auch dann ein Raubtier zu nennen, wenn er, statt Antilopen zu jagen, immer mit Soja ernährt werden würde. Ähnlich auch im Falle der Person.
Eine Lebensform setzt deshalb immer biographisch oder durch ihr individuelles Verhalten differenzierte lebendige Individuen voraus, die dennoch in Bezug auf die formal zusammengehörigen Gesamtgruppierungen (also etwa die Gruppierung der ‚Raubtiere’) im Sinne eines signifikanten Gepräges hochallgemeine Verhaltenszüge aufweisen. Signifikant ist ein derartiges Gepräge dann, wenn in ganz unterschiedlichen biographischen Verhaltensweisen dieser Individuen fast immer oder in hinreichend vielen Fällen formal gleichartige (= sinngleiche) Züge mit zur biographischen Ausprägung kommen.
Lebensformen, weil sie auf biographisch variablem (nicht biologisch arretiertem) Verhalten von gleichwohl hoher Allgemeinheit über Gruppierungen und Arten hinweg sind, können sich historisch oder geschichtlich in größerem Zeitmaßstab entwickeln oder verändern, wobei ihre Signifikanz im Sinne derselben Form erhalten bleibt. Die Lebensform ist wie eine Art Schwerpunkt der unterschiedlichsten Verhaltensweisen vieler lebendiger Individuen durch die Zeiten und Generationen hindurch zu verstehen, in den die einzelnen Biographien im Durchschnitt auch dann am leichtesten wieder zurückkehren, wenn sie durch an der Lebensform ansetzende Manipulationen teilweise oder ganz davon wegbewegt werden.
Weil Lebensformen prinzipiell verhaltensrealisiert sind, sind sie umso weniger biologisch festgelegt, desto weniger eben das Verhalten gewisser lebendiger Individuen biologisch festgelegt ist. Sie haben jedoch ein relativ stabiles Fundament in der gleichartigen Lebenssituation der betreffenden Individuen und in den natürlichen Anlagen, die sie besitzen. Beides zusammen: die Anlagen plus stabile Lebenssituation begründen Verhaltens-präferenzen, die unter gewissen Umständen eine Lebensform ausprägen, die für die betreffenden Filiationsverbände nicht zu beseitigen und nicht von ihnen zu trennen ist. Weil sie entsprechend tief fundiert oder gewurzelt sind, stehen sie nicht zur Disposition willkürlicher Veränderung durch ausgewählte Gruppen oder Individuen, so wie der Grundzug des Sprechens in der Lebensform des Menschen nicht zur Disposition von willkürlicher Entscheidung bestimmter jetzt lebender Menschen oder Menschengruppen steht.
Stellvertretung als biographisches Grundmuster der personalen Lebensform
Auch die Lebensform gemäß dem früher erklärten Doppelsinn der Identität jedes Einzelnen, die das Person-Sein aller Mitglieder eines solchen Filiationsverbands begründet, steht aus den gleichen Gründen nicht zur Disposition von Willkür oder Wahl irgendwelcher Zensoren oder der betreffenden Individuen selbst. Zwar ist es wohl möglich, einzelnen durch künstliche Maßnahmen die individuelle Aneignung einer Lebensform vorzuenthalten (so wie man versucht hat, einzelne Menschen durch künstliche Maßnahmen vom Sprechen abzuhalten). Doch ist es undurchführbar, eine Lebensform insgesamt den betreffenden Individuen und Gruppierungen auszutreiben und durch eine andere Lebensform zu ersetzen. Die einzelne Katze ließe sich vielleicht vegan ernähren oder dazu abrichten, vor einer Maus Reißaus zu nehmen, aber undurchführbar wäre es, den Katzen überhaupt die Lebensform des Raubtiers gänzlich auszutreiben.
Die erläuterte doppelte Identifizierbarkeit individueller Lebewesen in einem familiär koordinierten Lebenskontext durch Filiation verwandter Mitglieder des Verbandes führt nun zur Lebensform von Personen dann, wenn sie von hinreichend vielen dieser Mitglieder in deren biographischem Verhalten für sämtliche Mitglieder wahrgenommen wird. Die relevante ‚Wahrnehmung‘ beinhaltet, dass ihr biographisches Verhalten zu und in Verbindung mit jedem beliebigen Mitglied durch den prinzipiell gegebenen Unterschied zwischen dem markierten ‚Platz‘, den genau es in der Gemeinschaft einnimmt, und den individuellen Eigenschaften, die es besitzt, signifikant geprägt ist. Ein Verhaltensgepräge dieser Art verlangt nicht, dass der Unterschied als solcher bewusst ist oder gar ausdrücklich über ihn reflektiert wird. Ein Kind zum Beispiel wird in seinem Verhalten signifikant dadurch geprägt werden, dass ein Geschwisterkind, das sonst immer zu Hause mit zu Abend gegessen und die Nacht verbracht hatte, heute zum ersten Mal bei einem ‚Freund‘ über Nacht bleibt oder ‚ins Krankenhaus‘ musste etc. Der Platz des Geschwisters bleibt heute leer, ganz egal was für Eigenschaften es besitzt und ob es adoptiert ist oder nicht, ob es schwer behindert, gar ohne Bewusstsein ist oder nicht. Auch während einer Schwangerschaft oder bei Vorbereitung einer Adoption hätte jemand, dessen besondere Eigenschaften oder Aussehen noch nicht einmal bekannt sind, bereits seinen ganz bestimmten „Platz“ in der Familie oder in der Lebensgemeinschaft, die solche Anstalten auf Erweiterung macht. Bei nahezu allen noch so unterschiedlichen Verrichtungen des Lebens, dem Spielen, Essen, Schlafen, Ausflüge machen, zur Schule gehen, Einkaufen etc. pp., werden von jedem so Wahrnehmenden in Bezug auf jedes andere Mitglied im relevanten Verbandsausschnitt gewisse Stellenwerte im eigenen Verhalten eingeräumt oder markiert, die im Prinzip auch von jemand anderem am selben Platz im Filiationsverband besetzt werden könnten: Es hätte jemand mit ganz anderen Eigenschaften denselben Platz einnehmen können, den eine bestimmte Person jetzt nun einmal innehat. Das biographische Gepräge individuellen Verhaltens innerhalb der personalen Lebensform ist deshalb bei allen, die es überhaupt wahrnehmen, ‚vielstellig‘ in Beziehung auf alle relevanten Plätze in der Gemeinschaft, wobei diese Vielstelligkeit per se noch überhaupt nicht nach wertpositiven oder wertnegativen Gesichtspunkten, nach richtig oder verfehlt, verquer oder angepasst usw. bestimmt ist. Diejenigen, die das Beziehungssystem ihrerseits nicht wahrnehmen, werden daher immer mitvertreten durch ihre Stellen im Verhalten anderer, und diese Vertretung ist aus dem Grund sinnvoll und möglich, weil die personale Lebensform in der oben erklärten doppelten Identifizierbarkeit – durch den ‚Platz‘, den jemand einnimmt, und durch seine Merkmale und Eigenschaften – wurzelt. Vertreten werden kann (wie auch seinerseits vertreten) nur Solches, dessen Platz in einem Lebenszusammenhang unabhängig von seiner individuellen Charakteristik ist.
Die geschilderte Lebensform unter dem Doppelsinn der Identität, welche den gemeinsamen ontologischen Status aller ursprünglichen Personen überhaupt begründet, bildet nach meiner Auffassung ein objektives Fundament und die Stütze normativer Grundsätze, wie sie sich seit jeher um den Personbegriff und die besondere „Würde“ von Personen ranken. Aber die personale Lebensform als Fundament und Stütze normativer Grundsätze ist noch nicht selbst eine Norm, die eine bestimmte ‚Natur‘ oder ‚Grundverfassung‘ des Menschen als unausweichlichen normativen Grundmaßstab der Menschheit überhaupt geltend machen würde. Vielmehr begünstigt die geschilderte Lebensform nur die Akzeptanz solcher Normvorschläge unter Personen, die eine normativ geregelte Mitvertretung anderer bei ihrer Selbstvertretung jeweils als ‚gerecht‘ erscheinen lassen. Grundlegend in Anbetracht der Lebensform ist jedenfalls die beschriebene Art der ‚Wahrnehmung‘ des Platzes anderer Personen im eigenen Verhalten, die ab ovo die Lebensform von Menschen und aller Personen überhaupt auszeichnet.
Wenn wir am Schluss versuchen, die Ausrichtung auf „Stellvertretung“ und die mit ihr einhergehende formale Vielstelligkeit unseres Verhaltens als Grundverfassung und Kernleistung personalen Daseins, die durch eine bestimmte Lebensform fundiert ist, auf eine für alle Personen gültige und handhabbare Formulierung zu bringen, so ließe sich sagen: Die Lebensform personalen Daseins ist das Zusammenleben in einem Verband durch Filiation verketteter Gleichartiger, der dadurch qualifiziert ist, dass jedes seiner Mitglieder, das sich selbst vertreten kann, alle biographisch relevanten Mitglieder gleichförmiger Verbände mit zu vertreten hat. Da es sich, wie erklärt, um eine Lebensform handelt, wird die Qualifikation des Lebens im Muster mannigfacher Stellvertretung nicht von den am Verband beteiligten einzelnen Mitgliedern ausgesagt, sondern kommt dem jeweiligen Lebensverband oder der Sozietät der Personen insgesamt zu: Sie ist eine Form, die primär den Plural der in ihr verbundenen Glieder, nicht das einzelne Individuum kennzeichnet – also eine ontologische Tatsache, die nur aufgerichtet werden kann auf vielen Fundamenten, nicht aber auf einem einzelnen Exemplar.
Sich selbst zu vertreten, d.h. auseinanderzuhalten zu können, was nicht nur überhaupt mein Interesse, sondern ein solches Interesse an meinem Platz und damit im Verhältnis zu anderen Plätzen ist – das involviert die, wenn auch nur angedeutete, aber im Prinzip unabgeschlossene Vielstelligkeit in meinem Verhalten bei der Wahrnehmung meiner Interessen und auch sonst bei meinem Tun und Lassen. Wir sprechen ganz gewöhnlich davon, nicht nur die Interessen anderer zu ‚vertreten‘, sondern und sogar in erster Linie unser je eigenes. Jeder vertritt früher sein eigenes Interesse als das von anderen. Dies besagt also nur: Eine solche Person äußert nicht nur ihr Interesse oder geht ihm nach, sondern sie äußert und verfolgt es als eines, das sie an ihrer Stelle eben hat. Wenn aber an ihrer Stelle, dann so, dass diese Stelle als nur eine im Verhältnis zu anderen Stellen wahrgenommen wird, die mit ähnlich relevanten Interessen besetzt sein könnten. Dies ist der Sachverhalt der Selbstvertretung. Ein Neugeborenes zum Beispiel äußert zwar sichtlich Interessen, aber es vertritt sie nicht selbst.
Wer sich nun in einem so strukturierten Verband nicht selbst vertreten kann, die wird in der beschriebenen Weise dank der Lebensform durch andere mitvertreten; wer aber sich selbst und seine Interessen zu vertreten gelernt hat, für die ist die Zahl der Plätze, die sie mit zu vertreten hat zwar niemals geschlossen und vielmehr unabsehbar, aber doch zugleich geordnet in einem System der Relevanz dieser Plätze in Bezug auf den eigenen, den sie einnimmt. So dass insgesamt der Grundtenor der Selbstvertretung, d.h. der Auseinanderhaltung des Eigeninteresses und zugleich des Platzes oder der Stelle, an der mein Interesse sich artikuliert, die immer und nur im Kontext mit anderen Plätzen zu sehen und zu bestimmen ist, eine jede wahrnehmungsfähige Person anfällig macht für Normen, die die Ansprüche anderer auf eine gerechte und gerechtfertigte Weise gegenüber den meinen wahren sollen. Aber nicht diese Normen sind und gelten ‚unbedingt‘ für mich (vielmehr kann ich immer fragen, warum denn gerade auch ich irgendeine Norm zu befolgen habe), sondern die Ausgangsverfassung einer mir unvermeidlichen Lebensform gibt meinem Verhalten ein personales Gepräge, bevor ich mich auch nur selbst vertreten kann. Dieses Gepräge ist Ausdruck der personalen Lebensform (der „ontologischen Tatsache, dass es grundsätzlich die Person in der Einzigkeit nicht gibt“ – Guardini), aber niemals so, dass es dem Individuum, das sich selbst vertreten kann, nicht möglich wäre, sich den normativen Anforderungen, die darauf gestützt an es gerichtet werden, zu verschließen oder ganz zu entziehen. Der Lebensform können wir uns zwar alle nicht entziehen, aber den darauf aufgerichteten normativen Regelungen unseres Lebens doch jederzeit.