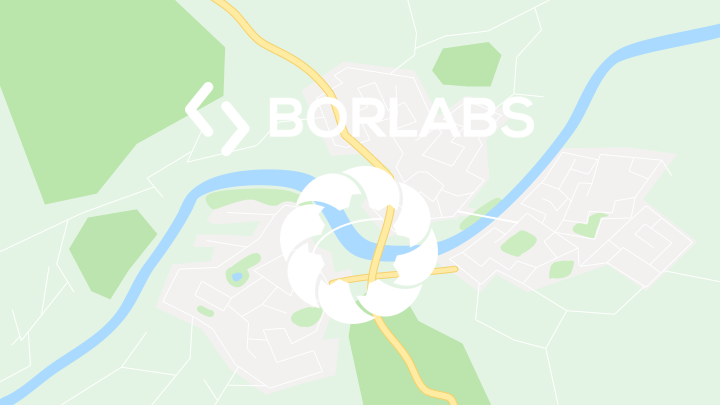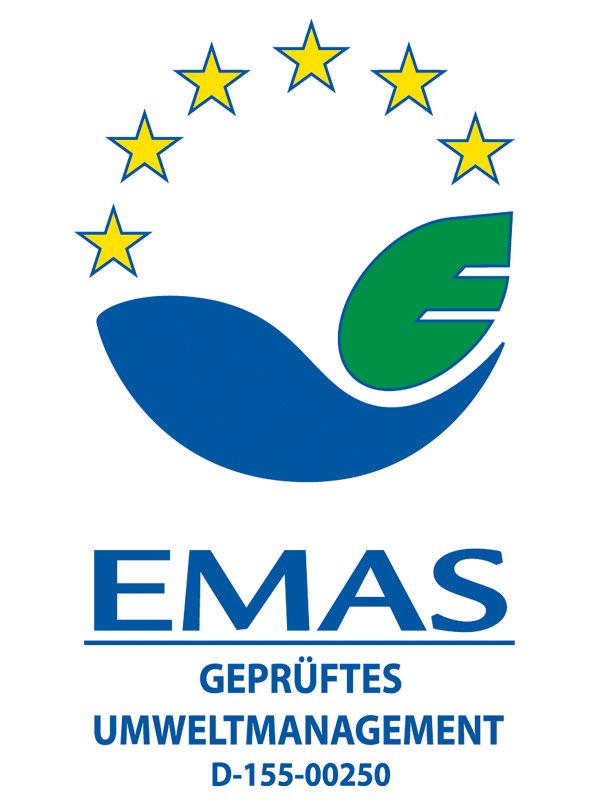Die Tagung stellt die Grundsatzfrage nach der Legitimation von Recht in der Gesellschaft. Es geht um religiöse und weltliche Begründungen, um positives und überpositives Recht, um Staat und Religion und schließlich auch das Individuum in der Gemeinschaft. Kurz: Es geht um „alles, was Recht ist”. Stellt man die Frage nach der Legitimation von Recht in dieser Breite, dann betrifft sie praktisch alle Geistes- und Sozialwissenschaften, einige davon kamen auf dieser Tagung zu Wort: die Kulturwissenschaften (Jan Assmann); die Theologie (Hans-Georg Gradl); die Philosophie (Wilhelm Vossenkuhl); die Politikwissenschaft (Barbara Zehnpfennig). Weitere Fächer ließen sich zwanglos ergänzen: die Soziologie, die Psychologie, die Wirtschaftswissenschaften und – denkt man an Arbeiten im Bereich Law and Literature – dann kann man ohne weiteres auch die Philologien und die schönen Künste hinzunehmen.
Die in diesem Beitrag eingenommene fachliche Perspektive ist diejenige der Rechtswissenschaft, genauer die des Völkerrechts und des vergleichenden Verfassungsrechts. Es geht um die Bedeutung des Rechts in der modernen internationalen Ordnung und seine Rolle bei der Organisation einer verbindlich ausgeübten öffentlichen Gewalt, innerstaatlich, aber auch grenzüberschreitend und international. Außerdem wird das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften einbezogen, ein Feld, in dem sich besondere Fragen der Legitimation von Recht stellen: Wie weit reicht die Autonomie von Religionsgemeinschaften bei der eigenen Rechtssetzung und wo setzt das staatliche Recht Grenzen? Das kirchliche Arbeitsrecht mit seinen besonderen Loyalitätsanforderungen und damit einhergehend besonderen Kündigungsmöglichkeiten liefert dafür anschauliche Beispiele. Gerade wegen der interdisziplinären Breite des Themas sind zunächst einige begriffliche Vorüberlegungen notwendig, aus denen sich die juristische Perspektive dieses Beitrags auf das Thema ergibt.
Begriffliche Vorüberlegungen
Um einen eigenen rechtswissenschaftlichen Zugriff auf die Frage nach der Legitimation von Recht zu gewinnen, bedarf es zunächst einer Auseinandersetzung mit den verwendeten Begriffen. Das gilt sowohl für das Verhältnis von Recht und Gesetz, als auch für die Zuordnung der Kategorien Gesellschaft, Religion und Staat (oder allgemeiner: öffentliche Gewalt).
Gesetzgebung vs. Rechtserzeugung
Im Untertitel der Tagung wird die Legitimationsfrage auf „Gesetzgebung” bezogen. Man kann – das beweist der Titel des Vortrags von Jan Assmann – in unterschiedlicher disziplinärer Perspektive unterschiedliche Vorstellungen vom „Gesetz” haben. Die Bandbreite reicht bis in die Naturwissenschaften und die Mathematik. Als Juristinnen und Juristen, zumal, wenn unser Hintergrund im öffentlichen Recht liegt, denken wir bei „Gesetz” zuerst an das Parlamentsgesetz, also an das im förmlichen parlamentarischen Verfahren mit dem Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit beschlossene Gesetz. In der Breite all dessen, „was Recht ist”, handelt es sich beim Parlamentsgesetz aber nur um einen kleinen Teilausschnitt. Daneben gibt es zahlreiche andere Formen von Recht: Beispielhaft erwähnen lassen sich Verträge zwischen Privaten (auch der Mietvertrag oder der Arbeitsvertrag sind „Recht”), Verwaltungsakte (z. B. eine Baugenehmigung oder ein Einbürgerungsbescheid) oder Satzungen als Binnenrecht von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Universitäten, Gemeinden). Im Völkerrecht spielt das Gewohnheitsrecht (beruhend auf einer von einer allgemeinen Rechtsüberzeugung getragenen Staatenpraxis) eine große Rolle. Und nicht zuletzt sind auch Gerichtsurteile in diesem weit verstandenen Sinn „Recht”.
Es ist offensichtlich, dass die Legitimationsfrage für diese sehr unterschiedlichen Formen von Recht nicht einheitlich beantwortet werden kann. Während sich vertraglich erzeugte Rechtsbindungen zumeist über das Konsensprinzip, also die Zustimmung der Vertragsparteien, legitimieren lassen, gibt es gerade in hierarchischen Verhältnissen ein gesteigertes Legitimationsbedürfnis. Und selbst dort bestehen Unterschiede, etwa zwischen der privatrechtlichen Weisungsbefugnis des Arbeitgebers im Arbeitsverhältnis und der öffentlich-rechtlichen Anordnung eines Polizeivollzugsbeamten, einen bestimmten Platz zu räumen. Die nachfolgenden Überlegungen beziehen sich ausschließlich auf Rechtsbeziehungen, die dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind, mithin auf Rechtsbeziehungen, in denen es um die Ausübung von Hoheitsgewalt geht. Das hier zugrunde gelegte Verständnis von Recht geht also über den – jedenfalls aus rechtswissenschaftlicher Sicht – engeren Gesetzesbegriff hinaus, umfasst aber nicht „alles, was Recht ist”, sondern nur diejenige Teile des Rechts, die sich auf die Ausübung von Hoheitsgewalt beziehen, etwa, indem sie selbst Ausdruck der Ausübung von Hoheitsgewalt sind oder indem sie dazu dienen, Hoheitsgewalt rechtlich zu begrenzen.
Gesellschaft – Religion – Staat – Hoheitsgewalt
Eine zweite begriffliche Vorbemerkung betrifft die Kategorien Gesellschaft, Religion, Staat und Hoheitsgewalt. Es ist offensichtlich, dass je nach fachlicher Perspektive und konkreter Fragestellung unterschiedliche Begriffsverständnisse und Zuordnungen erfolgen. Die Religionssoziologie verfolgt andere Erkenntnisinteressen als die Staatstheorie und aus theologischer, philosophischer oder politikwissenschaftlicher Perspektive mögen sich wieder andere Zuordnungen als sinnvoll und nützlich erweisen. Deshalb kann es hier nicht darum gehen, eine „richtige” Zuordnung vorzunehmen und andere Zuordnungen als „falsch” zu verwerfen.
Wichtig ist aber, die Prämissen der eigenen Perspektive offenzulegen, um Missverständnisse zu vermeiden. Schon bei der Konkretisierung von „Recht” wurde eine Konkretisierung auf die Ausübung und Begrenzung von Hoheitsgewalt vorgenommen. Es geht also um Normen, mit denen eine Gesellschaft Grundregeln des Zusammenlebens mit dem Anspruch der Verbindlichkeit und der gegebenenfalls auch zwangsweisen Durchsetzung festlegt. Diese Form der Hoheitsgewalt war über lange Zeit im Staat konzentriert, wird aber zunehmend auch durch mehrere Staaten gemeinsam über von ihnen gegründete internationale Organisationen ausgeübt. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich die Europäische Union. Deshalb ist es sinnvoll, nicht nur vom Staat und von staatlicher Gewalt, sondern allgemeiner von der Ausübung von Hoheitsgewalt zu sprechen.
Der damit verbundene Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit lässt sich nur einlösen, wenn er alle Teile der Gesellschaft in gleicher Weise erfasst. Das macht es notwendig, Religion nicht als eigene Kategorie neben der Gesellschaft zu verstehen (in diese Richtung könnte man den Untertitel der Tagung deuten), sondern sie in einen weit verstandenen Begriff von Gesellschaft zu integrieren. Zugespitzt formuliert: Der Gehorsamsanspruch der öffentlichen Hoheitsgewalt gilt auch gegenüber Religion und Religionsgemeinschaften. Dahinter steht mit der Säkularisierung der öffentlichen Gewalt eine jedenfalls für Europa zentrale historische Entwicklung, die sich als Grundbedingung demokratischer Herrschaftslegitimation verstehen lässt.
Säkularisierung der öffentlichen Gewalt als Grundbedingung demokratischer Herrschaftslegitimation
Ernst-Wolfgang Böckenförde hat die Entstehung des Staates als einen Prozess der Säkularisierung beschrieben, in dem sich die politische Ordnung nach und nach von ihrer religiösen Durchformung ablöst. Dieser Prozess ist nicht nur für die Legitimation der öffentlichen Gewalt prägend, sondern auch für das Verhältnis der öffentlichen Gewalt zum Thema Religion. Anstelle des stark vom Gedanken einer institutionellen Zuordnung zweier öffentlicher Gewalten geprägten „Staatskirchenrechts” wird zunehmend der Begriff „Religionsverfassungsrecht” verwendet. Dieser Begriff passt nicht nur wegen der Pluralisierung der religiösen Überzeugungen in Deutschland besser in das geänderte religiöse Umfeld (seit kurzem gehören weniger als 50% der deutschen Bevölkerung einer der beiden christlichen Kirchen an), sondern mit der dahinter stehenden Konzeption lässt sich auch die Einbettung der organisatorischen Dimension von Religion in die allgemeine Grundrechtsdogmatik besser verarbeiten.
Das hat vor allem Rückwirkungen auf das Verständnis des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften, das einerseits grundrechtlich geschützt wird und damit staatlichen Eingriffen entgegensteht, andererseits aber auch bei der Kollision mit entgegenstehenden Individualgrundrechten dem auch sonst in solchen Fällen üblichen Abwägungsprozess unterliegt. Dass hier unterschiedliche Gewichtungen möglich sind, zeigt das kirchliche Individualarbeitsrecht, zu dem derzeit zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht unterschiedliche Positionen vertreten werden. Wie diese Auseinandersetzung ausgeht, wird maßgeblich von einer im Fall „Egenberger” noch anhängigen Verfassungsbeschwerde abhängen (das Verfahren ist im Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts unter dem Aktenzeichen 2 BvR 934/19 anhängig).
Dabei geht es auch um die Frage, wie intensiv die staatlichen Gerichte bei der Abwägung vom eigenen Selbstverständnis geprägte Entscheidungen religiöser Arbeitgeber überprüfen dürfen. Der EuGH fordert hier eine intensivere Kontrolle. Für das Bundesverfassungsgericht führt das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften dagegen auch zu einer Zurücknahme des Kontrollumfangs. Unabhängig von dieser unterschiedlichen Gewichtung des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften steht für beide Gerichte aber außer Zweifel, dass das Selbstbestimmungsrecht innerhalb des vom säkularen Recht gezogenen Rahmens wahrgenommen wird. Der EuGH würde diesen Rahmen enger, das Bundesverfassungsgericht würde ihn weiter ziehen. An seiner Verbindlichkeit auch für Religionsgemeinschaften lassen beide Gerichte aber zu Recht keinen Zweifel.
Um Missverständnisse über den Begriff der Säkularisierung zu vermeiden, ist der Bezugspunkt nochmals hervorzuheben: Gemeint ist keine Säkularisierung der Gesellschaft insgesamt, in dem Sinne, dass Religion in allen Lebensbereichen allgemein an Bedeutung verlöre. Während eine solche gesamtgesellschaftliche Säkularisierung in den Sozialwissenschaften mit guten Gründen bestritten wird, kommt es für die hier eingenommene verfassungsrechtliche Perspektive allein auf Säkularität der öffentlichen Gewalt an. Diese lässt sich in der modernen, religiös pluralen Demokratie allein mit säkularen Gründen, d.h. als „Staat ohne Gott” (Horst Dreier) oder in der hier verwendeten, erweiterten Terminologie als „Öffentliche Gewalt ohne Gott” legitimieren.
Die Verfassungsfunktionen und ihre Bündelung im modernen Verfassungsstaat
In rechtlicher Hinsicht hat sich die Verfassung als zentrales Instrument der Herrschaftslegitimation herausgebildet. Bis heute wird sie überwiegend staatsbezogen gedacht, d.h. im Akt der Verfassunggebung konstituiert sich die öffentliche Gewalt eines Staates und wird fortan nach den in der Verfassung niedergelegten Kriterien ausgeübt. In der Verfassung als (zumeist schriftlichem) Dokument bündeln sich damit eine Reihe von Funktionen, die für die Legitimation von Herrschaft zentral sind: Mit der Konstituierung einer eigenständigen öffentlichen Gewalt wirkt die Verfassung herrschaftsbegründend (Begründungsfunktion), mit der Schaffung von Organen und der Regelung ihrer Interaktion bestimmt die Verfassung die Ausübung der Herrschaft (Organisationsfunktion); und moderne Verfassungen enthalten zudem mit rechtsstaatlichen Anforderungen und der ausdrücklichen Verankerung von Grundrechtskatalogen, sowie der gerichtlichen Durchsetzbarkeit dieser Begrenzungen zugleich wichtige Schranken für die Herrschaftsausübung (Begrenzungsfunktion).
Verfassungen leisten außerdem – auch darin liegt ein wesentlicher Beitrag zur Legitimation der Ausübung von Herrschaft – eine Kopplung von Recht und Politik, indem sie einerseits bestimmte Fragen auf der Ebene der Verfassung verbindlich entscheiden und damit dem normalen politischen Prozess entziehen (und den gesteigerten Anforderungen an eine Verfassungsänderung unterwerfen), andererseits aber jenseits dieser Bereiche Freiräume für politische Entscheidung belassen, in denen das Ergebnis gerade nicht rechtlich von vorne herrein festgelegt ist.
Die Besonderheit des modernen Verfassungsstaates wie er sich vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in Westeuropa und Nordamerika (und nach und nach auch in anderen Teilen der Welt) herausgebildet hat, besteht darin, dass diese Funktionen sämtlich in einer politischen Einheit (dem Staat) und mittels eines einzigen rechtlichen Dokuments (der Verfassung) gebündelt wurden. Nicht wenige der aktuellen Herausforderungen, die wir bei der Legitimation von öffentlicher Gewalt erleben, lassen sich darauf zurückführen, dass diese Bündelung in der modernen Welt nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Das sei im Folgenden näher erläutert.
Aktuelle Herausforderungen der Legitimation I: Europäisierung und Internationalisierung politischer Entscheidungen
Die gerade beschriebene Legitimationsstruktur beruht auf der Konzentration der Hoheitsgewalt im Staat. Dies entspricht aber seit längerem nicht mehr den realen Verhältnissen. Vor allem durch die Europäische Integration, aber darüber hinaus auch ganz generell durch den Ausbau der Zusammenarbeit in internationalen Organisationen mit eigenen Entscheidungsbefugnissen wird diese Monopolstellung des Staates aber in Frage gestellt. Die Europäische Union besitzt die Befugnis zur Rechtssetzung (Sekundärrecht), im Falle der Verordnungen sogar mit unmittelbarer Wirksamkeit und Verbindlichkeit für natürliche und juristische Personen in den Mitgliedstaaten.
Da es nur noch ganz wenige Sachbereiche gibt, in denen Entscheidungen in der EU nur einstimmig getroffen werden können, besteht in den meisten Fällen keine Vetoposition eines einzelnen Mitgliedstaates, d.h. ein europäischer Rechtsakt wird auch dann in dem und für den Mitgliedstaat verbindlich, wenn seine Regierung gegen ihn gestimmt hat. In solchen Fällen wird die Legitimation über innerstaatliche Legitimations- und Verantwortlichkeitsketten problematisch.
Neben diese Wirkungen, die durch verbindliche rechtliche Strukturen bewirkt werden (Abstimmung mit Mehrheit in Verbindung mit dem so erlassenen verbindlichen Sekundärrechtsakt) treten informelle Wirkungen, bei denen zwar formal die Möglichkeit besteht, die Verabschiedung von verbindlichem Recht zu verhindern, aber der politische Druck hin zu einer gemeinsamen Lösung so groß ist, dass die formale Vetoposition faktisch und politisch keine ernsthafte Option ist.
In diesen Fällen liegt zwar möglicherweise am Ende formal eine Zustimmung vor, unter Legitimationsgesichtspunkten bleibt deren Wirkung aber eher schwach, weil sie vor allem auf äußeren Sachzwängen beruht, aber nur sehr begrenzt als autonome Entscheidung qualifiziert werden kann. Derartige Zwänge bestehen nicht nur für kleine und politisch weniger einflussreiche Staaten, sondern auch politisch mächtige Staaten können sich ihnen immer wieder nicht entziehen. Unter solchen Bedingungen wird eine alleinige Legitimation über die Rückbindung der Entscheidungen an die einzelnen Staaten und über deren Zustimmung zur eigenen Bindung brüchig.
Aus diesem Grund betont das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen zur europäischen Integration die duale Legitimation der Europäischen Union und der von ihr getroffenen Entscheidungen. Neben die Rückbindung an die Mitgliedstaaten über deren Zustimmung zu den Verträgen als primärrechtlicher Grundlage der Union und die – zumindest mehrheitliche – Zustimmung zu den einzelnen Sekundärrechtsakten tritt eine eigene demokratische Legitimation der Union selbst, die sich aus den direkten Wahlen zum Europäischen Parlament (Art. 14 Abs. 3 EUV) und dessen gewachsener Rolle bei der Rechtssetzung (Art. 294 AEUV) ergibt.
Allerdings gibt es solche eigenständigen parlamentarischen Organe jenseits der staatlichen Ebene bislang nur in vergleichsweise wenigen internationalen Organisationen und oft sind dann die diesen Organen eingeräumten Kompetenzen relativ schwach ausgestaltet. So gibt es in den Vereinten Nationen gar kein parlamentarisches Organ und der parlamentarischen Versammlung des Europarats kommt überwiegend eine beratende Rolle zu, auch wenn es ihr im Laufe der Zeit durchaus gelungen ist, ihre Kompetenzen nach und nach etwas auszubauen und zu stärken.
Vor diesem allgemeinen Hintergrund der parlamentarischen Legitimation in internationalen Organisationen, aber auch speziell mit Blick auf verbindliche Mehrheitsentscheidungen in der EU, stellt sich die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, die Zustimmung durch andere Staaten und deren demokratische Rückbindung in die Legitimationsüberlegungen einzubeziehen. Das allerdings wirft die noch weitergehende Frage nach dem Personenverband auf, der hinter einer politischen Einheit steht.
In der traditionellen Konzeption des Staates ist diese Frage vermeintlich einfach beantwortet. Es ist das Staatsvolk, das über die Verfassung eine Gewalt verfasst, die es zu hoheitlichen, d.h. für alle verbindlichen Entscheidungen ermächtigt. „Das Staatsvolk” – so hat es das Bundesverfassungsgericht in einem Leitsatz zu seiner 1990 ergangenen Entscheidung zum Ausländerwahlrecht in Schleswig-Holstein formuliert, „von dem die Staatsgewalt in der Bundesrepublik Deutschland ausgeht, wird nach dem Grundgesetz von den Deutschen, also den deutschen Staatsangehörigen und den ihnen nach Art. 116 Abs. 1 gleichgestellten Personen, gebildet.” Hinter dieser Formulierung steht eine sehr klare Vorstellung von einem Demos, dem deutschen Volk, von dem sich demokratisch die Ausübung einer bestimmten Hoheitsgewalt, der deutschen Staatsgewalt, ableiten lässt.
Aber auch dieser Legitimationszusammenhang – die enge Verknüpfung von Staatsgewalt und Staatsvolk – gerät zunehmend unter Druck, wie sich an den aktuellen Wanderungsbewegungen und deren Auswirkungen auf die langfristige Zusammensetzung der Bevölkerung zeigen lässt.
Aktuelle Herausforderungen der Legitimation II: Wanderungsbewegungen
Über die Frage, ob Deutschland ein Einwanderungsland sei, ist lange politisch vehement gestritten worden. Der Streit war und ist nur sinnvoll, wenn sich aus der Qualifizierung konkrete Folgerungen in rechtlicher oder politischer Hinsicht ergäben. Das ist allerdings nicht der Fall. Blickt man dagegen auf die Bevölkerungsstatistik, so lässt sich nicht ernsthaft bestreiten, dass massive Veränderungen stattgefunden haben. Mit Stand 31.12.2021 betrug der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung 13,1%. Davon leben knapp über 50% seit mehr als 8 Jahren in Deutschland, 24,8% sogar seit mehr als 25 Jahren. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 15,6 Jahre. Diese Zahlen sprechen für einen zumindest langfristigen, wenn nicht sogar dauerhaften Aufenthalt im Inland.
Die Bevölkerungsstatistik versucht diese demographischen Veränderungen durch die Kategorie „Migrationshintergrund” sichtbar zu machen. Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, „wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.“ Der Kreis ist damit deutlich weiter als der Ausländeranteil und bezieht eine Migrationserfahrung in der Generation der Eltern ein und erfasst auch Personen, die aufgrund einer Einbürgerung von einer allein auf die Staatsangehörigkeit abstellenden Statistik gar nicht erfasst würden. Bei einer solchen Betrachtung wird der erfasste Personenkreis noch größer. Nach dieser Definition hatten 2019 etwa 26% der deutschen Wohnbevölkerung einen Migrationshintergrund.
Für die demokratische Legitimation von Hoheitsgewalt wird jedenfalls aus juristischer Sicht weiterhin auf die Staatsangehörigkeit abgestellt. Wahlberechtigt für den Deutschen Bundestag und bei den Landtagswahlen sind nur deutsche Staatsangehörige (z. B. § 12 Abs. 1 BWahlG). In seinen Entscheidungen zum Ausländerwahlrecht hat das Bundesverfassungsgericht diese Vorgabe auch als verfassungsrechtlich zwingend angesehen. Betrachtet man die oben wiedergegebenen Zahlen zum Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung, so zeichnet sich aber ein Legitimationsdilemma ab: Auch die längerfristig im Land lebenden Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen, obwohl sie in erheblichem Umfang der deutschen Staatsgewalt unterworfen sind.
Versuche, diesem Problem durch großzügigere Einbürgerungsregeln entgegenzuwirken haben sich als wenig erfolgreich erwiesen. Unter den Einbürgerungsberechtigten macht nur ein höchst niedriger Anteil von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die Ausschöpfung des Einbürgerungspotentials (diese Zahl beschreibt den Anteil unter den Einbürgerungsberechtigten, der sich tatsächlich einbürgern lässt) liegt in den letzten zehn Jahren durchgängig bei etwa 2,2%. Im Jahr 2020 waren es 2,15%. Auch wenn darin letztlich eine freiwillige Entscheidung gegen die Einbürgerung liegt, so stellt sich doch die Frage, ob es zugleich auch eine freiwillige Entscheidung gegen die Wahlberechtigung ist, denn letztere ist eben nur einer von mehreren Faktoren, der bei der Entscheidung für oder gegen eine Einbürgerung eine Rolle spielt.
Insgesamt spricht viel dafür, dass der Kreis der Personen, die sich längerfristig oder gar dauerhaft in Deutschland aufhalten, ohne die Staatsangehörigkeit und damit das Wahlrecht auf Bundes- und Landeseben zu besitzen, in Zukunft noch weiter zunehmen wird. Je mehr das der Fall ist, desto drängender wird das Legitimationsproblem. Schnelle und einfache Antworten hierauf werden sich kaum finden lassen. Aber gesellschaftspolitisch und rechtspolitisch spricht dies doch dafür, dem betroffenen Personenkreis zumindest alternative Mitwirkungsmöglichkeiten anzubieten. Zu denken wäre beispielsweise an die kommunale Ebene, auf der es bereits jetzt ein Ausländerwahlrecht für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger gibt. Warum sollte es nicht möglich sein, dieses auch auf andere Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit auszudehnen?
Aktuelle Herausforderungen der Legitimation III: Gefährdungen der Rechtsstaatlichkeit
Zu den von Verfassungen wahrgenommenen Funktionen gehört die Einhegung und Begrenzung politischer Macht durch Grundrechte und die Sicherung rechtsstaatlicher Grundprinzipien wie Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz und Gesetzesbindung. In dem herkömmlichen Modell einer Konzentration aller Verfassungsfunktionen im Staat wurde diese Aufgabe ausschließlich durch interne staatliche Strukturen und Institutionen, namentlich verfassungsrechtliche Garantien und deren Durchsetzung durch eine Verfassungsgerichtsbarkeit wahrgenommen.
Auch hier haben sich wichtige Änderungen ergeben. So hat insbesondere der internationale Menschenrechtsschutz dazu geführt, dass neben der staatlichen Verfassungsgerichtsbarkeit nun auch internationale Gerichte Entscheidungen treffen, die der Begrenzung politischer Macht dienen. Besonders deutlich wird dies etwa in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Anforderungen an Parteiverbote. Unabhängig von Unterschieden in der konkreten Ausgestaltung des Parteienrechts in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EMRK handelt es sich bei Parteien immer auch um Vereinigungen im Sinne der Vereinigungsfreiheit nach Art. 11 EMRK.
Dementsprechend fallen Verbote von Parteien in den Anwendungsbereich der Konvention und der Gerichtshof hat inzwischen eine recht detaillierte Rechtsprechung zu dieser Frage entwickelt, die auch im letzten deutschen Parteiverbotsverfahren gegen die NPD eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat. Hätte das Bundesverfassungsgericht die NPD verboten, dann wäre diese Verbotsentscheidung mit Sicherheit von der NPD vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als Verstoß gegen das Recht auf Vereinigungsfreiheit unter der EMRK gerügt worden. Das heißt selbstverständlich nicht, dass eine solche Rüge erfolgreich gewesen wäre, aber das Beispiel zeigt, wie weit der internationale Menschenrechtsschutz in den innerstaatlichen politischen Bereich hineinragen kann.
Die Wirkungen dieser Verzahnung von internationalem Menschenrechtsschutz und innerstaatlicher Politik sind ambivalent: Einerseits ist offensichtlich, dass eine zusätzliche Kontrolle von außen ein Mehr an Unabhängigkeit bringt und damit vor allem bei autoritären innerstaatlichen Entwicklungen Möglichkeiten schafft oder behält, die unter Umständen innerstaatlich schon beseitigt worden sind. Die aktuellen Fälle zur Inhaftierung von Journalistinnen und Journalisten und Oppositionellen etwa in der Türkei oder in Russland liefern hierfür breites Anschauungsmaterial.
Andererseits macht die quasi-verfassungsgerichtliche Rolle, in die ein Gericht wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte damit gebracht wird, ihn zugleich zu einem politischen Akteur auf der internationalen und – zumindest ein Stück weit – auch auf der innerstaatlichen Ebene. Das wirft dann die Frage nach der Legitimation des Gerichts gegenüber dem – unter Umständen ja sogar von breiten Mehrheiten getragenen – innerstaatlichen politischen Prozess auf. Dieses Problem stellt sich derzeit etwa in Polen, wenn die dort seit 2017 von Regierung und Parlament auf den Weg gebrachte – rechtsstaatlich hochproblematische – Justizreform nach und nach anhand einzelner Fälle vor allem unter Art. 6 EMRK im Wege der Individualbeschwerde vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht wird.
Hier kann man einerseits auf klare Worte zur Bedeutung der Unabhängigkeit der Justiz hoffen, andererseits wird die Regierung diesen mit Sicherheit die demokratische Legitimation der von ihrer initiierten Reform entgegenhalten.
Eine ähnliche Entwicklung gibt es beim Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg, der mit dem gleichen Problem konfrontiert ist, wenn auch unter etwas anderen prozessualen Voraussetzungen. Für die EU ist die Unabhängigkeit der Justiz in den Mitgliedstaaten von essentieller Bedeutung, weil die mitgliedstaatliche Justiz zentraler Bestandteil der institutionellen Struktur zur Anwendung und Durchsetzung des Unionsrechts bildet. Weite Teile des europaweit gültigen Unionsrechts sind unmittelbar innerstaatlich anwendbar. Dementsprechend sind zunächst und vor allem die dortigen Behörden und Gerichte zur Anwendung des Unionsrechts berufen.
Bei Zweifeln über seine Auslegung gibt es ein Vorlageverfahren zum Europäischen Gerichtshof (Art. 267 AEUV). Die mitgliedstaatliche Gerichtsbarkeit ist damit Teil des Rechtsschutzes in der EU. Dementsprechend erstrecken sich unionsrechtliche Anforderungen aus dem Rechtsstaatsprinzip auch auf die mitgliedstaatliche Gerichtsbarkeit. Der Gerichtshof hat in zwei Grundsatzentscheidungen festgestellt, dass Teile der polnischen Justizreform mit den Vorgaben zur Rechtsstaatlichkeit aus Art. 2 EUV unvereinbar sind und teilweise auch Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung dieser Entscheidungen angeordnet.
Fazit
Die Beispiele zeigen, in welchem Umfang inzwischen die Begrenzungsfunktion von Verfassungen auf europäischer Ebene ergänzt und ausgebaut wird. Institutionalisiert ausgeübt wird diese Begrenzungsfunktion durch die beiden europäischen Gerichtshöfe, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der anhand der EMRK entscheidet, und den Gerichtshof der Europäischen Union, für den das Recht der Europäischen Union maßgeblich ist. Beide Gerichte entscheiden letztlich anhand gemeineuropäischer Maßstäbe der Rechtsstaatlichkeit. Wenn dem von der polnischen Regierung die innerstaatliche demokratische Legitimation der Justizreform entgegengehalten wird, so liegt darin der Versuch, die Demokratie gegen den Rechtsstaat auszuspielen.
Genau das muss aber vermieden werden, wenn die drei im Titel genannten zentralen Funktionen von Recht (Herrschaftsbegründung, Herrschaftsausübung und Machtbegrenzung) in einem angemessenen Gleichgewicht gehalten werden sollen. Der vorliegende Beitrag hat gezeigt, dass die Bedingungen für die Herstellung eines solchen Gleichgewichts nicht leichter geworden sind. Genau daraus ergibt sich eine wachsende Bedeutung des (europäischen und internationalen) öffentlichen Rechts. Die kontinuierliche Arbeit an diesem Gleichgewicht ist seine Kernaufgabe.