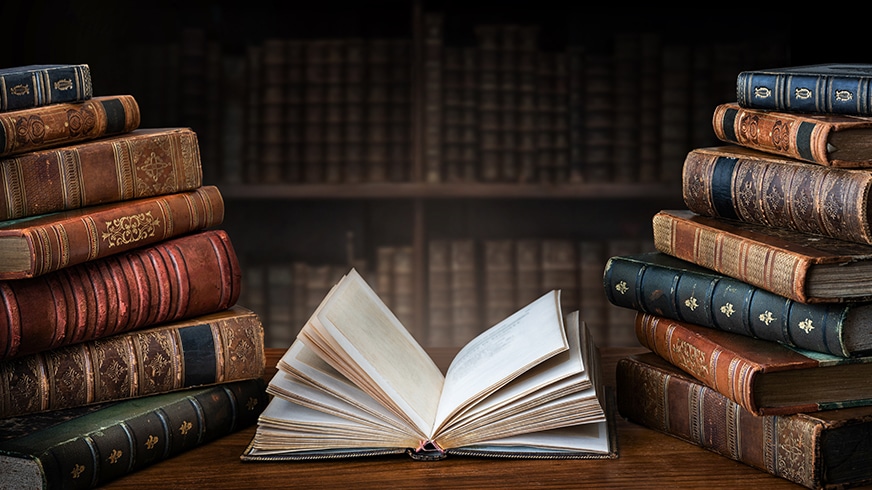„Über Geld spricht man nicht, Geld hat man“ – ist ein gängiges Sprichwort, das man im Hinblick auf das adelige Repräsentationsbedürfnis ergänzen könnte „und vor allem zeigt man, dass man es hat“. Mit adeligem Lebensstil verbindet man landläufig weniger Sparsamkeit und maßvolles Haushalten als großzügiges und generöses Auftreten: Spielen und Jagen, edle Rösser und luxuriöse Kutschen, sich Kleiden in Samt und Seide und prestigeträchtige Schlossbauten kennzeichnen diesem Klischee zufolge den adeligen Habitus.
Lassen Sie mich im Folgenden in aller Kürze skizzieren, woraus sich im Allgemeinen die Einnahmen des bayerischen Landadels zusammensetzten und an einem Beispiel demonstrieren, wie ein bayerischer Landadeliger am Ende des Alten Reichs konkret wirtschaftete. Denn: Trotz eines gemeinsamen Wertekodexes und der gesamteuropäischen Prägung des Adels differierten die wirtschaftlichen Spielräume der adeligen Ökonomien beträchtlich. Die Verpflichtung zur Repräsentation und des Zurschaustellens der elitären Stellung brachte so manchen adeligen Haushalt in erhebliche finanzielle Schieflagen.
Insbesondere jene adeligen Ökonomien, deren finanzielles Budget aufgrund geringer feudaler Renten überschaubar war, hatten, wenn sie nicht „auf die Gant“ kommen wollten, einen gewissen Zwang zur ökonomischen Effizienz und zur Sparsamkeit. Auch wenn dies eindeutig bürgerliche Tugenden waren, musste insbesondere der niedere Adel den wirtschaftlichen Spagat zwischen geforderter Luxusdemonstration und einem verantwortungsvollen Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen vollziehen.
Das Finanzgebaren des bayerischen Adels fristete als Gegenstand der Forschung bis vor einigen Jahrzehnten eher ein Mauerblümchendasein. Lange prägte die These des österreichischen Historikers Otto Brunner vom „Ganzen Haus“ den wissenschaftlichen Diskurs zu den wirtschaftlichen Verhältnissen landadeliger Güter. Zu stark wirkte das theoretische Konzept der normativen Quellengattung der Hausväterliteratur und der Mythos des gänzlich vom Markt abgeschotteten, subsistenzwirtschaftlich orientierten landadeligen oikos.
Die Untersuchungen zur wirtschaftlichen Situation des bayerischen Adels in der Frühen Neuzeit sind nicht eben Legion: Verdient gemacht haben sich auf diesem Forschungsfeld Historiker wie Walter Demel, Rudolf Endres, Enno Bünz, Kurt Andermann oder Maximilian Lanzinner. Detailstudien – wie etwa von Margit Ksoll-Marcon, Wolf-Dieter Peter oder Beate Spiegel – eröffnen den Blick auf einzelne Adelsgeschlechter.
Der Grund für die Zurückhaltung ist vermutlich die schwierige Quellensituation, denn anders als die Rechnungslegungen der Städte, Märkte oder Klöster handelt es sich bei privaten Rechnungs- und Ausgabenbüchern kleinerer Landadeliger eher um Schuhschachtelarchivalien, die wohl in den meisten Fällen nicht archivierungsbedürftig angesehen wurden und die Zeit nicht überdauerten. Es steht jedoch zu vermuten, dass die schriftliche Fixierung der Einnahmen und Ausgaben beim Landadel keine Seltenheit war. Auch im bäuerlichen Bereich werden seit einigen Jahrzehnte Anschreibebücher systematisch gesammelt und analysiert. Dies legt nahe, dass es sich bei der Notierungspraxis von privaten Wirtschaftsdaten nicht um ein singuläres Phänomen gehandelt hat.
Zum Einnahmeprofil des bayerischen Landadels
Lassen Sie mich mit einem eben genannten Klassiker beginnen, den Otto Brunner als Grundlage seiner Überlegungen zum europäischen Adelsethos verwendete, dem 1682 erstmals in Nürnberg erschienenen Werk Georgica curiosa, das ist Adeliges Land- und Feldleben. Der Autor Wolf Helmhard von Hohberg stellt lapidar fest: „Die Beschaffenheit des auf dem Lande wohnenden Adels ist nicht einerley. Etliche haben nur geringe Wohnung und wenige Unterthanen in dem Dorf, darinn sie wohnen und müssen sich, so gut sie können, damit behelfen, sich strekken nach der Decken, biegen und schmiegen, den Mantel nach dem Wetter kehren und die Ausgaben nach dem Einkommen richten.“
Die bayerische Adelslandschaft war durch eine vielschichtige Binnendifferenzierung gekennzeichnet und so war auch der finanzielle Spielraum des Adels weitgespannt und facettenreich. Insbesondere der Finanzrahmen von Adeligen mit nur einer Hofmark und daher wenigen Hoffüßen war eng und verursachte oftmals eine prekäre finanzielle Situation, die striktes Maßhalten erforderte.
Woraus setzten sich nun beim bayerischen Landadel in der Regel seine Einnahmen zusammen? Eine bürgerliche Betätigung als Kaufmann oder Händler war von vornherein als nicht standesgemäß ausgeschlossen und hätten den Verlust der Adelsqualität nach sich gezogen. Neben den weiteren Möglichkeiten des adeligen Gelderwerbs – zu denken wäre beispielsweise an Erlöse aus Ziegeleien, Brauhäusern, Vieh- bzw. Lederverkäufen oder aus Einnahmen, die sich aus Waldbesitz oder Bergwerken ergaben – spielte das „Gehalt“, das Adelige aus Ämtern und Titeln bezogen, oftmals eine wichtige Rolle im Gesamtbudget.
Der Dienst bei Hofe war zwar einerseits wegen der Karrierechancen, der sozialen Netzwerke und der Reputation hin interessant, war aber aufgrund des Kostenaufwands, den das Stadthaus und das Leben in der Residenzstadt mit sich brachte unter dem Strich nicht unbedingt profitabel. Dennoch strebten seit den häufigen adeligen Konkursen im 16. Jahrhundert und nach der wirtschaftlichen Depression im Gefolge des 30jährigen Kriegs vermehrt Adelige nach akademischen Abschlüssen, um sich für den Hofdienst zu qualifizieren. Wie der Landesherr auf diese Adelskrise mit regulierenden Mandaten reagierte, die den Ausverkauf der adeligen Hofmarken stoppen sollten und wie man die adeligen Fideikommisse förderte, hat Reinhard Heydenreuther aufgezeigt. Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten vor allem für nachgeborene Adelssöhne boten Kirche, Diplomatie und das Militär.
Gewerbevermögen, also der Besitz von wirtschaftlichen Unternehmen bzw. Manufakturen und die daraus resultierenden Erlöse sind bei der Mehrheit des bayerischen Adels im Alten Reich zu vernachlässigende Größen, waren doch Handel und Gewerbe beim süddeutschen Adel grundsätzlich verpönt und galten als nicht standesgemäß, sondern als dezidiert „bürgerliche Nahrung“. Soziales Prestige war weder durch größere Summen an Bargeld noch durch spekulative Geschäfte oder Manufakturgründungen zu erreichen.
„Der bayerische Adel definierte sich als Herrschaftsstand zunächst über seine Herrschaft über Land und Leute und so war der Grundbesitz die Hauptbasis adeligen Wirtschaftens. Selbst wenn man diese Formulierung vielleicht etwas überspitzt findet, bleibt die Feststellung richtig, dass der altbayerische Adel in erster Linie ein Rentenadel war.“ Diese Feststellung Walter Demels gibt stark verkürzt den Tenor der Forschungsmeinung hinsichtlich adeliger Einnahmequellen wieder. Die Einnahmen und Erlöse, die aus der landwirtschaftlichen Eigenproduktion flossen, werden in der Literatur als marginal eingeschätzt.
Der bayerische Landadel – dies lässt sich generalisierend sagen – war daher weniger auf einen Ausbau der Eigenwirtschaft ausgerichtet, sondern setzte verstärkt auf den Bezug grundherrlicher Renteneinnahmen und Gefällen, die aus der Gerichtsherrschaft resultierten. Die Mittel, die den adeligen Haushalten hierbei zur Verfügung standen, waren von der Anzahl der Hofmarken und der wirtschaftlichen Potenz der darin lebenden Untertanen abhängig. Spekulationsgeschäfte mit den Getreideabgaben der bäuerlichen Hintersassen konnten vor allem jene Adelsfamilien tätigen, die mehrere Hofmarken besaßen. Diese Adeligen waren somit aktiv am lokalen, regionalen und teilweise auch überregionalen Marktgeschehen eingebunden und verweisen den in der Hausväterliteratur entworfenen autarken und vom Markt unabhängigen Adelshaushalt in den Bereich der Theorie.
Ein Umstand, der der These des marktunabhängigen landadeligen oikos widerspricht. Margit Ksoll etwa hat für die Toerring und Haslang gezeigt, dass im 17. Jahrhundert zwischen 5 bis 30 Prozent der Gesamteinnahmen durch diese Getreideverkäufe anfielen. Der Großteil der Landadeligen jedoch konsumierte den Löwenanteil der jährlich fälligen Naturalabgaben der Untertanen in ihrem eigenen Haushalt und erzielten daher mit etwaigen Verkäufen kaum nennenswerten Erträge.
Die Ausgabenbücher Sebastian von Pemlers
Ich möchte Ihnen nun im Folgenden anhand des konkreten Beispiels Freiherrn von Pemler die finanzielle Situation bayerischen Landadeligen im 18. Jahrhundert vorstellen. Die Familie des Freiherrn von Pemler, der zwischen 1718 bis 1772 lebte, ist ein klassischer Vertreter des im 16. und 17. Jahrhundert aus dem bürgerlichen Milieu emporkommenden Dienstadels, dem stets der Makel des weniger vornehmen Adels anhing. Die Qualifikation durch ein Studium prädestinierte diese Familien für verschiedene Ämter wie etwa Landrichterstellen oder Posten am kurfürstlichen Hof.
Mit dem Ankauf der Hofmark Leutstetten, einer der im 18. Jahrhundert ungefähr 1.400 existierenden Hofmarken und Sitze, konnten auch die Pemler Herrschaftsrechte im Kurfürstentum Bayern ausüben. Günstige Heiratsverbindungen taten ein weiteres: Seit 1681 saßen die Pemler, die 1682 in den Freiherrnstand erhoben wurden, auf der Hofmark Hurlach an der westlichen Grenze des Kurfürstentums. Die Hofmark Hurlach war der Stammsitz, Lebensmittelpunkt und die ökonomische Basis der Familie bis Sebastian von Pemler. Der Freiherr erbte nach dem Tod seines kinderlosen Onkels 1760 mit Leutstetten eine weitere Hofmark dazu.
Das ebenfalls in der Erbmasse des Onkels enthaltene Stadthaus in München wurde von Pemler in seinem Hochzeitsjahr, 1763, veräußert, um ohne Schulden die außerordentlichen Ausgaben zu bewältigen. Die Freiherren von Pemler gehörten zu der großen Gruppe Landadeliger, die lediglich im Besitz einer oder zwei Hofmarken waren.
Diesen Landadeligen standen Adelsgeschlechter gegenüber, die zwanzig und mehr Hofmarken besaßen. Margit Ksoll untersuchte anhand der Landtafeln von 1736/37 die Grundbesitzverteilung des bayerischen Adels und kam zu folgender prozentualer Verteilung: „30,4% der landsässigen Adelsgeschlechter hatten nur ein in die Landtafel eingetragenes Landgut. 18,9% hatten zwei, 11,5% vier, 9,5% fünf, 3,9% sechs, 4,3% sieben, 2,4% acht, 1,2% neun, 0,8% hatten 10, 13, 17, 18, 19, 32 und 40 Hofmarken und Sitze.“ Spitzenreiter hinsichtlich dieser Skala waren die Toerrings mit 40 Hofmarken, ihnen folgten die Nothafft mit 32, die Preysing mit 21, die Gumppenberg mit 21, die Seyboltsdorf und Closen mit 20 und die Tattenbach mit 18 Hofmarken und Sitzen. Bei den genannten Familien handelt es sich ausnahmslos um edelmannsfreie Geschlechter, also um adeliges Urgestein. Während der alte Adel 89 Prozent aller adeligen Hofmarken in Besitz hatte, verblieb dem neuen Adel in der Regel Klein- und Kleinstbesitz.
Das wichtigste wirtschaftliche Standbein des Freiherrn von Pemler, der sich vergeblich um ein Hofamt mühte und erst durch den Ankauf des Kammerherrnschlüssel als Titel ohne Mittel den ersehnten Hofzugang erhielt, waren die feudalen Renten: Mit rund 30 vor allem kleinbäuerlichen Anwesen der Hofmark Hurlach und 19 Anwesen der Hofmark Leutstetten zählte Freiherr von Pemler zu der am häufigsten in Altbayern vertretenen Gruppe von Adeligen und Rittern, die nicht mehr als zwei Hofmarken besaßen. Die feudalen Renten dieser Hofmarksherrschaften ließen in der Regel keine allzu großen finanziellen Sprünge zu.
Freiherr von Pemler war ein Mann mit Zeit und Lust am Schreiben und widmete sich voll und ganz der Haushaltsführung und der Verwaltung seiner recht überschaubaren Güter. Dies bescherte uns die umfänglichen Ausgabenbücher, in denen Pemler zwischen 1763 bis 1782 alle seine getätigten Ausgaben fein säuberlich notierte. Ergänzend zu diesem Quellenmaterial existieren für acht Jahre auch teilweise sehr detaillierte Schreibkalender des Freiherrn.
Für unseren Zweck wollen wir jedoch die Ausgabenbücher in den Blick nehmen: Insgesamt 1.232 Geschäftsvorgänge wurden allein im ersten aufgezeichneten Rechnungsjahr 1763 verzeichnet – im Schnitt also drei bis vier Ausgaben pro Tag. Jeweils am Monats- und am Jahresende erfolgte eine summarische Aufstellung aller Ausgaben. Insgesamt 9.542 Ausgabenvermerke aus der gleichen, einheitlichen Schreiberhand im Zeitraum von zehn Jahren bescheren eine große Datenfülle, die die Beschaffenheit des Haushaltswesens und das Ausgabenprofil des freiherrlichen Haushalts offenlegt.
Leider existiert im Falle Pemler kein detailliertes Einnahmeverzeichnis mehr, jedoch ein versehentlich eingetragener Einnahmeposten lässt interessante Schlüsse zu.
Im Ausgabenbuch von 1764 notierte Pemler den in diesem Jahr anfallenden Einnahmeposten von 2.854 Gulden. In den Jahren zwischen 1763 und 1772 wurden insgesamt 22.801 Gulden ausgegeben, das sind ca. 2.850 Gulden im Jahresdurchschnitt – bei einer jährlichen Einnahmesumme von ca. 2.854 Gulden eine signifikante Übereinstimmung der Einnahmen mit den Ausgaben. Lediglich das Jahr 1763 weicht von den „Normaljahren“ insofern ab, als die Hochzeit des Freiherrn eine Vielzahl von außergewöhnlichen Ausgaben, vor allem die Auszahlung der Schwester, erforderte. Das gleiche gilt für 1772, das Todesjahr des Freiherrn, das aufgrund der Beerdigungskosten, zahlreicher Stiftungen und einer längeren Auslandsreise der Witwe, die im Übrigen die Ausgabenbücher – jedoch in sehr abgespeckter Version – weiterführte, einen finanziellen Kraftakt für den Haushalt bedeutete.
Die Einnahmen des Freiherrn von Pemler setzten sich, wie dies für den bayerischen Landadel typisch ist, vor allem aus den feudalen Renten, die in Form von Getreide, vor allem aber in Form von Geldbeträgen abgegeben wurden, zusammen. Die sowieso nicht große Eigenwirtschaft wurde von Pemler sukzessive weiter reduziert, eigengenutzte Flächen zunehmend verpachtet. Der vorhandene Viehbestand wurde im eigenen Haushalt konsumiert, größere Zukäufe an Fleisch waren jedoch die Regel. Der Freiherr bezog trotz juristischer Qualifikation keinerlei Einnahmen aus Ämtern bei Hofe und im Landgericht und keine Erlöse, die einer wie auch immer gearteten wirtschaftlichen Aktivität erwachsen wären.
Über eine ähnliche Quellenbasis verfügte Beate Spiegel, die die zwischen 1733 und 1745 verfassten Hausmanuale der Tutzinger Hofmarksherrin Freifrau von Vieregg – wenn auch unter anderer Fragestellung – untersuchte. Spiegel, der es in ihrer Mikrostudie vor allem angelegen war, das Verhältnis zwischen Herrschaft und Untertanen zu analysieren, konnte nachweisen, dass auch die Freifrau maßvoll und umsichtig mit den vorhandenen Ressourcen umging, vor allem aber, dass das weitgehend reibungslose Funktionieren der adeligen, hofmärkischen Grundherrschaft auch auf den wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der Hofmarksherrin und ihren Untertanen beruhte. Wie beim Hurlacher Beispiel floss auch in der Hofmark Tutzing ein erklecklicher Teil der feudalen Erlöse aus den rund 80 Anwesen wieder in die Hofmark zurück, da Freifrau von Vieregg einen Großteil ihrer grundherrlichen Einnahmen wieder für Waren und Dienstleistungen im Dorf ausgab.
Um die vorhin genannte Einnahmesumme des Hurlacher Beispiels von 2.854 Gulden Einnahmevolumen pro Jahr nicht vollkommen isoliert dastehen zu lassen, seien zur Einordnung drei weitere Beispiele – eines für bäuerliche, eines für landadelige und eines für hochadelige Verhältnisse – kurz erwähnt werden, nämlich die jährlichen Einnahmen der Bauernfamilie Daisenberger, der Freifrau von Viereggg und der Grafen von Preysing: Das bäuerliche Anwesen der Daisenberger aus Oberau konnte in den letzten zwei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts mit Holz- und Gipsverkäufen und Vorspanndiensten einen Erlös von ca. 1.100 Gulden pro Jahr erwirtschaften. Die Hofmarksherrin von Tutzing, Freifrau von Vieregg, erwirtschaftete in Jahren zwischen 1733-45 von minimal 2.064 bis maximal 4.113 Gulden, wobei die Erlöse aus der Grundherrschaft um die 2.000 Gulden ausmachten, die noch durch Holz- und Viehverkäufe wesentlich erweitert werden konnten, ausmachten. Dies sind vergleichsweise bescheidene Summen im Vergleich zu den Gesamteinnahmen des Grafen Maximilian IV. von Preysing, die im Jahr 1730 satte 36.875 Gulden betrug, zu denen noch weitere 6.000 Gulden Besoldung aus dessen Hofämtern kamen.
Freiherr von Pemler ging sorgfältig und offenbar planvoll mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln um. Den Zwang zur ökonomischen Effizienz und das Bestreben, die Einnahmen und Ausgaben nicht zu weit auseinander klaffen zu lassen, dürfte den meisten Landadeligen vertraut gewesen sein, die anders als ihre hochadligen Standesgenossen mit ungleich geringeren finanziellen Mitteln wirtschaften und haushalten mussten. Dem größeren Einnahmevolumen des Hochadels standen jedoch auch vermehrte Ausgaben für eine standesgemäße Lebensführung in der Residenzstadt bzw. am kurfürstlichen Hof gegenüber. Im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchte jedoch auch der Landadel seine gesteigerte gesellschaftliche Stellung durch eigene Konsumregeln zu demonstrieren. Wolfgang Wüst hat unlängst auf die kulturhistorische Bedeutung der Konsumgeschichte hingewiesen.
Das Ausgabenprofil des Pemlerschen Haushalts
Die auf den ersten Blick spröde und langweilige Quellenkategorie der Rechnungsbücher kann authentische Aufschlüsse und Einsichten in das Innere eines Haushalts und einer Familie vermitteln und ist besonders geeignet, um sowohl Einblicke in die materielle Kultur eines Haushaltes zu erhalten als auch die Strukturierung des Haushalts – etwa die Anzahl und Zuständigkeiten der Haushaltsmitglieder, Konsumgewohnheiten, Marktbeziehungen und vieles mehr – offen zulegen.
Ablesbar werden aus den Ausgabenvermerken die Maxime der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Trotz seines umsichtigen Finanzverhaltens befolgte der Freiherr die ständisch geforderten Regeln der Distinktion von den Untertanen und gab bevorzugt Geld für Luxusartikel aus, wie dies an der edlen Beschaffenheit der Lebens- und Genussmittel deutlich wird. Vergleichsweise hohe Summen wurden für teure Weine, Tabak und Fleisch ausgegeben. Konsumiert wurden diese Lebens- und Genussmittel hauptsächlich im Rahmen der häufigen gesellschaftlichen Kontakte, denn der Landadel unterhielt weigespannte familiäre Netzwerke, die gepflegt werden wollten.
Der ständige Kontakt und der intensive kommunikative Austausch untereinander – dies geht aus den Tagebüchern des Freiherrn eindeutig hervor – diente zum einen der Selbstvergewisserung des Landadels und der Demonstration der herausgehobenen gesellschaftlichen Position, der sich im dörflichen Umfeld herausheben musste. Zentralen Stellenwert hatte bei diesen Treffen das Spiel, bei dem es jedoch um vergleichsweise geringe Summen ging, die finanziell nicht signifikant waren.
Neben den Ausgaben, die Pemler als Apanage seiner Frau zukommen ließ, waren es vor allem die vielfältigen Ausgaben für Dienstleistungen – sei es für Baumaßnahmen etwa im Rahmen des Neubaus einer barocken Gartenanlage, sei es im Bereich handwerklicher Verrichtungen für Instandhaltungsmaßnahmen der Schlossanlage, für die Bezahlung vieler unqualifzierter Tätigkeiten wie Holzhacken, Botengänge oder Wäschepflege oder auch für die Entlohnung des Gesindes – all diese Ausgaben schlugen hoch zu Buche. Dieser Dienstleistungsbedarf des Freiherrn von Pemler wirkte sich positiv auf das Verhältnis zwischen Hofmarksherrn und Untertanen aus, denn in den meisten Fällen wurden Handwerker und Taglöhner aus der Hofmark für den Arbeitsbedarf im adeligen Haushalt herangezogen. Lediglich Luxusprodukte wie Musikinstrumente, Uhren oder Kleidung wurden in Augsburg oder München erworben.
Somit floss ein großer Teil des Geldes, das Pemler von seinen Untertanen als feudale Renten bezog, wieder in die Hofmark zurück und kam den Tag- und Handwerkern Hurlachs zugute. Das Verhältnis zwischen Hofmarksherrn und Hurlacher Untertanen war, anders als im Falle Leutstettens, vermutlich auch aufgrund dieser Tatsache, weitgehend konfliktfrei. Während Pemler in Hurlach eine Fülle patriarchaler Verpflichtungen wie Leihgaben, Hochzeitsgeschenke und Armenfürsorge wahrnahm, wie den Ausgabenbüchern zu entnehmen ist, so wurden diese Verantwortlichkeiten für Leutstetten in weit geringerem Maße übernommen. Hofmarksherrschaft und Untertanen konnten hier offensichtlich kein engeres Verhältnis zueinander entwickeln. Der Scharwerksprozess, den die Leutstettener Untertanen gegen ihren Hofmarksherrn anstrengten, ist ein Beweis für die schlechte Qualität der Beziehung.
Fazit
Auch wenn die Frage nach der Repräsentativität des gezeigten Beispiels kritisch zu stellen ist, so scheint Sebastian von Pemler kein Einzelfall gewesen zu sein und kann stellvertretend für viele kleinere Hofmarksherrschaften gelten. Maßhalten, vorausschauende Planung und gewissenhaftes Rechnen im Falle des Pemlerschen Haushalts mögen individuelle Charakterzüge eines Landadeligen sein, der Vergleich mit dem Tutzinger Beispiel jedoch legt nahe, dass ein gewisser ökonomischer Pragmatismus bezüglich des Finanzverhaltens durchaus verbreitet war. Auch wenn es Beispiele für Verschuldungen und adelige Verschwendungssucht gibt, so kennzeichnen wohl eher der umsichtige Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen das Bild adeligen Wirtschaftsgebarens.
Wir haben gesehen, dass die finanziellen Möglichkeiten des Freiherrn von Pemler aufgrund mangelnder Einnahmen aus einträglichen Hofämtern oder wirtschaftlicher Aktivitäten, überschaubar und begrenzt waren. Der Freiherr zeigte sich mit der akribischen Führung seiner Ausgabenlisten und der Budgetierung, wie aus der Konstanz der getätigten Ausgaben deutlich hervorgeht, als verantwortungsvoller Haushaltsvorstand. Das aus den feudalen Renten eingenommene Geld wurde nicht profitorientiert angelegt oder angespart, sondern für die laufenden Ausgaben für den Unterhalt des Schlosses bzw. für den Zukauf verschiedenster Dinge konsumtiv genutzt.
Das Abstractum eines nicht sichtbar gehorteten Vermögens war nicht relevant für die Reputation der Familie. Gewinnstreben, Gewinnmaximierung waren eher bürgerliche Tugenden. Reichtum war kein integraler Bestandteil zur Bestimmung der Adelsqualität – ein Aspekt, der im Lauf des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Zahnradbarone noch einmal eine wesentliche Rolle spielen sollte.
Oberste Priorität im Wirtschaftshandeln vieler adeliger Familien im Alten Reich besaß der Statuskonsum und der damit verbundene „Ehrgewinn“ für die Familie. Die Ausgabenbücher des Freiherrn geben ein beredtes Zeugnis eines Landadeligen, der in erster Linie ein feines und standesgemäßes Leben auf dem Lande realisieren musste. Die Statusdemonstration diente in erster Linie dem inneren Kreis der Standesgenossen. In diesem Zusammenhang ist der hohe Anteil der prestige- und statusorientierten Ausgaben zu sehen. Die handlungsleitende Motivation war hier die Vermehrung des Ansehens der Familie.
Vor allem im dörflichen Umfeld musste man sich durch die ostentative Zurschaustellung eines adeligen Lebensstils von den großbäuerlichen, an ökonomischer Potenz in manchen Fällen überlegenen Schichten abgrenzen – und auch hier war Freiherr von Pemler kein Einzelfall. Diese Statusdemonstration konnte zum Balanceakt werden, wie Margit Ksoll konstatierte: „Wenn auch verschiedene Faktoren zur Verschuldung adeliger Familien führen konnten, so dienten sie doch wie zu sehen war, alle dem Erhalt der herausgehobenen Stellung, die jedoch, wurde die Verschuldung zu weit getrieben, auch verloren gehen konnte.“
Die Familie, die Dynastie, der gute Name war der wesentliche Gravitationspunkt und identitätsstiftender Bezugspunkt des adeligen Selbstverständnisses und des Wirtschaftshandelns. Weniger den individuellen Bedürfnissen als den der Familie fühlte man sich verantwortlich. Es galt, das Werk der Vorfahren erfolgreich fortzusetzen und die Reputation beständig zu vermehren. Markgraf Albrecht Achilles formulierte im späten 15. Jahrhundert: „gelt leßt sich gewynnen und verlieren, ere nit.“ Dieser Satz hatte knapp dreihundert Jahre später immer noch nichts an seiner Bedeutung verloren, denn auch Sebastian von Pemler notierte: „Gleich gelt und gwalt verlieren sich, ein guter nam bleibt ewiglich.“