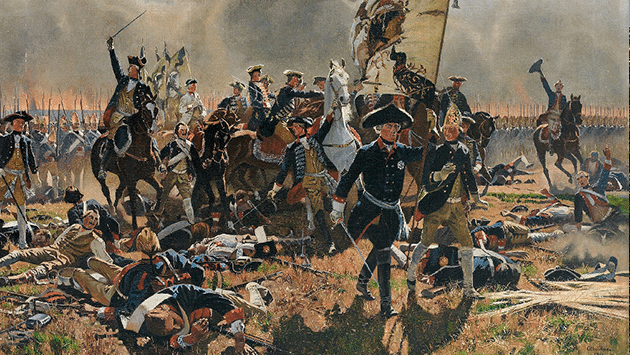In den letzten ein, zwei Jahrzehnten hat es sich eingebürgert, den Siebenjährigen Krieg als einen „frühmoderne[n] Medienkrieg“ zu begreifen, „der einen enormen Anstieg der Publizistik auslöste“. Nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern auch mit der Feder wurde um die Vorherrschaft gekämpft. Druckerpressen fungierten als Waffen. Damit verschob sich der Fokus der Wahrnehmung: Seitdem interessiert nicht allein, was tatsächlich geschehen ist, sondern wie es dargestellt wird, wie bzw. wo diese Thematisierungen zirkulieren und in welche Praktiken sie eingebunden sind. Unter dieser Perspektive stellt sich dann z. B. die Frage, wie eine Schlacht überhaupt beschrieben werden kann und welche medialen Bedingungen ihre Vergegenwärtigung erst ermöglichen. Dabei richtet sich der forschende Blick nicht allein auf gedruckte Texte und Bilder, sondern ebenso auf Musik und lärmende Geräuschkulissen, auf Gebäude und Raumausstattungen, auf Denkmäler, Medaillen, Tabaksdosen und vieles mehr.
I.
Die Gründe für dieses gesteigerte Interesse an den Medien sind sicherlich in unserer Gegenwart zu suchen. Doch ebenso kann es sich auf Zeugnisse aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges stützen. Bereits 1757 konstatierte eine Flugschrift, die große „Menge von Staatsschriften“, die damals Deutschland überschwemmte: „man kan weder aus den alten noch aus den neuern Zeiten ein Beispiel anfüren, daß ein Krieg so viele Federn beschäftiget hätte.“ Und 1763, am Ende des Krieges, resümierte ein Bäckermeister aus Hannover in seinem Tagebuch: „Die Anzahl der Staats- und andern Schriften von diesem Kriege ist recht ansehnlich, sie sollen über 1.000 Stücke, die mehr als 36 Bände in 40 gedruckt, betragen. Es wird wol nicht leicht in den älteren Zeiten ein Krieg geführet worden seyn, wovon die Anzahl der gedruckten als ungedruckten Schrifften so groß oder größer ist, als von diesem letztern Kriege, welches mithin ein Beweis seiner Größe, Wichtigkeit und der dabey bewiesenen Aufmercksamkeit seyn kan.“
Unser Bäckermeister hat eher untertrieben. Es dürften weit mehr Schriften gewesen sein, die zwischen 1756 und 1763 veröffentlicht wurden. Die zeitgenössische Sammlung der neuesten Staats-Schrifften zum Behuf der Historie des jetzigen Krieges, die ab dem zweiten Jahrgang unter dem Titel Teutsche Kriegs-Canzley erschien, druckte in 18 Bänden insgesamt 1.693 Dokumente auf 18.410 Seiten ab. Register erschließen dieses ungeheure Textmassiv. Dabei werden nicht die Kriegspredigten, die poetischen Texte und die Menge der lokalen Gelegenheitsschriften erfasst, ebenso auch keine Zeitschriften und Zeitungen. Die meisten Veröffentlichungen erschienen in den ersten drei Kriegsjahren; danach flaute das Interesse etwas ab.
In dieser regen Publikationstätigkeit sah Johann Wilhelm von Archenholz ein charakteristisches Merkmal sowohl dieses Kriegs wie seines Zeitalters.
In seiner Geschichte des siebenjährigen Krieges personalisiert er das Geschehen: „Eben so sehr wie er [Friedrich II.] sein Schwert gegen seine Feinde brauchte, bediente er sich auch seiner Feder. Überhaupt war die seltsame Mischung von zahlreichen Manifesten und Mord-Szenen eine der Eigenheiten dieses außerordentlichen Krieges. Man bot gegen einander alles auf, was körperliche und Geistes-Kräfte zu leisten vermochten. Nie wurden in einem Kriege so viele Schlachten geliefert, aber auch nie so viele Manifeste herausgegeben, als in diesen Tagen des großen Jammers. Große Monarchen wollten dadurch ihre auffallende Handlungen vor allen Nationen rechtfertigen, um die Achtung selbst solcher Völker nicht zu verlieren, deren Beifall sie leicht entbehren konnten. Dies war der Triumph der Aufklärung, die in diesen Zeiten anfing ihr wohltätiges Licht über Europa zu verbreiten.“
Was mit „Triumph der Aufklärung“ gemeint sein könnte, hilft ein kleiner Aufsatz zu verstehen, der 1784 in der Berlinischen Monatsschrift erschien und der ebenfalls dem preußischen König huldigte. Auch hier ist die Rede vom „Jahrhundert Friedrichs“. Immanuel Kants Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? darf als bekannt vorausgesetzt werden: Aufklärung ist der „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ Diese Emanzipation des Einzelnen bedarf der Entschließung und des Mutes, und sie erfordert vor allem die Freiheit „von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen.“ „[U]nter dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft“ versteht Kant einen solchen, „den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich denjenigen, den er in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen Posten, oder Amte, von seiner Vernunft machen darf.“
Der Aufklärungsprozess wird an die Sprecherrolle des Gelehrten gebunden und an dessen Korrelat: an das „ganze Publikum der Leserwelt“. Anders gesagt: Die Öffentlichkeit, die Kant im Blick hat, basiert auf dem Medium der Schrift, genauer: des Buchdrucks. Es handelt sich um den Kommunikationsraum jener Gelehrten, die „durch Schriften zum eigentlichen Publikum, nämlich der Welt,“ sprechen. Die Schrift, die Publikation, hat hier die Funktion, Universalität zu ermöglichen. Denn der Buchdruck macht eine Äußerung für alle („die Welt“) zugänglich, und er fixiert sie einem Speichermedium. Dadurch macht sich der Aufklärungsprozess unabhängig von der Anwesenheit an einem Ort und von der Zeit. Jeder kann jederzeit auf alles zugreifen und es einer kritischen Überprüfung unterziehen. In diesem Sinn handelt es sich um eine Aufklärungsöffentlichkeit mit Universalitätsanspruch (um eine regulative Idee, da wir ja noch nicht in aufgeklärten Zeiten leben). Demnach wäre Aufklärung eine eminent literarische Angelegenheit. Und der Federkrieg gehört dazu, lässt sich vielleicht sogar als „Triumph der Aufklärung“ (Archenholz) verstehen, weil er den Zwang zur öffentlichen Legitimation des Handelns belegt.
Nun kann man, wenn man den Siebenjährigen Krieg betrachtet, diese Konzentration auf ein privilegiertes Medium monieren. Dagegen wäre aber einzuwenden, dass tatsächlich die Druckschrift dominiert. Illustrierte Flugblätter mit ihrer Kombination von Text und Bild spielen kaum mehr eine Rolle. In der Bildpublizistik erleben einen Aufstieg vor allem Karten, die Schlachten veranschaulichen, allerdings auf eine Art, die einen geübten Rezipienten verlangt. Die berühmtesten Gemälde wie etwa Benjamin Wests Der Tod des General James Wolfe in Quebec (1770) oder Bernardo Bellottos Dresdner Ruinenbilder (Die Ruine der Kreuzkirche, von Osten aus gesehen, 1765) entstanden erst nach dem Krieg. Solche Darstellungen sind in ihrer Materialität zudem an das Original und damit an einen Ort gebunden, sofern sie nicht kopiert, in Serie produziert oder durch Druckgrafik verbreitet wurden. Die schon im 18. Jahrhundert wohl populärsten Bilder lieferte Daniel Chodowiecki mit seinen Kupferstichen, die ebenfalls fast alle in den Jahrzehnten nach dem Krieg erschienen. Ihre große Verbreitung verdanken sie der Kombination mit Texten in Kalendern, die seinerzeit Auflagen von 10.000 – 20.000 Exemplaren erreichten; von solchen Zahlen konnten Bücher nur träumen. Die Verbindung von Text und Druckgrafik ist aufwendig, nicht nur weil es sich um zwei verschiedene Druckverfahren handelt. Ein Kupferstich erlaubt nur etwa 3.000 Abdrucke; dann muss die Platte erneuert werden. Die Textlastigkeit der Kriegspublizistik und der Verzicht auf schmückendes Beiwerk sind Indizien für eine Beschleunigung der Kommunikation und für eine größere Breitenwirkung durch niedrigere Preise.
Die in Speichermedien fixierten Äußerungen werden in Bibliotheken und Archiven, in Galerien oder Museen gesammelt (heute natürlich im Internet). Diese Einrichtungen sorgen für eine Simultanpräsenz aller Äußerungen. Sie plausibilisieren gewissermaßen die Vorstellung einer Universalität, wie sie Kant vorgeschwebt haben mag. Solche Sammlungen reißen die Objekte jedoch aus ihren Gebrauchskontexten, um sie für neue Zusammenstellungen, für andere Kontextualisierungen zu benutzen und sei es auch nur als Beleg in einer Anmerkung. Für Historiker*innen stellt sich die Aufgabe, aus diesen Überresten die damaligen Kontexte (der Produktion, Rezeption, Zirkulation usw.) zu rekonstruieren. Unter diesem Gesichtspunkt sind Beschränkungen einer ansonsten unbegrenzten Zirkulation besonders aussagekräftig. Wir befinden uns eben nicht ‚in einem aufgeklärten Zeitalter‘, sondern betreiben den Prozess einer Aufklärung.
Die Einschränkungen einer universal gedachten Aufklärungsöffentlichkeit lassen auf je besondere Weise ‚begrenzte‘ Medienöffentlichkeiten entstehen. Ihnen kommen wir auf die Spur, wenn wir uns vergegenwärtigen, was Kant nicht berücksichtigt hat. Gerade jene Sachverhalte, von denen er abstrahierte, sind für mein Thema relevant. So sagt Kant erstens nicht, in welcher Sprache (und in welchen Formaten) sich die Menschen verständigen. Zweitens geht er davon aus, dass die Leute lesen und schreiben können, was ja keineswegs selbstverständlich ist. Drittens nimmt er an, dass die Kommunikation der Ermittlung von Wahrheiten dient und einem rationalen Diskurs gehorcht. Viertens setzt Kant eine prinzipielle Gleichheit der Akteure voraus, die in einer ständischen Gesellschaft eher nicht gegeben ist. Fünftens ignoriert Kant das Problem, wie die Publikationen die anderen Teilnehmer erreichen. Welche Medien ermöglichen das? Welche Infrastruktur ist dazu nötig? Mit welchen Distributionsformen erreicht man wen? Aufgrund welcher Geschäftsmodelle kann das überhaupt funktionieren?
II.
Um die Bedingungen für Öffentlichkeiten und Propaganda zu klären, müssen wir uns mit diesen fünf Aspekten beschäftigen: mit der Rolle der Sprache, den literalen Kompetenzen, den rhetorischen Strategien der Kommunikation und vor allem den spezifischen Geschäftsmodellen der Kriegspublizistik. In jeder dieser vier Hinsichten spielen asymmetrische Beziehungen, also Ungleichheiten, eine kaum zu unterschätzende Rolle.
Erstens die Sprache, genauer: Man muss von Mehrsprachigkeit ausgehen. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts werden in Deutschland mehr Bücher in deutscher als in lateinischer Sprache gedruckt und gehandelt. In Frankreich und England erfolgte diese Umstellung bereits einige Jahrzehnte früher. Mit der Ersetzung von Latein als internationale Gelehrtensprache durch Nationalsprachen richtete sich die Expansion des Buchhandels auf den Binnenmarkt, um die durch die nationalen Verkehrssprachen konstituierten Kommunikationsräume zu erschließen. Mit der Sprache änderten sich die Regeln, wer dazu gehörte und wer nicht, also Inklusion und Exklusion. Unter dieser Voraussetzung ist zu erwarten, dass Herrschaftsgebiete, die mehrere Sprachräume umfassten, sich vor besondere Probleme gestellt sahen. Zugleich entstand eine Konkurrenz zwischen den sich etablierenden Nationalkulturen um eine Führungsrolle, die in normativer Hinsicht die Moderne gegenüber dem Vorbild der Antike zu repräsentieren vermochte.
Diese Position nahm seit dem 17. Jahrhundert Frankreich ein. Die Oberschicht, vor allem die höfische Adelsgesellschaft sprach Französisch und orientierte sich an der französischen Kultur; am preußischen Hof weit mehr noch als bei den Habsburgern in Wien. Auf französisch musste schreiben, wer eine europäische Öffentlichkeit erreichen wollte. Selbst nach dem Siebenjährigen Krieg spielte Englisch als internationale Verkehrssprache keine wichtige Rolle; der nicht zu unterschätzende Einfluss englischer Kultur bedurfte der Übersetzung.
War Französisch als Sprache des Adels sozial markiert, erkannte man die Gelehrten am Latein. Diese internationale Verkehrssprache verlor indessen kontinuierlich an Bedeutung. Das galt jedoch nicht für den Bereich der höheren, der akademischen Bildung, die als Voraussetzung für den höheren Staatsdienst an Bedeutung gewann. Hier waren Lateinkenntnisse nach wie vor erforderlich; entsprechend darf man eine einschlägige Kompetenz bei den meisten Autoren voraussetzen. Der allergrößte Teil der Bevölkerung benutzte zur Verständigung Dialekte, deren Reichweite regional begrenzt war. Als nationale Verkehrssprache diente ein Hochdeutsch, das in erster Linie eine Literatursprache war. In den Worten des Aufklärers Christian Garve: „Die Büchersprache ist, in allen Provinzen, selbst dem Landmanne bekannter, als es die Volkssprache der einen Provinz in der andern ist.“ Wir haben es in nationaler Hinsicht mit einem Druckschriftensprachraum zu tun, dessen Sprache erst gebildet (d. h. reguliert, diszipliniert, gepflegt) und durchgesetzt werden musste. Bei ihrer Verbreitung spielten gelehrte Popularisierungsbemühungen eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Als Hindernis erwies sich dabei die Sprachpraxis der Gelehrten wie der Verwaltung (Kanzleisprache), weil sie sich in Wortbildung und Syntax am Latein orientierten und damit endlos verschachtelte, aber korrekte Sätze mit hohem Fremdwortanteil produzierten. Das erschwert das Verständnis eines erheblichen Teils der Kriegspublizistik, die zudem durch ihre typographische Gestaltung (eng gesetzte Bleiwüsten) eine geringe Attraktivität auf eine breitere Leserschaft ausstrahlten. Wollte man die größere Mehrheit der Bevölkerung erreichen, war man auf Dialekte und auf Mündlichkeit angewiesen; das beschränkte die Wirkung auf regionale oder lokale Räume. Wer hochdeutsch sprach, wurde als gebildeter Städter angesehen.
Die Partizipation an der literarischen Kultur setzte zweitens eine Alphabetisierung voraus, genauer: eine Literalisierung, weil es ja um weit mehr als um das Buchstabieren ging. Ob die Signierfähigkeit, die als Indikator für die Alphabetisierung dient, ausreicht, um Zeitungen oder Flugschriften zu lesen, darf bezweifelt werden. Es erforderte eine zumindest rudimentäre Bildung, die nicht unbedingt schulisch vermittelt sein musste. Wie hoch der Anteil der Bevölkerung war, der um 1750 an der Printkultur teilhatte, ist schwer zu sagen: Es gab deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen den Geschlechtern und Konfessionen, zwischen armen und reichen Gegenden, zwischen Nord und Süd.
Als in vollem Umfang literalisiert darf indessen die (adlige, gelehrte, bürgerliche) Oberschicht gelten. Das Potential für eine Ausweitung literarischer Kommunikation darf man jedoch nicht unterschätzen. Es zu erschließen, war die schwierige Aufgabe. Entsprechend waren viele Printprodukte im 18. Jahrhundert an „Gelehrte und Ungelehrte“ oder an „Leser aus allen Ständen“ adressiert. Das darf man aber nicht so verstehen, dass Ungelehrte und alle Stände lasen, sondern dass es Leser*innen unter den Ungelehrten und in allen Ständen gab. Die Ausweitung des Publikums war zunächst ein mühseliges Geschäft, das jedoch im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, also nach dem Siebenjährigen Krieg eine hohe Eigendynamik entwickelte.
Lesen ist das eine, Schreiben das andere. Die Autorschaft scheint auf den ersten Blick anspruchsvoller zu sein. Jedoch ist zu bedenken, dass man in der Frühen Neuzeit sowohl im Schul- als auch im Universitätsunterricht das formgerechte Schreiben lernte, während in der Moderne (‚nach 1800‘) sich die Ausbildung auf das Lesen und das Textverständnis konzentriert. Der Unterricht erfolgte im Rahmen der Rhetorik, die am Redner ausgerichtet war, nicht am Hörer. Als vorbildliche Muster dienten in der Regel antike oder französische Klassiker. Wenn etwa Das bedrängte Sachsen in einer Flugschrift seine Lage in Alexandrinern beklagte, dann wurde ein Versmaß benutzt, das für die hohe Literatur (Tragödien, Epen) charakteristisch war. Solche Formentscheidungen verweisen auf den gelehrten Kontext. Erst die Kommerzialisierung des Buchmarktes wird diesen gelehrten Kommunikationszusammenhang auflösen, genauer gesagt: sie wird ihn öffnen. Jürgen Habermas hat darauf nachdrücklich hingewiesen. Damit veränderte sich die Rolle der Rezipienten. In ökonomischer Hinsicht gewannen sie als Käufer, als Konsumenten an Gewicht. Als lesendes Publikum darf man es sich nicht länger als einen einfachen Resonanzraum rhetorischer oder propagandistischer Strategien denken. Gerade die Fülle propagandistisch-parteilicher Literatur im Siebenjährigen Krieg drängte auf eine Aktivierung des Lesers. Er musste lernen, kritischer mit den angebotenen Informationen umzugehen.
In den Worten eines zeitgenössischen Beobachters: „Man siehet daraus, daß die Zeitungen vor 60 Jahren schon eben das waren, was sie ietzo sind, nämlich eine Mischung von Wahrheit und Lügen, ohne, daß denen meisten Zeitungsschreibern selbst viel dabey zur Last geleget werden kann. Die wahren Nachrichten, sie kommen von dieser oder jener Seite, haben darinnen eine gewisse Hülle um sich, indem auf der einen Seite zu wenig, auf der andern Seite zu viel gesagt wird. Man hat hier die Körner mit sammt der Spreu. Ein vernünftiger Leser weiß die Körner schon abzusondern. Die leichte Spreu wird von dem Winde leicht weggetrieben. […].“
Drittens die Rhetorik. Kant schätzte sie überhaupt nicht. Ihre Bedeutung ist aber im 18. Jahrhundert kaum zu überschätzen. Sie lehrt, angemessen und erfolgreich zu kommunizieren. Es geht dabei immer um eine zu erzielende Wirkung. Man will etwas erreichen, Gefühle erregen, jemanden überzeugen oder überreden. Da eine solche strategische Kommunikation als normal angesehen wurde, bereitet es Schwierigkeiten, davon Propaganda klar abzugrenzen. Es ist ein Leichtes, z. B. an der Berichterstattung über Schlachten zu zeigen, dass die eigenen Verluste gering veranschlagt, die Gewinne übertrieben wurden. Ein Faktencheck geht aber an der Sache vorbei. Solche Berichte verfolgten eine politische Absicht, die klug oder auch weniger klug sein konnte. Die „Staatsklugheit“ konnte nämlich geradezu die Beschönigung einer Niederlage erfordern, „wenn der Unglücksfall in dem Credit der Nation einen Einfluß hat, und wenn es nöthig ist, dem Volke und denen Bundesgenossen einen Muth zu machen, oder sie auf der Parthey standhaft zu erhalten.“
Die Rhetorik fungiert als eine allgemeine Kommunikationstheorie. Sie basiert auf struktureller Mündlichkeit. Ungeachtet der Schrift und des Buchdrucks geht man vom Modell einer Rede vor einem anwesenden Adressaten aus. Das Publikum wird daher nicht als anonym und heterogen gedacht, sondern als homogen und vertraut. Man kennt sich; deshalb lässt sich die Wirkung berechnen. Vorausgesetzt werden in sich geschlossene Kreise, die nach bestimmten Diskursregeln miteinander verkehren, etwa am Hof oder in der Gelehrtenrepublik. Eine Gleichheit aller Teilnehmer wird gerade nicht vorausgesetzt; vielmehr besteht eine große Sensibilität für Rangunterschiede und soziale Hierarchien. Es geht immer um eine angemessene Kommunikation, die sich den Erfordernissen einer stratifikatorisch differenzierten Gesellschaft anzupassen weiß.
III.
Schließlich viertens die Ökonomie. Schriften im Druck zu vervielfältigen, setzt Arbeitsteilung und Kooperation voraus. Der Federkrieger benötigt einen Drucker, der häufig zugleich auch Verleger und Buchhändler ist. In technischer Hinsicht hat sich in diesem Metier seit Gutenbergs Erfindung im 15. Jahrhundert verhältnismäßig wenig verändert. Entscheidende Neuerungen setzen sich erst nach dem Siebenjährigen Krieg durch, zunächst in England, dann auch in Deutschland. Der Strukturwandel, um den es im Folgenden geht, kann also nicht technologisch im Rückgriff auf eine mediale hard ware erklärt werden. Eine größere Aufmerksamkeit verdienen dagegen die Geschäftsmodelle, an denen sich Herstellung und Vertrieb von Printmedien orientieren.
Schriften im Druck zu vervielfältigen kostet. Für die Kalkulation sind die wichtigsten Posten: Satz, Druck, Papier und der Vertrieb. Für die Höhe der Kosten sind unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Für den Satz spielen der Umfang (die Menge der Zeichen) und der Schwierigkeitsgrad (Typographie) eine maßgebliche Rolle, für den Druck und das Papier ebenfalls der Umfang und die Auflagenhöhe, für den Vertrieb vor allem Porto (Gewicht, Entfernungen) und die Handelskonditionen. Je nach Umfang, Auflagenhöhe und Verbreitungsgebiet verschieben sich die Relationen zwischen den Kostenfaktoren: Bei hohen Auflagen sinkt der Anteil der Satzkosten, während der Papierpreis an Bedeutung gewinnt. Bei der Belieferung eines weiträumigen Absatzgebietes steigen die Transport- und damit die Vertriebskosten.
Besonders gering sind unter diesen Bedingungen die Kosten für kurze Texte in kleinen Auflagen für einen lokalen bzw. regionalen Markt. Genau dieses Segment dürfte unter den uns interessierenden Schriften besonders stark vertreten gewesen sein. Es ist weiter davon auszugehen, dass die Buchhändler sehr vorsichtig kalkulierten, um im Bedarfsfall nachzudrucken. Auf einen hohen Absatz zu spekulieren, war dagegen ein höchst riskantes Geschäft. Für England hat Tilman Winkler zwischen Kleinstauflagen (130–550 Exemplare), einem Normalmarkt (500–1.500 Exemplare) und einem Bestsellermarkt (ab 1.000, eher 2.000 Exemplare als Startauflage) unterschieden. Für Kalender, Schulbücher und Ratgeberliteratur wie für Zeitungen und Zeitschriften gelten andere Regeln. Von einem Massenmarkt (d. h. von Massenmedien) im modernen Sinne sind wir noch sehr weit entfernt. Wie kann unter diesen Bedingungen Propaganda oder Kriegspublizistik funktionieren? Was motiviert die Autoren, wenn sie nicht mit (nennenswerten) Honoraren rechnen dürfen? Wie lassen sich in solchen Verhältnissen Kooperation und Finanzierung zu tragfähigen Geschäftsmodellen verbinden?
Unter diesem Gesichtspunkt lohnt es sich, verschiedene Gattungen von Propagandaschriften im Hinblick auf ihre Geschäftsmodelle einmal genauer anzuschauen. In welcher Form organisiert man jeweils die Produktion und den Vertrieb der Schriften? Und wer trägt die Kosten? Als Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen kann die Typologie der Staatsschriften dienen, die Johann Friedrich Seyfart 1757 in einer Flugschrift vorschlägt. Er unterscheidet drei Gattungen: Bei der ersten ist der Staat (der Regent, die Regierung) gewissermaßen der Autor, in dessen Namen Minister oder Beamte Texte verfassen. Bei der zweiten werden Gelehrte (Staatswissenschaftler) von der Regierung mit dem Abfassen von Schriften beauftragt, die aber unter ihren Namen erscheinen und nicht unter dem des Auftraggebers. Die dritte Sorte von Staatsschriften stammt von Schriftstellern, die aus eigener Motivation tätig werden. Als ein viertes Geschäftsmodell müssen wir noch die Zeitungen hinzufügen, die eine gewichtige Sonderrolle spielen. Sie werden übrigens in der Erörterung von Seyfart nicht einmal erwähnt.
Wenig spektakulär ist das erste Geschäftsmodell, weil es unsere Erwartungen über politische Propaganda am ehesten bestätigt. Alles befindet sich mehr oder minder in einer Hand, die zudem über erhebliche organisatorische und finanzielle Ressourcen verfügt. Eine Regierung beauftragt ihre Beamten, einschlägige Texte zu verfassen, wenn es nicht sogar die Minister oder der Regent selber machen. Es handelt sich um autorisierte Schriften, die vor ihrer Publikation oft mehrere Kontrollen durchlaufen. Diese Autorität schützt vor ‚unberufener‘ Kritik. Dafür war die Gegenpartei zuständig: ein Streit unter großen Herren.
Die Vervielfältigung konnte über eine staatliche Druckerei erfolgen. Im 18. Jahrhundert bediente man sich jedoch eher privilegierter Hofbuchdruckereien, so dass deren Professionalität in der Herstellung und im Vertrieb genutzt werden konnten. Damit wurde auch ein Teil des Risikos auf den Buchhändler übertragen. In vielen Fällen rechnete sich die Publikation von Staatsschriften für die Hofbuchdrucker nicht, aber durch die mit solchen Aufträgen zumeist verbundenen Privilegien (etwa das Monopol für den Druck von Kalendern oder Schulbüchern) erwies sich das Geschäft als profitabel. Als herausragendes Beispiel dafür kann in Wien Thomas Trattner dienen, der in kurzer Zeit zum größten und reichsten Buchhändler im Habsburger Reich aufstieg.
Adressat der überwiegenden Mehrzahl der Staatsschriften im Siebenjährigen Krieg war in Deutschland nicht die eigene Bevölkerung, sondern die Reichsöffentlichkeit, d. h. die anderen Regenten im Alten Reich. Das erleichterte die Distribution, denn der permanente Reichstag in Regensburg diente als Nachrichtendrehscheibe. Man verteilte die Publikationen an die dort versammelten diplomatischen Vertreter, die sie dann an ihre Höfe weiterleiteten. Preußens Versuch zu Beginn des Krieges, den Konflikt mit Wien als Religionskrieg zu deuten, zielte vermutlich in erster Linie auf den Reichstag, um sich dort den Beistand aller protestantischen Mächte zu sichern – allerdings ohne Erfolg.
Bei dem ersten Geschäftsmodell unterliegen alle Glieder der Kette von der Produktion über den Druck bis zur Verbreitung weitgehend einer zentralen Steuerung, so dass man von einer absolutistischen Öffentlichkeit oder einem publizistischen Kabinettskrieg sprechen könnte. Verschiedenste Textsorten ermöglichten es geübten Federn, raffinierte taktische und strategische Manöver zu vollführen, die ein ebenso disziplinierter Gegner genau beobachtete, um darauf mit seinen Truppen zu reagieren. Solche Staatsschriften „im Namen der Höfe [riefen] die Gegenantworten, Gegenvorstellungen, rechtlichen Beleuchtungen oder Prüfungen“ der anderen Höfe hervor. In diesem „Austausch von Argumenten in Schriftform [trug man] der Verrechtlichung und der Diskussionskultur im Reichssystem Rechnung“. Allerdings agierte hier vor allem eine relativ kleine ständische Funktionselite. Wenn der Regent die eigene Bevölkerung erreichen wollte, so geschah das kaum über das Printmedium. Vielmehr nutzte er dafür die Infrastruktur der Kirche, indem er Festgottesdienste und Predigtthemen verordnete. Auf diese Weise wurde das zahlenmäßig größte Publikum angesprochen.
Selbst wenn die Kabinette die Gravitationszentren dieser politischen Propaganda bildeten, so übten sie doch keine vollständige Kontrolle über die Kommunikation aus. Das lag allein schon daran, dass Botschaften in Speichermedien eine Tendenz zur Verselbstständigung haben, weil nicht auszuschließen ist, dass sie auch in anderen als den intendierten Kontexten auftauchen. Verbreitet wurden die Staatsschriften zudem über Zeitungsnachrichten. Bei einigen dieser Regierungserklärungen konnte man jedoch mit einer deutlich größeren Resonanz rechnen. Das gilt etwa für die Texte, mit denen Friedrich II. 1756 den Angriff auf Sachsen legitimierte. Dass der französische Originaltext häufiger aufgelegt wurde als seine deutsche Übersetzung (acht zu fünf), sagt etwas aus über die Rezipienten.
Auch das zweite Geschäftsmodell entspricht noch unseren Erwartungen. Die Regierung ‚kauft‘ sich wissenschaftliche Expertise, indem sie Gelehrte oder Staatsmänner beauftragt, juristische Gutachten oder politische Stellungnahmen zu verfassen. Es ist zu vermuten, dass die Regierungen (wenigstens zum Teil) die Kosten für Herstellung und Vertrieb übernahmen. Auch hier handelte es sich um einen Spezialdiskurs, der weitgehend von einer kleinen Funktionselite getragen wurde. Man kann von verdeckter Propaganda sprechen, weil die Auftraggeber nicht erwähnt wurden, um den Eindruck einer unparteilichen Äußerung zu erwecken.
Die Texte erschienen als Beiträge zu einer gelehrten Kommunikation. Das hatte zur Folge, dass sie eine stärkere Kritik durch die anderen Gelehrten erfuhren, da die argumentative und polemische Auseinandersetzung zur Verfassung der respublica litteraria gehörte. Für den Autor ging es hier um seine Reputation als Gelehrter. Für die Kabinette (Höfe) ergab sich die Gelegenheit, die Tragfähigkeit von Behauptungen und Begründungen auszutesten, ohne direkt involviert zu sein. Damit unterwarf man sich aber den Regeln einer gelehrten Kommunikationspraxis, die einem sehr viel langsameren Zeitrhythmus gehorchte. Das hing unter anderem mit der Verbreitung der Schriften zusammen, die hier der Buchhandel übernahm und der in der Frühen Neuzeit besondere Praktiken ausgebildet hatte.
Um die Risiken bei der Vermarktung gelehrter Schriften zu minimieren, hatte sich im Zwischenhandel eine Tauschpraxis etabliert. Auf den Messen, die im europäischen Raum zeitlich aufeinander abgestimmt stattfanden, wurde Druckbogen gegen Druckbogen getauscht, so dass die Bücher über große geographische Entfernungen hinweg die verstreuten Mitglieder der Gelehrtenrepublik erreichen konnten. Erst im Endverkauf wurde Geld eingezogen. Diese über einen längeren Zeitraum sehr effiziente Praxis setzte voraus, dass alle Publikationen in etwa gleichwertig und damit konvertibel waren (wie Bildungsabschlüsse im Bolognaprozess) und dass es sich um relativ langlebige Güter handelte, denn diese Distributionsform war zeitaufwendig.
Vor allem aber prägte der Tauschhandel die Infrastruktur dieses Wirtschaftszweigs, weil er von einem Buchhändler verlangte, zugleich als Verleger und Buchdrucker tätig zu sein, um die für den Tausch nötigen Waren selber zu produzieren. In diesem geschlossenen System galten für auf Aktualität zielende Gelegenheitsschriften wie z. B. Propagandatexte etwas andere Regeln. Hier spielte der Barverkauf (gegen Geld) eine sehr viel größere Rolle, d. h. die Nachfrage wurde zum bestimmenden Faktor. Das führte keineswegs automatisch zu höheren Auflagen. Der Vorteil bestand eher darin, flexibler auf lokale und regionale Märkte sowie auf spezielle Publikumsinteressen reagieren zu können.
IV.
Damit eröffnete sich ein Raum für unser drittes Geschäftsmodell. Als Autoren treten hier Schriftsteller auf, die aus eigener Initiative handeln. Seyfart unterstellt ihnen Ehrgeiz, Eigennutz und Leidenschaft, doch diese anthropologische Motivation, so zutreffend sie auch sein mag, erklärt wenig. Auch eine soziale Verortung der Autoren hilft nicht viel weiter, weil es sich in der Regel um akademisch sozialisierte Gelehrte handelte, bei denen allerdings auffällt, dass sie besonders häufig in der prekären Phase zwischen Studium und fester Anstellung publizierten. Gerade diese Gruppe vom Staat mehr oder weniger unabhängiger Schriftsteller ist für uns besonders interessant, weil ihre Produktion in ihren Inhalten und Formen deutlich vielfältiger war.
Es handelte sich um Gelegenheitsschriften, die auf aktuelle Ereignisse, Debatten und Konjunkturen reagierten. Auch hier lohnt es, auf die Ökonomie zu achten. Es ist anzunehmen, dass sehr viele dieser Gelegenheitsschriften mit keinem großen Absatz rechnen konnten. In Form und Inhalt lehnten sie sich oft an die Staatsschriften an. Sie beteiligten sich an den gelehrten Disputen. Sie verbreiteten Siegesmeldungen in Form von Gedichten und gedruckte Versionen von Predigten. Hohe Auflagen waren damit kaum zu erzielen. Die Honorare dürften folglich eher gering gewesen sein.
Worin lag dann der Gewinn für die Schriftsteller? Was motivierte ihn zum Engagement? Um diese Frage zu beantworten, lohnt ein kleiner Ausflug in die Gefilde der großen Politik, der uns Aufschlüsse über dieses dritte Geschäftsmodell liefern kann.
1760 gelang der französischen Regierung ein Propagandacoup. Jedenfalls darf man wohl davon ausgehen, dass sie es war, die dafür sorgte, dass in Amsterdam eine dreibändige Ausgabe der poetischen Werke Friedrichs II. erschien. Schon allein aufgrund der Prominenz des Verfassers, mehr noch wegen des skandalösen Inhalts stießen die Bände auf sehr großes Interesse beim Publikum. Schnell waren mehrere Auflagen verkauft. Um einen propagandistischen Erfolg im Sinne des französischen Hofes handelte es sich, weil der preußische König sich in seinen Texten sehr abfällig und anzüglich über seine Verbündeten äußerte und sich geradezu als Religionsspötter und Libertin präsentierte. Damit diskreditierte er sich und seine Verbündeten bzw. Sympathisanten in Frankreich und besonders in England, von dessen finanzieller Unterstützung er abhängiger als je zuvor war. Dem konnte die preußische Regierung wenig entgegensetzen. Sie beschränkte sich auf die Behauptung, dass eine mit Verfälschungen operierende, eben nicht autorisierte Ausgabe publiziert worden sei, auf sie dann mit einer eigenen (‚gereinigten‘) Version antwortete.
Doch nicht nur in politischer Hinsicht ist diese Propagandaaktion aufschlussreich, sondern ebenso im Hinblick auf den Umgang mit Texten. Der Versailler Hof sorgte nämlich ‚nur‘ für die Veröffentlichung der Werkausgabe und überließ deren Verbreitung dem internationalen Buchmarkt. Für die Regierung entstanden keine Kosten, während der Buchhandel sogar erheblich profitierte, ebenso wie die Zeitungen und Zeitschriften, die ausführlich über diesen Vorgang und die skandalösen Stellen berichteten. Die Propaganda bediente sich hier des kommerziellen Marktes für Bücher und Nachrichten, indem sie Texte in dieses Mediensystem einspeiste. Dieses Geschäftsmodell unterscheidet sich signifikant von jenem, in dem die Werkausgabe zehn Jahre zuvor erstmals erschien. Friedrich II. hatte nämlich nicht nur seine eigenen poetischen Werke selbst zusammengestellt und in sehr geringer Anzahl drucken lassen, sondern war ebenso für deren Distribution verantwortlich. Nur sehr wenige ausgewählte Personen aus seinem engsten Umkreis (‚Freunde‘) erhielten die Bände von ihm jeweils mit der Verpflichtung, den Inhalt vertraulich zu behandeln, d. h. geheim zu halten. Im Falle eines Todes sollten die Bücher wieder an den König zurückgehen, der sich im Arkanbereich der Macht als Literat präsentierte. In den Besitz seiner Werke gelangte man folglich nur durch eine besondere Gunst des Herrschers. Die Distribution der Publikation folgte der Logik des Gabentausches. Wer die Ausgabe erhielt, wurde für seine (auch zukünftigen) Dienste und Loyalitäten ausgezeichnet. Zugleich versuchte der König auf diese Weise die absolute Kontrolle über seine Texte zu wahren – letztlich vergeblich.
Der Gabentausch funktioniert nicht nur von oben nach unten, sondern er wird – weit häufiger noch – von unten nach oben praktiziert. Es geht dann darum, anderen eine Gunst zu erweisen, um dafür eine andere zu empfangen. Das entspricht sowohl der Logik eines reziproken Austausches in der Gelehrtenrepublik wie der asymmetrischen Beziehungen bei Hofe. In der Regel wird von unten mehr investiert – und von oben weniger gespendet. Zu vermuten ist, dass ein großer Teil der Gelegenheitsschriften in diesem Modus operierte. Die Autoren produzierten Texte, um mit solchen Leistungsnachweisen auf eigene Kompetenzen aufmerksam zu machen und die eigenen Qualitäten im Wettbewerb mit anderen zu bezeugen.
Da dieser Konkurrenzkampf in einem durch Klientel- oder Patronagebeziehungen bestimmten Rahmen stattfand, war es empfehlenswert, die herrschenden Diskursregeln zu beachten. Anders gesagt: Man ahmte die gängigen Formate und Muster nach und suchte sie zu überbieten: imitatio et aemulatio. Insofern kreiste der größte Teil der Gelegenheitsschriften um die Gravitationszentren höfischer Politik und Gelehrsamkeit. Das war eine Erfolgsbedingung in diesem dritten Geschäftsmodell. Die Schriftsteller verhielten sich systemkonform, solange sie auf höherstehende Patrone zielten und nicht auf ein zahlendes Publikum.
Die Kommerzialisierung des Buchmarkts eröffnete Freiräume, wenn Honorare gezahlt wurden, von denen Autoren leben konnten. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war eine solch prekäre Existenz eines ‚freien‘ Schriftstellers jedoch keineswegs erstrebenswert. Vielmehr bemühten sich die meisten Autoren um eine feste Anstellung im Staats- oder Kirchendienst. Mit ihren Diskursbeiträgen und ihren gedruckten Predigten bewarben sie sich um ein Amt oder eine Beförderung oder auch nur, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Damit trugen sie zur Propaganda wie zum Ausbau des Printmarktes und der dafür nötigen Infrastruktur bei. Gemäß der Logik dieses dritten Geschäftsmodells kam es jedoch nicht auf große Verkaufserfolge an, vielmehr erfüllten selbst kleinste Auflagen den Zweck, sich gedruckt zu sehen. Im Hinblick auf die entstehenden Kosten waren Kleinstauflagen eben weit weniger riskant. Selbst auf das Honorar konnte man verzichten, selbst ein eigener ‚Druckkostenzuschuss‘ konnte sich für einen Autor lohnen, wenn er damit einen Wettbewerbsvorteil erzielte. Es ist daher durchaus wahrscheinlich, dass manche Predigt mehr Zuhörer fand als ihr Druck Leser; aber in gedruckter Fassung dürfte sie ‚exklusivere‘ Rezipienten erreicht haben.
Welche Karrieren unter Patronage-Bedingungen möglich waren, lässt sich an einem ungewöhnlichen Beispiel veranschaulichen. Anna Louisa Karsch stammte aus ärmsten Verhältnissen. Sie verfügte über die außergewöhnliche, geradezu geniale Fähigkeit, aus dem Stegreif Gedichte zu schreiben. Man musste ihr dazu lediglich ein Thema, ein paar Wörter oder Phrasen vorgeben, um in kurzer Zeit formvollendete Verse von ihr zu erhalten. Mit gedruckten Gelegenheitsgedichten über Stadtbrände und die Siege von Friedrich II. erregte sie Aufmerksamkeit und fand Gönner, die mit Präsenten nicht geizten, zunächst unter den Landgeistlichen, dann in adligen Kreisen und am Hofe der preußischen Königin. Schließlich wurde sie sogar von Friedrich II. empfangen, dem sie das Versprechen abringen konnte, ihr ein Haus zu schenken; nach langem Drängen wurde diese Zusage von König Friedrich Wilhelm II. eingelöst. In literarischen Kreisen galt diese Dichterin als ein bewundertes Naturgenie, das durch ihr ‚ingenium‘ neueste Dichtungstheorien bestätigte. Auf dem Buchmarkt hatte sie dagegen weit weniger Erfolg.
V.
Wenn Seyfart in seiner Typologie der Autoren von Staatsschriften die Zeitungsschreiber nicht berücksichtigt hat, dann mochte es daran liegen, dass Zeitungen ihr eigenes (ein viertes) Geschäftsmodell hatten. Zeitungen waren ein Kind der Post, und das unterschied sie von Zeitschriften und Journalen, die als Periodika im Rahmen der respublica litteraria entstanden. Entsprechend wenig wurden deshalb die Zeitungen in der traditionellen Buchhandelsgeschichte berücksichtigt. Zeitungen dienten der Verbreitung von Nachrichten, deren Mitteilung zunächst über Briefe erfolgte, die dann an den Knotenpunkten der Postwege gebündelt und durch den Druck vervielfältigt wurden. Deshalb spielt hier das Postnetz eine zentrale Rolle. Diese Herkunft bestimmte die Aufmachung der Zeitungen noch Mitte des 18. Jahrhunderts. Anstelle von Schlagzeilen standen Orts- und Datumsangaben, die sich jeweils auf die Herkunft der Nachrichten, dem Ort des Korrespondenten, bezogen und nicht auf das berichtete Geschehen. Neuigkeiten aus Indien konnte man daher unter Lissabon oder Halle finden, weil dort entsprechende Informationen eingetroffen waren.
Die Nachrichten wurden in der Reihenfolge ihres Eintreffens in der Redaktion abgedruckt, nicht nach der Chronologie der Ereignisse oder gar im Hinblick auf ihre Relevanz. Diese Praxis diente der Authentifikation. Sie sagt zugleich etwas über Postverbindungen aus, über Entfernungen und Geschwindigkeiten. Im Schnitt lagen die Ereignisse, über die berichtet wurde, etwa vierzehn Tage zurück. Reitende Boten, Briefe und Gerüchte waren schneller. Der Vorteil der Zeitungen bestand weniger in der Aktualität, als vielmehr in der gleichförmigen Verbreitung eines Nachrichtenflusses. Damit stellte dieses Medium einen sich beständig aktualisierenden Kenntnisstand über die Weltbegebenheiten her. Deshalb kann man von einer Medienrealität sprechen, die als generalisierter Referenzrahmen für die Kommunikation dienen konnte. In diesem Sinne finden sich in den Briefen der Zeitgenossen häufig Verweise auf Zeitungslektüre, die damit ein Wissen als allgemein bekannt unterstellten, um daran weitere Informationen oder Kommentare anzuschließen. Briefe und Zeitungen kamen mit der gleichen Post.
Aufgrund ihrer periodischen Erscheinungsweise, häufig an den zwei oder drei Posttagen in der Woche, waren die Zeitungen einer deutlich stärkeren Kontrolle ausgesetzt als etwa Flugschriften. Staatliche Zensur war die Regel, und ihre Berechtigung wurde im 18. Jahrhundert kaum bestritten. Zur Kontrolle des Nachrichtenflusses dienten zudem Einfuhrverbote fremder (‚ausländischer‘) Zeitungen. Doch das konnte die Verbreitung von Informationen nur bedingt einschränken, weil andere Zeitungen (speziell die Hamburger) die Meldungen ebenfalls verbreiteten. Einfuhrverbote dienten eher der ökonomischen Schädigung einer unliebsamen Konkurrenz. Johann Heinrich Gottlob von Justi nannte Zeitungen, die über Weltbegebenheiten berichteten, „Staatszeitungen“, deren „Patheylichkeit“ allgemein bekannt sei. Daran hätte sich auch im Siebenjährigen Krieg nichts geändert, denn schon im Spanischen Erbfolgekrieg sechzig Jahre zuvor habe man die Zeitungen „vor nichts anders als Waffen der Feder angesehen […], deren sich die kriegführenden Partheyen gegen einander eben also bedienen, als der ordentlichen Kriegswaffen.“
Und er fügte dann hinzu: „Wenn wir an dieser Beschaffenheit der meisten Zeitungen noch einen Augenblick zweifeln könnten; so würden wir durch dasjenige, was in dem itzigen Zeitraume geschiehet, genugsam davon überzeuget werden. Sehen wir nicht, daß verschiedene Zeitungen wider einander zu Felde ziehen, und einander mit allen ersinnlichen Anzüglichkeiten und Lügenstrafen bestürmen? Wenn einige nicht offenbar Parthey auf Seiten der kriegführenden Theile nehmen, so blicket doch ihre Partheylichkeit allenthalben hervor.“
Diese Parteilichkeit der Zeitungen war dem Publikum bewusst. Ja, sie dürfte zum Erfolg dieses Medienformats beigetragen haben, weil man sich so einigermaßen verbindlich über die Haltung einer Regierung oder Hofes informieren konnte. Dafür spricht auch die detaillierte Hofberichterstattung. Nicht das einzelne Organ, wohl das Mediensystem lieferte durchaus verlässliche Informationen über die politische Lage in der Welt. Das erforderte allerdings die Lektüre verschiedener Zeitungen. Selbst wenn das nicht möglich war, förderte das Zeitungslesen einen kritischen Blick auf das berichtete Geschehen. Man lernte mit der perspektivischen Brechung der Wahrnehmung umzugehen.
Das lesende Publikum bestand auch hier weitgehend aus jenem relativ kleinen Kreis einer gelehrt-gebildeten Oberschicht mit den Gravitationszentren höfische Gesellschaft und Gelehrtenrepublik. Das bestätigen die Auflagenzahlen, die um 1750 im Durchschnitt noch eher im Bereich des Normalmarktes (500–1.500 Exemplare) lagen und erst am Ende des 18. Jahrhunderts stark expandierten. Selbst wenn man berücksichtigt, dass printmediale Produkte weit mehr Leser als Käufer hatten, dass sie in Kaffeehäusern und Gastwirtschaften auslagen oder im Publikum zirkulierten, sollte man ihre Reichweite nicht überschätzen. Genauso wichtig ist jedoch zu sehen, dass den ständischen Funktionseliten immer mehr Informationsquellen zur Verfügung standen. Darauf deuten die Klagen über die Fülle der Publikationen hin. Vor allem aber übte man sich in der Beobachtung der Politik, wobei die Perspektive der Höfe und Regierungen dominierte.
VI.
Als Zwischenfazit ist zu konstatieren: Nichts gravierend Neues im Siebenjährigen Krieg. Relevante Veränderungen ergeben sich erst dann, wenn ein ‚neues‘ größeres Publikum gewonnen wird, wenn mit einem kommerziellen Markt für Printprodukte ein ‚neues‘ Gravitationszentrum entsteht, das den Einfluss von Hof bzw. Staat und Gelehrsamkeit relativiert, indem es Raum für ein fünftes Geschäftsmodell schafft. Hier lohnt ein kurzer Blick auf die französischen und englischen Verhältnisse, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts noch den deutschen um einige Jahrzehnte voraus waren.
Sowohl Frankreich wie England verfügten mit Paris und London über Großstädte als Zentren, die mit ihren ca. 500.000 Einwohnern etwa fünfmal so groß wie Wien oder Berlin waren. Mit dieser Bevölkerungskonzentration ging eine erhebliche Kommunikationsverdichtung einher. Nicht nur die relativ kurzen Wege erwiesen sich für den Buchmarkt als ein Vorteil sondern auch die Rückbindung der Printmedien an die Interaktionen in den Salons, Kaffeehäusern, Gaststätten, Clubs usw. In diesem dichten Geflecht von Resonanzräumen für Gedrucktes formierten sich konkurrierende Gruppen und Positionen in einer Vielfalt, für die es im deutschen Sprachraum noch so gut wie kein Pendant gab.
In der Art und Weise, wie mit dieser Pluralität umgegangen wurde, unterschieden sich England und Frankreich. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts herrschte in England eine weitgehende Meinungs- und Pressefreiheit. Da es kaum staatliche Einschränkungen gab, wurden die Auseinandersetzungen auf dem Markt ausgetragen, in einem „Wörterkrieg“ (Winkler), bei dem es zugleich um politische wie ökonomische Vorteile ging. Dagegen gab es in Frankreich verhältnismäßig strenge Zensurgesetze, die allerdings weit weniger streng gehandhabt wurden. Entgegen dem Anschein haben wir es auch hier nicht mehr mit einer absolutistischen, sondern mit einer durchaus pluralistischen Öffentlichkeit zu tun.
An der Spitze konkurrierten vor allem drei Zentren miteinander: der Hof in Versailles, die Pariser Salons und die Aufklärungsphilosophen im Umkreis der Encyclopédie. Entsprechend differenziert agierte Friedrich II.: Beim Zeremoniell orientierte er sich eher an Versailles, in der Kultur dagegen an den Aufklärern. Unterhalb dieser Hochkultur brodelte es auch in Paris heftig. Da Französisch zudem die europäische Verkehrssprache der Oberschichten war, gab es außerhalb Frankreichs eine rege Literaturproduktion, die aus dem Ausland auf den französischen Markt drängte. Besonders in den Niederlanden und speziell in Amsterdam wurde vieles gedruckt, was in Frankreich verboten war, um es ins Land zu schmuggeln, ohne dabei auf eine Sprachgrenze zu stoßen.
Diese relativ pluralistischen Öffentlichkeiten in Frankreich und Großbritannien hatten für die Propaganda zur Folge, dass man hier stets mindestens zwei Adressaten im Blick haben musste: nach außen den Kriegsgegner bzw. Verbündeten und nach innen die Opposition im eigenen Land. Damit ergab sich eine Verschränkung von internationaler und nationaler Öffentlichkeit. Auch das lässt sich am Beispiel der bereits erwähnten Publikation der poetischen Werke Friedrichs II. veranschaulichen: Die Veröffentlichung erfolgte in der französischen Originalsprache in den Niederlanden, also im neutralen Ausland, und war an ein internationales Publikum gerichtet. Beabsichtigt war, erstens den preußischen König als Kriegsgegner bloßzustellen, zweitens seine englischen Unterstützer und damit seine Kreditfähigkeit zu schwächen, schließlich drittens die mit ihm sympathisierenden französischen Aufklärer zu diskreditieren.
Überhaupt ließe sich am Beispiel der Friedrich-Rezeption in Britannien und Frankreich zeigen, wie der preußische König jeweils auch für innenpolitische Zwecke benutzt wurde, etwa indem man den erfolgreichen Feldherrn mit weit weniger glücklichen britischen Militärs verglich oder indem man den aufklärten preußischen Monarchen mit dem französischen Königshof kontrastierte. Für diese nationalen wie internationalen Deutungskämpfe bieten sich die gängigen Nationalstereotypen als Waffen an, die durch den Konflikt geschärft wurden. So definierten sich Briten in Opposition zu Franzosen und umgekehrt. Diese patriotische bzw. nationale Semantik produziert starke Generalisierungen, die zur Identifikation auffordern, um nicht zu sagen: zwingen.
VII.
Im Unterschied zur englisch-französischen Auseinandersetzung fand der deutsche Krieg nicht nur im Lande statt, sondern es gab wesentlich mehr politische Zentren im Reich; sie waren der wichtigste Adressat der Kriegspublizistik. Das Printmedium diente vorrangig „der gegenseitigen Information der europäischen Höfe und ihrer politischen Führungsschichten“. Um die Dominanz einer absolutistische Öffentlichkeit mit den beiden Gravitationszentren Hof und Gelehrsamkeit zu relativieren, war es erforderlich, dem Buchhandel eine stärkere Unabhängigkeit gegenüber Staat und Gelehrtenrepublik zu verschaffen. Als Voraussetzung für einen Strukturwandel bedurfte es einer Erweiterung des Publikums, einer Vergrößerung der Nachfrage. Anders gesagt: Man musste den Markt stärken, um ein fünftes Geschäftsmodell zu etablieren. Was war zu beachten, um auf dem ‚freien‘ Markt erfolgreich zu sein?
Zunächst ist zu konstatieren, dass sich zwischen 1740 und 1800 die Menge der auf den Leipziger Ostermessen gehandelten Bücher verdreifachte. Die höchsten Wachstumsraten fielen in die letzten Jahrzehnte des Jahrhunderts. Archenholz hielt das für eine Folge des Krieges, und ein Großteil der Forschung zur Kriegspublizistik ist ihm darin gefolgt. Wenn es so wäre, hätte mit dem Krieg auch die Expansion enden müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb empfiehlt es sich, die Blickrichtung umzudrehen und nicht vom Krieg, sondern von der Medienentwicklung auszugehen. Dann erscheint das Staunen über die Menge der Kriegspublizistik nur als ein Vorspiel zu den Debatten über Schreibwut und Lesesucht in den 1770er Jahren; die Inhalte und Formate haben sich geändert, nicht der Medienkonsum. Die Expansion des deutschen Buchmarkts im 18. Jahrhundert war mit einer Umschichtung der Marktanteile verbunden. So sank der Anteil der theologischen Schriften von 1740 bis 1800 von 38,5 % auf 13,6 %, während im gleichen Zeitraum die Belletristik (Schöne Wissenschaften und Künste) ihren Anteil von 5,8 % auf 21,5 % steigern konnte und dies – wie gesagt – bei einer Verdreifachung der Gesamtproduktion. Auch das Realienwissen (Landwirtschaft, Gewerbe, Erziehung, Naturwissenschaften usw.) zählte zu Gewinnern des Strukturwandels. Der Bedeutungsverlust einer traditionellen Gelehrsamkeit ist auch daran zu erkennen, dass im Bereich der schönen Literatur der Roman zur vorherrschenden Gattung aufstieg; mehr als die Hälfte der Titel in diesem Segment entfiel um 1800 auf ein Genre, das in den zeitgenössischen Poetik-Lehrbüchern oft nicht einmal erwähnt wurde.
Die populären Formate fungierten als treibende Kraft bei dem Strukturwandel des Buchhandels und damit der Öffentlichkeit. Bei den Produzenten dieser marktgängigen Ware handelte es sich – wie zuvor – zumeist um akademisch gebildete Männer. Anders als zuvor aber ahmten sie jetzt nicht mehr nach, was die normativen Gattungspoetiken vorgaben, sondern was auf dem Markt erfolgreich war. Das waren mit den Moralischen Wochenschriften, den Totengesprächen, den Robinsonaden, den Briefromanen, den empfindsamen Liebesgeschichten und Dramen fast durchgängig Formate, für die England und Frankreich die Vorbilder geliefert hatten. Will man auf einem etwas abstrakteren Niveau die Erfolgsmerkmale benennen, so wären dies: erstens die Erfindung von generalisierbaren Charakteren, die zur Identifikation einladen. Das konnten Individuen sein, aber auch Kollektive, z. B. imagined communities wie die Nationen, das Bürgertum oder die Menschheit. Die fiktiven Akteure traten zweitens in Form von Konflikten oder Dialogen zueinander in Beziehung, um die unterschiedlichen Positionen über Kontrastrelationen zu verdeutlichen. Drittens wurde so eine mehr oder minder dramatische Handlung in Gang gesetzt, die sich in Geschichten narrativ entfalten ließ. Die Auseinandersetzungen gingen viertens zu Herzen, sie erregten Emotionen. Über Sympathie und Antipathie, über Tugend und Laster suchte man fünftens vor allem die Wirkung zu steuern.
Auf dieser Grundlage wäre es gar nicht so schwer zu zeigen, warum der preußische König über so hohe Popularitätswerte verfügte. Man hatte einen prominenten Akteur (genauer: das medial verbreitete Bild eines Akteurs), der sich in einem existentiellen Konflikt befand, als Feldherr handelte und gegen schier übermächtige Gegner kämpfte. Zugleich behauptete er sich auch intellektuell im Streitgespräch mit seinen Kontrahenten. Schon während des Krieges, vor allem aber danach wurde dieser König in zahlreichen Anekdoten und Kupferstichen familiarisiert. All das zog öffentliche Aufmerksamkeit auf sich, stimulierte die weitere Produktion, erregte beim Publikum Gefühle und provozierte Bewertungen. Hier Neutralität zu wahren, fiel schwer. – Man könnte an dieser Stelle einmal überlegen, wie unter diesen Bedingungen und mit dem vorgegebenen Rohmaterial eine Imagestrategie für Maria Theresia auszusehen hätte. Man würde dann feststellen, dass entsprechende Überlegungen schon im 18. Jahrhundert umgesetzt wurden.
Nicht nur die Modellierung der Herrscherbilder folgte populären Mustern, sie beeinflussten auch die Staatsschriften. Grob geschätzt operieren ca. 10–15 % aller in der Teutschen Kriegs-Canzley gelisteten Titel mit fiktiven Sprecherrollen. Sie präsentieren sich als Schreiben eines Vaters, eines Freundes, eines Reisenden, eines Kaufmanns, eines Offiziers, eines Wienerisch-Gesinnten usw. und sie wenden sich an Adressaten, die ebenso allgemein und unbestimmt bleiben.
Es handelt sich um Charaktere, die durch wenige, aber bezeichnende Merkmale bestimmt sind. Es sind Privatleute, die das Kriegsgeschehen und sein publizistisches Echo beobachten und kommentieren. Als Vater oder Freund erscheinen sie vertrauenswürdig und welterfahren als Reisender oder Kaufmann. Stets bleiben sie anonym. Dagegen benennen die allermeisten Staatschriften im engeren Sinn historisch verifizierbare Autoren, deren politische, juristische oder militärische Positionen ihre Äußerungen autorisierten. Deshalb ist es in diesen Texten unerlässlich, den Namen und den Rang zu nennen. Bei den literarisierten Publikationen verhält es sich anders. Das sei hier an einem eher ungewöhnlichen Beispiel erläutert.
In der Erinnerung des Preßbengels an seinen Buchdrucker-Gesellen wegen seines Schreibens über die Schriften der Preußischen Publicisten spricht ein Gegenstand: ein Hebel, der beim Buchdruck verwendet wird. Wer mit der Kunst und den Fabeln Äsops vertraut ist, wer sich also in der Literatur auskennt, den kann es nicht überraschen, wenn Tiere oder Gegenstände das Wort ergreifen. „Selbst das Publicum wird es so wenig bewundern, daß ein Preßbengel redet, als ihm befremdlich vorgekommen ist, von einem Buchdruckergesellen solch gelehrtes Schreiben zu sehen“.
Im Unterschied zu einer authentischen Autorschaft, bei der eine Person mit Namen, Rang und Reputation für seine Aussagen einsteht, legitimieren sich fingierte Sprecherrollen allein durch ihren Text. „Die Welt ist gewohnt, aus der Denkungsart und dem Vortrage auf den Stand des Verfassers zu schliessen.“
Deshalb komme es auch nicht darauf an, wer man tatsächlich sei, ob Buchdruckergeselle oder Pressbengel, sondern wie und was man sagt, ob man also die in der literarischen Welt geltenden Normen befolgt: „Es ist also höchstnöthig, daß man jederzeit erhaben, daß man edel denke, und nie einen niederträchtigen Begriff entwischen lasse. Erinnern sie sich dessen, so oft sie schreiben wollen. Nennen sie sich immerhin einen Buchdrucker- oder Schneidergesellen. Seyn sie es wohl gar wirklich. Geben sie ihren Gedanken einen edlen Schwung, so wird jedermann doch einen grossen Gelehrten hinter der Larve suchen.“
Damit konstituiert sich ein Kommunikationsraum, an dem alle teilhaben können, ungeachtet ihrer tatsächlichen sozialen Stellung, sofern sie sich den Diskursregeln unterwerfen. Es sind die Regeln der sich sozial öffnenden gelehrten Welt. Ihre Mitglieder dieser respublica litteraria zeichnen sich durch ihre Unabhängigkeit und Freiheit aus. „Ein Dienstbothe darf nicht so freymüthig denken, wie ein Herr. Aus allen seinen Handlungen muß eine Art der Unterwürfigkeit hervor leuchten. Er muß sich dazu gewöhnen, wenn er nicht für liederlich gehalten seyn, und sein Glück verscherzen will. Diese Gewohnheit hängt ihm immer an. Allenthalben verräth er seinen Stand.“ Daher tritt der Pressbengel „wie ein Herr“ auf, wie ein Gelehrter, der sich einem größeren Publikum präsentiert; Kant würde sagen: der ‚Welt‘.
Seine Rede-Kompetenz beweist der Pressbengel durch die Kritik anderer Texte, zunächst den des „Buchdrucker-Gesellen“, anschließend aber auch mehr als zehn weiteren Publikationen, die sich ebenfalls fiktionalisierter Sprecher bedienen. Dabei geht es um die Stichhaltigkeit der Argumentation ebenso wie um Fragen des Ausdrucks (Grobheiten, grammatische Korrektheit, stilistische Eleganz). Über eine solche – für diese Texte charakteristische – kritische Auseinandersetzung verdichten sich die Beziehungen zwischen den genannten Texten zu einem Diskussionszusammenhang, der seine Eigenständigkeit gegenüber den politisch autorisierten Staatsschriften behauptet. Man könnte hier von einer räsonierenden Öffentlichkeit sprechen, die das politische und militärische Geschehen beobachtet und kommentiert, ohne an der Macht partizipieren zu wollen.
Die Fiktionalisierung dient dem lesenden Publikum dazu, sich besser in der wirklichen Welt zu orientieren, indem die Vielzahl zugänglicher Informationen in geordnete Zusammenhänge gebracht wird. In den Texten leisten das die Sprecherfiguren, die nicht über den Dingen stehen, sondern Teil des Geschehens sind, die durchaus Partei ergreifen, die jedoch ihre Position angesichts anderer Auffassungen gegenüber dem Publikum überzeugend vertreten müssen. Bei dieser Einübung in eine perspektivische Wahrnehmung bieten die typisierten Figuren den sehr viel stärker individualisierten Rezipienten eine breite Identifikationsfläche an.
Das kritische Räsonnement, dessen sich selbst die Propagandisten bedienen müssen, stellt die eine große Leistung dieser Art Kriegspublizistik dar, die andere besteht in einer populären und pragmatischen Zeitgeschichtsschreibung. Hier reagieren die Verfasser ebenfalls auf die Menge der Meldungen in Zeitungen und Flugschriften und auf die fehlende Zeit des Publikums, diese Nachrichten zu verarbeiten. Also übernimmt ein ‚Freund‘ dieses Geschäft für einen ‚Freund‘ und ist damit ausgesprochen erfolgreich.
Die Flugschrift Schreiben eines Freundes aus Sachsen an seinen Freund in W. über den gegenwärtigen Zustand des Krieges in Teutschland erfährt innerhalb von zwei Jahren allein 24 Fortsetzungen, bevor dann eine zweite Staffel einsetzt, die es auf 25 Folgen bringt. Aus einer Gelegenheitsschrift wird ein Periodikum, genauer gesagt: ein Werk in Fortsetzungen, das mit dem Abschluss 1761 in zwei Bänden erscheint. In der Vorrede begründet der Verfasser diese Publikationsweise zum einen mit der Aktualität seiner Berichte, zum anderen damit, dass „nicht ein jeder große historische Werke kauffen kan und doch diese Kriegserzehlung würdig genug ist, auch von dem armen Mann auf Kinder und Kindes-Kinder gebracht zu werden, damit selbige noch den großen Finger GOttes in diesen gefährlichen Zeitläuften erkennen und nicht verzagen, wo sie auch dergleichen trübseelige Tage und Jahre erleben sollten. Letzlich ist es in Schreiben verfasset worden, daß es dem begierigen Liebhaber solcher Kriegsgeschichte nicht zu hart ankommt, wann er nicht gerne vieles auf einmahl daran verwenden mag oder kan. Er hat also Gelegenheit gehabt mit sehr wenigen Kosten innerhalb 6. Jahren sich eine Historie anzuschaffen, die alle Vorfallenheiten auf das getreueste lieferte.“
Die Lieferung eines Werks in einzelnen Heften zu einem geringen Preis, damit jedermann es erwerben kann, verweist auf das Geschäftsmodell der Kolportage voraus, mit der Konversationslexika und Romane im 19. Jahrhundert ein Massenpublikum erreichten.
Einer konstanten Nachfrage konnte sich auch Christoph Gottlieb Richter sicher sein, dessen anonym erschienene Gespräche im Reiche der Todten es zwischen 1757 und 1763 auf fünfzig Hefte im Umfang von jeweils 50–60 Seiten brachten. Jede dieser Broschüren war mit einer handkolorierten Karte von einer Schlacht, einem Treffen oder einer Belagerung ausgestattet. Es handelte sich also um ein eher hochwertiges Produkt; darin unterschied es sich von Nachdrucken. Auch hier fügten sich die einzelnen Hefte zu Büchern zusammen, die, mit Registern versehen, sich als Nachschlagewerk eigneten. Richter knüpfte an eine literarische Tradition (Lukian, Fontenelle, Faßmann) an, wenn er berühmte Akteure nach ihrem Tod unter den besonderen Bedingungen des Jenseits über aktuelles Geschehen sprechen ließ. Im Totenreich muss man sich nicht mehr verstellen und eigene Interessen verfolgen; man könnte von einer herrschaftsfreien Kommunikationssituation sprechen.
Der Dialog besitzt den darstellungstechnischen Vorteil, dass er die Figuren selber reden lässt. Das erweckt nicht nur den Anschein von Objektivität, sondern lässt die unterschiedlichen Auffassungen der Kriegsparteien selber zu Wort kommen, ohne dass ein vermittelnder Erzähler dazwischentritt. Wie auf einer Bühne setzen sich die Figuren der Beobachtung aus, und die Zuschauer können sich selbst ein Urteil bilden.
Die „republikanische Freiheit des lesenden Publikums“ (Schiller) bleibt gewahrt: „Es ist nicht möglich, wenn zween über einerley Sache reden, daß nicht die Gründe des einen die des andern überwiegten. Das Urtheil, auf welcher Seite sie am stärksten seyen, gehört dem Leser, und dieses Urtheil kann ihn keine Macht auf Erden benehmen, woferne er nur über diese Gabe des Himmels hält, daß er nicht seiner nähern Pflichten dabey vergesse.“
Die Entscheidung, berühmte und hochstehende Gesprächspartner zu wählen, wird damit begründet, dass es sich um bekannte Charaktere handele, von denen man weiß, dass sie ihren Souveränen treu gedient haben und deshalb deren Position überzeugend vertreten können. Das fingierte Gespräch hat Richter, wie er beteuert, auf der Grundlage von Staatsschriften und Zeitungsmeldungen verfasst.
An die Stelle der adligen Oberschicht können auch einfache Leute treten. Das geschieht z. B. in der Wochenschrift Der mit dem Sächsischen Bauern von jetzigem Kriege redende Französische Soldat, die vom August 1757 bis zum September 1758 in Merseburg erschien. Aufschlussreich ist die hier gewählte Figurenkonstellation. Ein sächsischer Bauer unterhält sich mit einem französischen Soldaten, der sich als Frankfurter entpuppt. Frankreich und Sachsen waren Verbündete. Für die preußische Armee bestand keinerlei Sympathie, deren König begegnete man gleichwohl mit Respekt. Der Städter spricht hochdeutsch, der Dorfbewohner Dialekt. Das dürfte die Reichweite der Zeitschrift auf den regionalen Markt beschränkt haben. Über die fiktiven Akteure signalisierte die Wochenschrift, dass sie nicht nur auf ein ungelehrtes Publikum zielte, sondern dessen Blick auf das Geschehen berücksichtigte. Es geht um Inklusion. Alle sollen einbezogen werden in die Wahrnehmung, in die Texte, in den literarischen Markt, in eine größere Öffentlichkeit, die sich pluralisiert.
Unter diesem Gesichtspunkt muss man auch den berühmtesten literarischen Kriegsteilnehmer sehen: Gleims Preußischen Grenadier. Bei diesem teilnehmenden Beobachter oder beobachtenden Teilnehmer handelt es sich um den radikalsten Entwurf einer fiktiven Gestalt, und diese Radikalisierung erfolgte im Bereich der Poesie. Auch hier handelt es sich um einen ‚gemeinen Mann‘, dessen Lieder allerdings dem gehobenen literarischen Segment zuzuordnen sind. Bei aller Popularität, die dieser Figur damals schnell zuflog, darf man davon ausgehen, dass die preußischen Soldaten nicht zu seinen primären Adressaten gehörten, eher schon die vielen Federkrieger. Mit seiner poetischen Kunstfigur reagierte Gleim auch auf ein Darstellungsproblem: Wie lassen sich die Taten des preußischen Königs in Poesie verwandeln, um den Nachruhm auf Dauer sicherzustellen? Als Vorbild dafür diente die antike Konstellation von Kaiser Augustus und Horaz. Auch Archenholz folgte diesem Schema, wenn er als Resultat des Bürgerkriegs eine kulturelle Blütezeit prophezeite. Unter diesem Blickwinkel ging es dann auch darum, als Autor einer literarischen Glanzperiode Ruhm zu erwerben und zugleich das gesellschaftliche Renommee der Literatur aufzuwerten. Bevor Gleim selber tätig wurde, drängte er Gotthold Ephraim Lessing, Ewald von Kleist und den befreundeten Horaz-Übersetzer Karl Wilhelm Ramler dazu, eine Ode auf Friedrich II. zu schreiben.
Als moderner Tyrtäus, erneut ein literarisches Rollenspiel, griff Gleim jedoch nicht auf ein antikes Muster zurück, sondern benutzte mit der Chevy-Chase-Strophe eine aus England importierte Form des Volkslieds. Die artifizielle Simplizität senkte die Rezeptionsanforderungen und steigerte das Inklusionspotential. Die Chevy-Chase-Strophe wirkte weit überzeugender als z. B. die in Alexandriner-Versen verfassten (mehr als berechtigen) Klagen über Das bedrängte Sachsen. Diese Formentscheidung implizierte, die Sprecherrolle mit einem Mann des einfachen Volkes zu besetzen. Mit der Erfindung des preußischen Grenadiers nahm Gleim den Trick vorweg, den Jahrzehnte später Walter Scott in seinen historischen Roman benutzen wird, nämlich die große Geschichte, die Geschichte der Großen, für ein ‚bürgerliches‘ Publikum aus der Perspektive eines mittleren Helden darzustellen.
Für Gleim ergab sich damit die Möglichkeit, seinen König zu glorifizieren. Sein Grenadier muss als freier Mann sprechen. Als Untertan Friedrichs II. verliert seine Lobrede an Glaubwürdigkeit. Genau diese Unabhängigkeit kann dem preußischen König nicht gefallen, mag sein Soldat ihn noch so sehr besingen. Diese Konstellation schuf ein patriotisches Identifikationspotential für ein breites, pro-preußisches Publikum, das die Gegenseite zu entsprechenden Reaktionen nötigte.
Gleim schien von seiner eigenen Erfindung derart fasziniert gewesen zu sein, dass er diese Rolle ausbuchstabierte, bis sie an ihre Grenzen geriet und diese überschritt. Er ließ nämlich den Grenadier in den diversen Schlachten kämpfen, sich emotional dabei erregen, bis er in eine Mordlust geriet, die ihn zum Unmenschen machte. Im Sieges-Lied der Preußen nach der Schlacht bei Lißa, den 5ten December 1757 merkte Gleim (bzw. sein Grenadier) das offensichtlich selber, als er nach den Versen: „Wir, Menschen, riefen im Gefecht, / Sterbt Hunde! Menschen zu“ die Kriegesmuse zum Schweigen aufforderte:
„Doch Kriegesmuse! Singe nicht
Die ganze Menschenschlacht;
Brich ab das schreckliche Gedicht,
und sag: Es wurde Nacht.“
Nach der Schlacht bei Zorndorf musste Gleim von Lessing ernstlich ermahnt werden, weil der Grenadier, auf Leichenbergen stehend, sein Wüten damit legitimierte, dass die „Callmucken und Cosacken“ Wilde wären, „die noch zu Menschen nicht geworden sind.“ Die Humanität gerät an ihre Grenzen. Mit der Durchsetzung von Menschheit als universaler Inklusionsformel wird der Gegner zum Unmenschen, der jetzt mit Vorliebe an den Grenzen der aufgeklärt-zivilisierten Welt verortet wird, der aber ebenso im Gebildeten steckt. Die Literatur macht es sichtbar. Als Akteur, auch dafür steht der preußische Grenadier, will man teilnehmen am Krieg. Mit ihrer Bereitschaft, für das Vaterland zu sterben – und zu töten, beansprucht die Literatur eine aktive Rolle in der Gesellschaft. Insofern gehört die Berliner Aufklärung zu den Gewinnern des Siebenjährigen Krieges. Nach dem Krieg avancierte die preußische Metropole zum kulturellen Zentrum im deutschsprachigen Raum. Für diesen Siegeszug brachte der preußische König kein Verständnis auf.