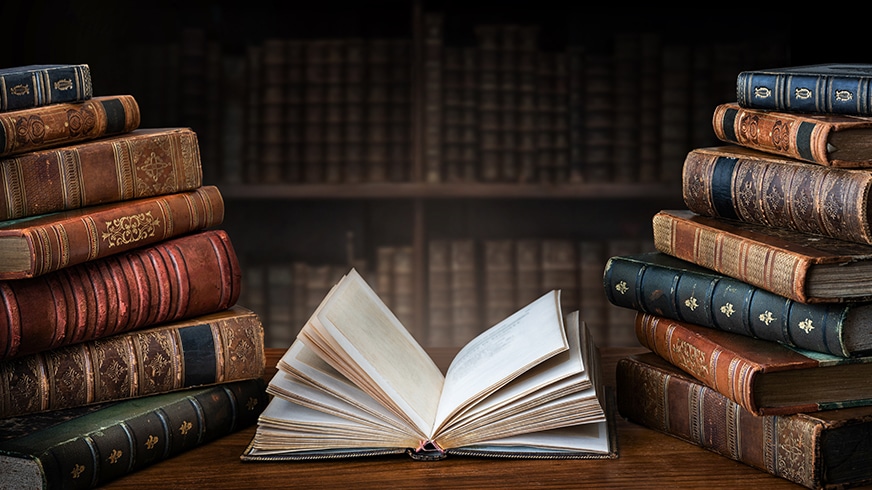I.
Am 24. August 410 war es dem terwingischen Goten Alarich gelungen, in das Zentrum der antiken Welt einzudringen; drei Tage plünderten seine Truppen die Tiberstadt, bevor sie sich am 27. August in Richtung Süden zurückzogen. Bis heute wird darüber gerätselt, wie es so weit hatte kommen können; bereits direkt nach dem Fall der Stadt begannen die Konflikte um Schuld und Interpretation des Unglücks zu toben. Es sind diese Auseinandersetzungen, die unsere Überlieferung dominieren, wohingegen das Ereignis selbst in den literarischen Zeugnissen kaum greifbar ist und auch der archäologische Befund bisher nur wenige Erkenntnisse ergeben hat.
Ein einziges Dokument eines Zeitzeugen ist erhalten geblieben, und dieses beschränkt sich auf einen kurzen Satz: Darin hielt der Prediger Pelagius, der sich 410 in Rom befand, später fest, dass sich „dasselbe Bild des Todes allen“ gezeigt habe. Demgegenüber bietet das Geschichtswerk des spanischen Presbyters Orosius – ein Zeitgenosse, der die Ereignisse jedoch nicht miterleben musste – gerade im zentralen Kapitel über die Einnahme der Stadt nicht viel mehr als eifrige Arbeit an einer frommen Legende: Die eingedrungenen Barbaren und die römische Bevölkerung hätten sich gemeinsam zu einer frommen Prozession formiert und hymnensingend liturgisches Gerät in Sicherheit gebracht, die Invasoren dabei in der Rolle der Beschirmer der verängstigten Römer.
Alarich selbst erscheint hier als Inbegriff des tugendhaft-frommen Eroberers, dem es in erster Linie um den Schutz der christlichen Bevölkerung gegangen sei, der „aus Gottesfurcht milde beim Morden“ agiert habe. Wie Zeitgenossen auf diese idealisierte Darstellung reagiert haben, wissen wir nicht. Viele von ihnen waren geflohen – einige Predigten, die Augustinus im nordafrikanischen Hippo gehalten hat, sprechen ganz direkt Flüchtlinge an und versuchen ihnen Halt in schweren Zeiten zu vermitteln. Es sind dies Texte, die veranschaulichen, wie der Kirchenvater um eine adäquate Deutung der Ereignisse rang. Das Resultat dieses Nachdenkens fügte sich ab 412/13 in Augustins theologischem Hauptwerk De civitate Dei (Die Gottesstadt) zusammen, das mit seiner radikalen Abwertung jeglicher Form irdischer Ordnung gegenüber der civitas Dei nicht nur einen tiefgründigen Weg wies, das Geschehen theologisch-philosophisch einzuordnen, sondern zugleich zu einer der Grundlagen der lateinischen Kirchengeschichte gerann.
Es ist diese Form der intellektuellen Auseinandersetzung, die Alarichs Handstreich zu einem epochalen Ereignis erhob – eine Auseinandersetzung, die sich um Fragen des Verstehens und Deutens, um Verantwortung und Schuld drehte und sich rasch auf einen Konflikt zwischen Christen und Altgläubigen hin zuspitzte. Sie wird bis heute fortgeführt und überwölbt dabei die Tatsache, dass die Eroberung der Stadt innerhalb der politischen Geschichte nicht mehr als eine Fußnote darstellte. Denn längst lagen die Brennpunkte des Geschehens an anderen Orten, und weder vermochte Alarich großen Nutzen aus dem Fall Roms zu ziehen noch konnte er damit die Herrschaft des Kaisers Honorius gefährden. Es war jedenfalls nicht der politische, sondern der ideelle Rang Roms, den Alarich aufs schwerste beschädigt hatte. Doch hatte dies überhaupt im Interesse des Eroberers liegen können?
In Alarich begegnen wir einer der Zentralgestalten der Völkerwanderungszeit – eine jener schillernden Einzelpersönlichkeiten, die in der Vergangenheit als Motoren jener grundlegenden Transformationsprozesse galten, die Antike und Mittelalter voneinander getrennt haben sollen. Und seit der Antike scheiden sich an der Bewertung Alarichs die Geister. Eine wirkmächtige Charakteristik verfasste der angeblich gotische Historiograph Jordanes um die Mitte des 6. Jahrhunderts – also schon anderthalb Jahrhunderte nach Alarichs Tod – in Konstantinopel: „Als aber Theodosius, der Liebhaber des Friedens und des Gotenvolkes, das Zeitliche gesegnet hatte […], wuchs bald der Verdruss der Goten […]; und weil sie fürchteten, dass in einem zu langen Frieden ihre Tapferkeit verloren gehen könnte, setzten sie Alarich zum König über sich, der aus dem zweiten vornehmen Hause der Goten nach den Amalern, nämlich dem der bewundernswerten Balthen stammte, die schon längst wegen ihrer Tüchtigkeit, nämlich ihrer Kühnheit, den Namen ‚Balthen‘ bei den Menschen erworben hatten, d.h. ‚die Kühnen‘.“
Ein Königssohn also, dessen Kühnheit bereits seinen Genen eingeschrieben gewesen sein soll und dessen Ruhm weithin strahlte – so weit, dass im 19. Jahrhundert Ferdinand Gregorovius (1821-1891) an den Ereignissen des Jahres 410 den Beginn des europäischen Mittelalters festmachen konnte, und noch Ludwig Schmidt (1862-1944), einer der großen Völkerwanderungshistoriker des 20. Jahrhunderts, vermeinte in Alarich „eine der kraftvollsten, sympathischsten Heldengestalten der germanischen Urzeit“ erkennen zu können.
Heute ist man weitaus vorsichtiger, und im Allgemeinen sprechen Zurückhaltung und Skepsis aus den jüngeren Beurteilungen des Terwingenführers. Ich selbst habe schon vor einiger Zeit auf die Zerrissenheit Alarichs im Spannungsfeld zwischen den divergierenden Interessen Roms – bei denen man noch einmal dezidiert zwischen dem westlichen und dem östlichen Kaiserhof unterscheiden muss – sowie seiner eigenen Leute hingewiesen und die daraus resultierende Dynamik in Richtung einer regelrechten Verzweiflungstat im August 410 gedeutet. Diese Interpretation möchte ich auch im Folgenden vertreten. Wer also war diese Figur, die auch in der aktuellen Forschung von der Anmutung des Tragischen umweht wird?
II.
Schon seine Herkunft liegt im Dunkel. Wenn Jordanes ihn im 6. Jahrhundert zu einem Hauptvertreter eines Königshauses der ‚Balthen‘ erhebt, so geschieht das vor allem zu dem Zweck, neben den ostgotischen Amalern auch bei den Westgoten eine tatkräftige und identitätsstiftende Königsfamilie zu konstruieren. Auch Claudians Behauptung, der Terwinge sei im Donaudelta auf der Insel Peuke geboren, reflektiert wohl eher die Vorstellung, dass eine Gestalt, die zeitlebens sichtbar zwischen der römischen und der barbarischen Sphäre pendelte, eben auch auf der Grenze zwischen beiden Sphären ihren Ursprung genommen haben müsse. Nichts spricht allerdings dagegen, Alarichs Herkunft zumindest grob im Gebiet der unteren Donau zu verorten – denn dies war tatsächlich die Heimat der gotischen Terwingen. Doch mehr wissen wir nicht.
Es gibt liebgewonnene Vorstellungen, von denen wir uns verabschieden sollten: so etwa der Gedanke, es habe in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts schon so etwas wie the Westgoten gegeben; stattdessen begegnen uns nach den Ereignissen 375-378 verschiedentlich kleinere Gruppen und Verbände unter unterschiedlichen Anführern, die nur lose zusammengefügt waren bzw. nebeneinander, mitunter auch gegeneinander agierten. Eine dieser Gruppen stand im letzten Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts unter der Führung Alarichs – und damit dies so bleiben konnte und seine Anhängerschaft weiter wuchs, musste dieser sich in spektakulären, Erfolg verheißenden Aktionen profilieren.
Zwei Aspekte wird man zu berücksichtigen haben: Zum einen die Tatsache, dass nach dem Tod Theodosius‘ I. im Jahr 395 kein Alleinerbe zur Verfügung stand, sondern die Herrschaft auf seine beiden Söhne Arkadios (etwa 17 Jahre alt, Osten) und Honorius (10 Jahre alt, Westen) überging – ein Jugendlicher und ein Kind, die sich sogleich in einem Netz aus konkurrierenden Beratern und wohlmeinenden Führungsfiguren verfingen, die eifersüchtig ihre jeweiligen Macht- und Einflusssphären auszubauen bestrebt waren. Dieser Prozess setzte unmittelbar nach dem Tod des Theodosius ein und führte dazu, dass die östliche und die westliche Reichsadministration sich nun rasch zu eigenständigen Machtzentren entwickelten, die bald auch in Konflikt miteinander gerieten und sich, zumal in den Jahren um 400, mehrfach in Richtung eines Bürgerkriegs bewegten. Osten und Westen begannen allmählich getrennte Wege zu gehen.
Der zweite Aspekt betrifft Alarich und seine Anhängerschaft direkt: Selbstverständlich galt der gotisch dominierte, faktisch wohl recht heterogene Verband als Barbarentruppe und wurde prinzipiell zunächst einmal zutiefst verachtet – wusste man doch aus jahrhundertealter Erfahrung, dass die Römer sich ungeachtet aller Rückschläge letztlich noch jedem Barbarenverband überlegen gezeigt hatten. Andererseits aber litt das Reich – zumal nach der schweren Niederlage gegen die Goten im Jahr 378 und seit dem ersten Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts aufgrund zunehmender Barbareneinfälle und Bürgerkriege – unter chronischem Soldatenmangel. Selbst ein Barbarenhaufen wie derjenige Alarichs stellte vor diesem Hintergrund ein Wertobjekt dar, das man nicht einfach vernichten durfte, sondern für je eigene Zwecke zu instrumentalisieren hatte.
Alarich und sein Heerhaufen weckten also Begehrlichkeiten, einerseits in Konstantinopel, andererseits aber auch bei Stilicho, dem General, der für den unmündigen Honorius im Westen die Amtsgeschäfte führte und sich einer wachsenden Anzahl an Krisenherden gegenübersah, die militärisches Eingreifen erforderten und Ressourcen verschlangen. Das dürfte der Grund dafür sein, dass Stilicho den Alarich-Verband insgesamt fünfmal in eine aussichtslose Lage manövriert, aber zum Unverständnis so mancher Zeitgenossen stets verschont hatte. Stattdessen entwickelte sich Stilicho im Verlauf der Jahre zu Alarichs wichtigstem Ansprechpartner im römischen Westen; und es war dementsprechend seine Ermordung im Jahr 408, die letztlich auch den Untergang Alarichs einläutete.
Erstmals begegnet uns der Terwingenführer, als er sich 391 plündernd durch den Balkan bewegte. Dies war damals unruhiges Terrain, und aus diesem Grund begab sich Kaiser Theodosius persönlich an den Krisenherd – auf keinen Fall sollten sich Zustände wie im Jahr 378 wiederholen. An der Maritza wollte er den Aufrührern entgegentreten und entging wohl nur mit knapper Not einem Desaster. Erst Stilicho gelang es 392, Alarich erstmals zum Abschluss eines Vertrages zu zwingen.
Er muss ihn dabei eng an Rom gebunden haben, denn 394 agierte der Gote mit seinen Truppen als Unterfeldheer im Heer des Theodosius, das am Frigidus (im heutigen Slowenien) dem Usurpator Eugenius entgegentrat. Theodosius erkaufte seinen Sieg damals mit einem gewaltigen, vermutlich kalkulierten Blutzoll, den seine gotischen Einheiten zu entrichten hatten, die bei dieser Gelegenheit zugleich auf ein ungefährliches Maß reduziert wurden. Das dürfte Unruhe in Alarichs Verband ausgelöst haben, die sich zu heftigem Groll auswuchs, als nach Theodosius‘ Tod (395) Stilicho sämtliche Auxiliar-Einheiten entließ und Alarichs Verband damit die wirtschaftliche Grundlage entzog.
Schon jetzt zeigt sich, dass Alarich niemals selbst das Heft des Handelns vollständig in seinen Händen hielt; denn wollte er verhindern, dass sein Verband sich auflöste und seine Anhänger sich auf die Suche nach lukrativeren Bedingungen begaben, so musste er in die Offensive gehen. Einem barbarischen Truppenführer blieb in dieser Situation letztlich nur eine Möglichkeit: durch schmerzhafte Plünderungen römischer Gebiete den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Genau dies geschah. Und während erstmals größere hunnische Gruppen die Donau überschritten und in Thrakien eindrangen, während weitere Hunnenverbände über die Kaukasuspässe im römischen Osten einfielen und entsetzliche Verheerungen anrichteten, verließ Alarich auf Weisung Stilichos Italien und bewegte sich donauabwärts in Richtung Thrakien.
In Konstantinopel, das den Plünder-Verband langsam näher heranrücken sah, bekam man kalte Füße – Alarichs Kalkül ging also auf: Rufinos, damals der mächtigste Mann am Hof, bot dem terwingischen Gotten ein neues Abkommen an. Möglicherweise beinhaltete es bereits seine Ernennung zum magister militum per Illyricum, d.h. zu einem regulären römischen General. Alarich jedenfalls war vorerst ruhiggestellt und zog sich nach Illyricum zurück – ein geschickter Schachzug der oströmischen Diplomatie, denn die dadurch in Mitleidenschaft gezogenen Gebiete wurden von der weströmischen Regierung beansprucht.
Hier können wir erstmals ein Leitmotiv beobachten, das sich fortan durch die weitere Laufbahn Alarichs ziehen wird: Er geriet zwischen die Fronten des sich zuspitzenden Konfliktes zwischen den beiden Reichsteilen, ohne die erforderliche Autonomie entwickeln zu können, sich daraus zu befreien. Seine einzigen Waffen blieben Plünderung und Verheerung.
Die weitere Geschichte Alarichs vollzog sich in drei Phasen: Zunächst versuchte er auf dem Balkan bzw. in Griechenland seine Position zu behaupten; im Jahr 401 zog er nach Westen und drang ein erstes Mal in Italien ein, bevor dann in den Jahren 408-410 sich der Kampf um Rom zuspitzte. Werfen wir zunächst einen Blick auf die erste Phase.
III.
Dem zwischen Alarich und Rufinos geschlossenen Vertrag war keine lange Dauer beschieden, denn die Verheerungen, mit denen der weiterhin mobile Verband Makedonien und Nordgriechenland überzog, konnten die weströmische Führung nicht ungerührt lassen, da diese ja selbst die betroffenen Gebiete ihrem Territorium zurechnete. Folgerichtig begab sich Stilicho 395 nach Thessalien und bezog bei Larissa Stellung gegen Alarichs Heer. Doch musste er sich auf Befehl des Ostkaisers Arkadios zurückziehen und die Kontingente Konstantinopels (die sich seit dem Tod des Theodosius in Mailand unter Kontrolle des westlichen Hofes befunden hatten) in ihre Heimat entlassen.
Möglicherweise geschah dies nicht ganz uneigennützig. Denn als die Soldaten in Konstantinopel eintrafen, zerfleischten sie vor den Augen des hilflosen Arkadios erst einmal Stilichos Gegenspieler im Osten, den mächtigen Rufinos – für Alarich eine Katastrophe. Denn mit ihm hatte der Gote seinen unmittelbaren Ansprechpartner verloren; einmal mehr hing er in der Luft und war ein Opfer der innerrömischen Konflikte geworden; und einmal mehr verblieb ihm nur ein Mittel, um seine Position neu zu festigen: Die Plünderung. Und so sammelte er seine Leute und drang erstmals in Zentralgriechenland ein. Konstantinopel vermochte keine Hilfe zu entsenden, da sämtliche Reserven im Kampf gegen im Osten eingefallene Hunnen benötigt wurden.
Einmal mehr sah sich in dieser Situation Stilicho zum Eingreifen veranlasst. Wohlwissend, dass er auf oströmischem Territorium intervenierte, schloss er Alarich im Frühjahr 397 im Nordwesten der Peloponnes ein. Wir wissen nicht, was auf den dadurch erzwungenen Verhandlungen abgesprochen wurde; Alarich jedoch durfte abermals abziehen – vermutlich deshalb, weil Stilicho seine Aufmerksamkeit inzwischen einem anderen Krisenherd zuwenden musste: Unter dem Statthalter Gildo war in Afrika ein Aufstand ausgebrochen.
Und wieder wölbte sich der Dauerkonflikt zwischen den beiden Kaiserhöfen über die Geschehnisse. Denn in Konstantinopel konnte man zwar einerseits erleichtert aufatmen ob des erzwungenen Rückzugs Alarichs; andererseits bot gerade dieser die Gelegenheit, Stilicho direkt zu attackieren, da er den Gegner nicht ausgeschaltet hatte: Und so wertete man die Entscheidung des Generals kurzerhand als Hochverrat und erklärte ihn zum Staatsfeind (hostis).
Während sich im Westen dadurch eine veritable Krise zusammenbraute, tappte Alarich weiterhin im politischen Niemandsland umher. Seine Lage gestaltete sich zunehmend prekär, und einmal mehr sah er sich genötigt, im Rahmen seiner Möglichkeiten ein Zeichen zu setzen: Dieses Mal erkor er die nordwestgriechische Landschaft Epiros zum Ziel seiner Brandschatzungen und erzwang dadurch einen weiteren Vertrag. Eutropios, der Oberkammerherr des Arkadios und inzwischen einflussreichster Mann am Kaiserhof, bestätigte Alarich in seinem Amt als magister militum per Illyricum und wies den Goten Wohnsitze in Makedonien zu. Das war ein kluger Schachzug, denn auf diese Weise gewann Konstantinopel einen sehr kraftvollen Puffer gegen weitere Gebietsansprüche aus dem Westen. Und tatsächlich kehrte nun für einige Jahre Ruhe ein. Erst 401 hören wir wieder von Alarich.
Warum der Gotenverband sich damals erneut in Bewegung setzte und dieses Mal den Weg nach Westen suchte, wird diskutiert. Von besonderer Bedeutung dürfte neben wachsendem Druck aufgrund der hunnischen Westbewegung von den Schwarzmeersteppen Richtung unterer Donau, möglichen Versorgungsproblemen, dem Bedürfnis nach frischer Beute und einem damit zusammenhängenden Bemühen Alarichs, seine Führungsposition durch Leistung und Erfolge zu konsolidieren, vornehmlich der Umstand gewesen sein, dass sich in der östlichen Reichshälfte die Stimmung gegenüber Barbaren radikal verschlechtert hatte; dies führte inzwischen auch zu politischen Aktionen, die bedrohliche Wirkungen zu entfalten vermochten.
Denn zunehmend avancierte die Politik gegenüber den Barbaren zu einem gefährlichen Instrument innerhalb der weiterhin anhaltenden Machtkämpfe im Umfeld des schwachen Kaisers Arkadios. Im Jahr 400 kam es in Konstantinopel zu einem grausamen Massaker an dem gotisch-stämmigen Offizier Gainas und seinen in römischen Diensten stehenden vorwiegend gotischen Truppen. Lynchmorde und Pogrome wurden aber auch aus anderen Orten des Ostens gemeldet. Diese Entwicklungen dürfte Alarich mit Sorgenfalten beobachtet haben: Für mehrheitlich barbarische Verbände wurde es allmählich ungemütlich.
So setzte sich der Gotenverband also im Herbst des Jahres 401 wieder in Bewegung und suchte sein Glück im römischen Westen. Ohne auf größeren Widerstand zu stoßen, zog er über den Balkan und die Julischen Alpen und stand bereits am 18. November in Italien. Auch wenn der Versuch, das strategisch wichtige Aquileia einzunehmen, fehlschlug, verheerten die Goten im Winter 401/02 Venetien. Und als sich im Frühjahr 402 der Belagerungsring um die Kaiserresidenz Mailand schloss, dürfte auch der letzte Zeitgenosse die Bedrohlichkeit der Lage realisiert haben.
Kaiser Honorius spielte mit dem Gedanken, sich nach Gallien abzusetzen; doch wich die Regierung stattdessen in das günstig gelegene und gut befestigte Ravenna aus, das fortan Hauptsitz der weströmischen Kaiser bleiben sollte. Ansonsten: Panik allerorten. Viele sahen das unmittelbare Ende der Welt vor sich. In Rom begann man hektisch mit der Ausbesserung der verkommenen Stadtmauern. Aber auf Stilicho war Verlass: Mit rasch rekrutierten Entsatz-Truppen brach er Alarichs Belagerungsring um Mailand auf und jagte die Goten zunächst einmal auseinander. In zwei nachfolgenden Schlachten bei Pollentia (Pollenzo, Piemont), wo der Verband hohe Verluste erlitt und nicht zuletzt Alarichs Familie sowie reiches Plünderungsgut in römische Hände fielen, und – im Sommer 402 – bei Verona wurden die Goten geschlagen.
Alarichs Lage war hoffnungslos; eingeschlossen von Stilichos Heer, setzten Seuchen seinen Kämpfern zu, Unzufriedenheit und massenhafte Desertionen waren die Folge. Es schien, als hätten Alarichs Leute den Glauben an ihren Anführer verloren. Aber zum fünften Mal verschonte Stilicho seinen Lieblingsgegner und ermöglichte ihm, sich auf den Balkan abzusetzen, vermutlich in Richtung Pannonien, wo der Verband einige Jahre benötigte, um sich zu regenerieren. Der Kontakt zu Stilicho blieb allerdings bestehen, und im Jahr 405 beförderte der höchste General des Westens den Goten erneut zum magister militum per Illyricum – ein demonstrativer Eingriff in die Souveränität des Ostens und eigentlich nur dadurch erklärbar, dass Stilicho nun offensiv den Konflikt mit Konstantinopel suchte.
Die nachfolgenden Ereignisse indes machten jegliches Planen unmittelbar zur Makulatur: Ein gewaltiger, bis dahin unbekannter Barbarenverband unter Führung des Radagaisus tauchte wie aus dem Nichts auf und „überschwemmte“ („inundavit“ heißt es in den Quellen) Italien. Es handelte sich dabei wohl um eine mehrheitlich aus Goten, aber auch versprengten anderen Barbaren, aus Provinzialen, Sklaven und desertierten Soldaten bestehende multiethnische Gruppe, die ebenfalls dem Vordringen der Hunnen ausgewichen sein dürfte. Stilicho musste umgehend sämtliche Reserven zusammenkratzen, die ihm noch verblieben waren. Doch er siegte bei Fiesole, und der Verband der Invasoren, der eine außergewöhnliche Größe erreicht haben muss, zerfiel; die Massen der Gefangenen ließen angeblich den italischen Sklavenmarkt zusammenbrechen. Tausende Radagaisus-Kämpfer wurden in Stilichos Heer integriert. Andere jedoch setzten sich ab und schlossen sich Alarich an, dessen Anhängerschaft infolge dieser Ereignisse allmählich wieder anzuschwellen begann.
IV.
Auch wenn man den Radagaisus-Albtraum mit Mühe überstanden hatte, sollte sich keine Ruhe einstellen. Denn in der Silvesternacht 406/07 überschritt ein offenbar ebenfalls gewaltiges Heer, bestehend aus plündernden Gruppen ganz unterschiedlicher Herkunft, den Rhein und begann Gallien und ab 409 auch die Iberische Halbinsel zu verheeren; dieser Barbarenzug verband sich mit einer Serie von Usurpationen in Britannien. Innerhalb weniger Monate drohte die weströmische Regierung die Kontrolle über große Teile ihrer Territorien zu verlieren. Der Auflösungsprozess des Weströmischen Reiches hatte nun sichtbare Gestalt gewonnen.
Stilicho sah sich gezwungen, eventuelle Pläne mit Blick auf den Osten aufzugeben. Bemühungen, die Integrität des Reiches halbwegs wiederherzustellen, ja dessen Fortexistenz zu behaupten, hatten nun unmittelbaren Vorrang, und damit änderte sich erneut die Rolle Alarichs: Seine Truppen, so Stilichos Kalkül, sollten ihren Beitrag dazu leisten, die Ordnung im Imperium Romanum wiederherzustellen. Zu keinem Zeitpunkt dürfte der Alarich-Verband für Stilicho wichtiger gewesen sein als in der chaotischen Situation nach dem Rheinübergang der Barbaren. Das aber erhöhte Alarichs Preis beträchtlich.
Ein lukratives Abkommen mit der weströmischen Regierung, die angesichts der bedrohlichen Lage kaum Handlungsspielräume besaß, leuchtete am Horizont auf. Stilicho jedoch verlor wertvolle Zeit damit, den Kaiser und seine Berater sowie die römischen Senatoren von der Notwendigkeit zu überzeugen, die selbstbewusste Barbarentruppe zu hohen Kosten einzukaufen. Und so entschloss sich Alarich, dem Entscheidungsprozess aufzuhelfen, indem er 408 in Noricum eindrang und sich bedrohlich nah vor den Grenzen Italiens positionierte. 4000 Goldpfund (= 288.000 solidi) verlangte er nun dafür, einfach nur stillzuhalten.
Die Empörung unter den italischen Eliten wuchs, und man machte nun Stilicho als Vandalensohn und Halbbarbaren verantwortlich für eine angeblich barbarenfreundliche Politik, die das Imperium ausverkaufe. Ambitionierte Figuren im Umfeld des Honorius nutzten die Gelegenheit, um sich in Stellung zu bringen. Der Kaiser konnte nicht verhindern, dass sein bester und vermutlich auch loyalster Feldherr am 22. August 408 ermordet wurde.
Alarich hatte damit einmal mehr einen berechenbaren und zuverlässigen Verhandlungspartner verloren, und die neue Führung in Ravenna sah nun keinen Anlass mehr für weitere Verhandlungen mit dem Goten; man ging davon aus, weiterhin stark genug zu sein, um die anstehenden Probleme militärisch lösen zu können – eine verhängnisvolle Fehleinschätzung.
Was also tun? Plündern und Drohen nach dem bewährten Muster. Alarich marschierte also in Italien ein und stand bereits im Oktober vor Rom. Sein Verband wuchs derweil zu bedrohlicher Größe an, weil Sklaven und Unzufriedene jeglicher Couleur sich ihm anschlossen; das erhöhte umso mehr den Erfolgsdruck.
Und während in der Ewigen Stadt Hunger und Seuchen um sich griffen, fiel dem Senat nichts Originelleres ein, als auch noch Stilichos Witwe Serena demonstrativ zu ermorden, was Alarich indes kaum beeindruckte. Wie groß die Panik der Römer war, zeigt sich daran, dass Bischof Innozenz I. sogar die Durchführung paganer Riten zur Rettung der Stadt tolerierte. Als auch dies nichts an der Gesamtlage änderte, nahm der Senat endlich Verhandlungen auf und erwirkte ein Abkommen, mit dem Rom sich freikaufen konnte. Der Preis war erwartet hoch: 5000 Pfund Gold, 30.000 Pfund Silber, 4000 Seidengewänder und 3000 purpurfarbene Felle sowie 3000 Pfund Pfeffer – finanziert aus senatorischen Vermögen und dem Einschmelzen wertvoller Kunstgegenstände. Alarich hingegen zog sich vorerst nach Etrurien zurück. Er hatte reiche Beute gemacht, aber im Ergebnis nichts gewonnen. Denn was sollten seine zahllosen Anhänger, die ihrerseits zu hungern drohten, mit purpurfarbenen Fellen und Seidengewändern anfangen?
Alarich setzte weiter auf Verhandlungen, und römische Senatoren versuchten nun, in seinem Sinne beim Kaiser zu vermitteln. Der Gote beanspruchte Geldzahlungen und Versorgungsgüter für seine Leute, darüber hinaus Siedlungsland in Venetien, Noricum und Dalmatien, ferner Stilichos Position als ranghöchster Feldherr des Reiches. Zudem belasteten die Eifersüchteleien der Amtsträger im Umfeld des Kaisers die Gespräche, und die Hardliner setzten sich durch – auch dann noch, als Alarich sich zu Konzessionen bereitfand und nur noch Getreide sowie Siedlungsland in Noricum verlangte.
Und wieder zeigte sich, dass die Handlungsmöglichkeiten begrenzt waren: Mit Plünderungen und Verheerungen ließ sich kein allzu großer Druck mehr aufbauen, da die Ressourcen Italiens inzwischen aufgebraucht waren. Also trat Rom aufgrund seiner hohen symbolischen Bedeutung erneut in den Mittelpunkt des Geschehens. Alarich erhob jetzt den altgläubigen Senator Priscus Attalus zum Kaiser und versuchte dadurch Honorius in die Enge zu treiben. Doch der vermeintliche Marionettenkaiser schmiedete überraschend eigene Pläne. Als er dann an Honorius die hochmütige Forderung, umgehend abzudanken, richtete, diskreditierte er damit auch Alarich für weitere Verhandlungen.
In dieser verfahrenen Situation trafen unerwartet 4000 Soldaten aus dem Osten ein und übernahmen die Verteidigung Ravennas; nun musste Alarich handeln: Er setzte den unglücklichen Priscus kurzerhand wieder ab, behielt ihn aber unversehrt in seinem Gefolge. Jetzt hätte der Weg für eine Wiederaufnahme der Gespräche offen gestanden; aber Alarichs alter Rivale Sarus verhinderte alles Weitere, indem er den Gotenverband überraschend attackierte und damit jegliche Verhandlungsbereitschaft zerstörte.
Und einmal mehr stellte sich die Frage: Was tun? Alarich, der angesichts des mittlerweile monatelangen Stillstands selbst unter massiven Druck seitens der eigenen Anhänger geriet, war geradezu gezwungen, in spektakulärer Weise zu reagieren, sich selbst als erfolgreicher Heerführer zu inszenieren und vor allem seinen Leuten endlich wieder materielle Güter in Aussicht zu stellen, nachdem sämtliche Hoffnungen auf einen neuen Ansiedlungsvertrag sich nun erst einmal wieder zerschlagen hatten. Am 24. August 410 zogen seine Truppen daher in Rom ein.
Was in den drei Tagen der Plünderung tatsächlich geschah, wissen wir nicht. Ich möchte mich daher an dieser Stelle auch nicht weiter mit Spekulationen über den Gang des Eroberungsgeschehens aufhalten; ich möchte nicht weiter auf die Verzeichnung des Eroberers als gutmütig-milder Beschirmer der Stadt eingehen, der Kirchen geschont und sich beim Brandschatzen maßvoll geriert haben soll; ich lasse zudem die nachfolgenden Debatten über Schuld und Verantwortung aus, die literarische Schöpfungen von dauerhafter Geltung hervorgebracht haben (Orosius, Augustinus, Rutilius Namatianus); und ich verzichte darauf, auf die Transformation der Romidee im Kontext des Geschehens einzugehen, auf die Loslösung der realen Stadt von ihrer symbolischen Bedeutung, die ihr bis heute erhalten geblieben ist. Stattdessen werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Geschehen nach Alarichs Abzug am 27. August und diskutieren abschließend die Frage, warum ich in dem Terwingenführer letztlich einen Getriebenen sehe.
V.
Es ist wohl nicht gänzlich verfehlt, in der Einnahme Roms auch ein Eingeständnis des Scheiterns zu sehen. Denn Alarich musste sich bewusst sein, dass er mit dem gewaltsamen Zugriff auf die Urbs jegliche Aussicht auf eine Wiederaufnahme von Verhandlungen zunichtemachte; aber er ging diesen Schritt dennoch, und dies zeigt, unter welch enormem Druck er stand und wie gering der Handlungsspielraum war, der sich ihm noch eröffnete. Keines seiner langfristigen Ziele hatte er bis dahin erreichen können, weder ein hohes Amt noch sichere Ansiedlungsgebiete innerhalb des Römischen Reiches; so reichhaltig die Beute auch war, eine Perspektive eröffnete sie nicht.
Unter immensem Erwartungsdruck seiner Anhänger agierend, war Alarich geradezu in die Urbs hineingepresst worden und hatte sich durch seinen Handstreich endgültig jeder weiteren Verhandlungsbasis benommen. Vielleicht hatte er den strategischen Wert Roms auch schlicht überschätzt. Denn längst lagen die wahren politischen Brennpunkte, wie eingangs schon angedeutet, an ganz anderen Orten – in Gallien vor allem, zudem in Britannien und Hispanien, aber auch in Afrika und natürlich auf dem Balkan. Rom aber war für die Regierung temporär verzichtbar.
Und Alarich hatte nun andere Probleme: Seine Leute mussten weiterhin versorgt werden, und Italien war ausgelaugt. Einzig das kornreiche Sizilien oder gar die wohlhabenden Weiten Nordafrikas versprachen jetzt noch kurzfristige Hilfe sowie Gewinne auf längere Sicht. Und so brachen die Goten bis zur Straße von Messina durch – und scheiterten an den Herausforderungen ihrer Überquerung. Man wandte sich nun zunächst zurück nach Norden und bezog angesichts der einsetzenden Winterkälte in Süditalien Quartier. Da erkrankte Alarich und verstarb unerwartet noch im Jahr seines größten militärischen Triumphes in Cosentia (heute Cosenza).
Das ist die Geschichte Alarichs, einer der zentralen Identifikationsgestalten späterer Generationen, die teils neidisch, teils nostalgisch auf den Goten als Heroen der Völkerwanderungszeit sowie einer „deutschen Frühgeschichte“, wie manche die Zeit auch bezeichneten, zurückblickten. Bei dieser Verklärung wurde allerdings füglich übersehen, dass die Einnahme Roms nur in sehr oberflächlicher Betrachtung einen außerordentlichen politischen Erfolg darstellte. Faktisch bedeutete sie, wie angedeutet, eine politische Bankrotterklärung.
Überhaupt nimmt sich Alarichs Bilanz auf den ersten Blick außerordentlich bescheiden aus: Fast jede wichtige Schlacht hat er verloren, allein die Einnahme Roms ist ihm gelungen; zuletzt aber hinterließ er einen ziellos umherirrenden Verband. Bereits für die meisten Zeitgenossen stellte der homöische Christ offenbar vor allem ein Rätsel dar; dafür steht etwa Orosius mit seinem höchst inkonsistenten Alarich-Bild, wenn er den Goten ebenso als Beschützer der Römer wie als Feind des Imperiums imaginiert. Andernorts findet sich hingegen die Behauptung, der Gotenführer sei von einem Dämon gegen Rom getrieben worden, und die meisten Äußerungen ergehen sich in Polemik und Hasstiraden, derart mit konventionellen Barbarenstereotypen aufgeschwemmt, dass sie keinerlei historischen Wert beanspruchen können.
Was wir unter all dem aber noch erkennen können ist, dass Alarich ein besonderes Charisma besessen haben muss. Darüber erfahren wir aus den schriftlichen Zeugnissen allerdings kaum etwas, und dies gilt für seine Persönlichkeit insgesamt. Doch ist offenkundig, dass nur eine Figur von besonderer Durchsetzungsstärke in der Lage gewesen sein kann, in den Wirren der Jahre um 400 trotz wiederholter Rückschläge, trotz teilweise exzeptioneller Verluste und in Konkurrenz zu möglichen Alternativen wie Radagaisus oder Sarus den vielfach geplagten Verband nicht nur zusammenzuhalten, sondern auch noch kontinuierlich zu erweitern.
Aber mit welchen Mitteln? Wodurch wurde die Kohäsion dieses Verbandes überhaupt gewährleistet? Und wie hat man sich diesen konkret vorzustellen? Spätestens seit dem Jahr 395 führte Alarich den Königstitel – genauer gesagt: einen Titel, den lateinische Autoren mit dem Terminus rex wiedergeben. Das mag sogar der tatsächlichen Bezeichnung, die Alarich sich zugelegt hatte, entsprochen haben, denn er hat den Titel auf dem Boden des Imperium Romanum erworben und musste ihn in irgendeiner Weise verständlich gegenüber den Römern kommunizieren. Letzteres war mit einem etablierten antiken Terminus natürlich leichter als mit einem weithin unbekannten gotischen Wort.
Zwar wurde darüber spekuliert, in welcher Beziehung der lateinische rex zu einem gotisch-terwingischen reiks gestanden haben mag, doch bleibt hier vieles im Ungewissen. Wir wissen auch nicht, welche konkreten Kompetenzen Alarich dadurch erworben hatte, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt als rex auftrat. Und er war auch nicht der einzige gotische rex seiner Zeit; Gestalten wie Radagaisus oder gar Sarus erscheinen in unseren Zeugnissen mit derselben Bezeichnung, aber Alarich muss ihnen doch etwas vorausgehabt haben: Er wurde jedenfalls – dies zeigt das Zeugnis des Olympiodoros – in einer Position wahrgenommen, die jene anderer reges deutlich überragt haben muss.
In der Erhebung Alarichs zum König wird man ein wichtiges Element der (west-)gotischen Ethnogenese vermuten können. Der Zusammenhalt der Anhängerschaft Alarichs muss erheblich dadurch gestärkt worden sein, dass die Mitglieder der Gruppe nun einen Identifikationspol erhielten, der eine institutionelle Fundierung besaß; dass diese Institutionalisierung bereits unter Alarich einen recht hohen Grad erreicht haben muss, geht aus der Weitergabe des Königstitels an seinen Nachfolger Athaulf hervor; anders als im Fall des Radagaisus zerfiel der Verband nämlich nicht nach dem Ende des Anführers, der folglich bereits zu Lebzeiten mehr war als ein ephemerer warlord oder Heerkönig; Charisma und institutionelle Verankerung als Monarch flossen somit in der Person Alarichs zusammen. Dagegen gibt es keinerlei Anhaltspunkte für die These, dass Alarich das Königtum vor allem deshalb für sich habe beanspruchen können, weil er der Familie der Balthen entstammte; wahrscheinlicher ist eher der umgekehrte Prozess: Erst durch die Prominenz Alarichs dürfte seine Familie einen besonderen Rang erhalten haben.
Alarichs Königtum hatte wohl nur noch wenig mit der Stellung der terwingischen reiks, Unterführer oder Richter, als eine Art zentraler Anführer gemein. Seine Führungsposition hatte sich konsequent und ausschließlich auf römischem Territorium ausgebildet, und sein Verband entwickelte sich ebenfalls auf dem Gebiet römischer Provinzen von einem Hilfstruppenkontingent unter Theodosius I. hin zu einer bunt gemischten Großgruppe in den Jahren bis 410. Ihr gehörten sicherlich nicht nur Goten, sondern auch Barbaren vielfältiger Herkunft sowie römische Provinzialen, entlaufene Sklaven usw. an. Zosimos zufolge soll der Verband zuletzt eine Größe von 40.000 Angehörigen erreicht haben, über deren soziale Zusammensetzung wir indes nichts wissen.
Jene, die 410 die Ewige Stadt stürmten, waren jedenfalls mitnichten sämtlich Goten – und es waren vor allem auch nicht nur kriegführende Männer: Aus der römischen Hilfstruppe hatte sich allmählich eine gens bzw. natio entwickelt, eine heterogene Identitätsgruppe, in der unsere modernen Kategorien Armee und Volk zusammenflossen und die ihre innere Kohärenz vornehmlich durch die Ausrichtung auf den König gewann. Dessen Position war immerhin derart gefestigt, dass man ihm auch Niederlagen, Misserfolge und eine allgemeine Perspektivlosigkeit – zumindest bis zum August 410 – nachsah. Darüber hinaus könnten auch weiche Faktoren wie die gotische Sprache und die homöische Liturgie auf Grundlage der Wulfila-Bibel eine identitätsstiftende Wirkung entfaltet haben, vielleicht sogar die Tatsache, dass die Römer in Alarichs Anhängern die direkten Nachfahren jener Terwingen sahen, die 376 die Donau überschritten hatten; möglicherweise hatte sich Alarichs Gefolge diese Sichtweise zu eigen gemacht und daraus ein weiteres Argument zur Traditionsbildung und Förderung des Zusammenhalts geschmiedet.
Um es noch einmal zu betonen: Dieser Prozess vollzog sich vollständig auf römischem Boden. Es ist daher grundsätzlich verfehlt, den Alarich-Verband als Musterbeispiel für (ein-)wandernde Völker anzusehen – ganz im Gegenteil: Ohne die Mitwirkung Roms hätte sich das, was Herwig Wolfram als die „werdenden Westgoten“ bezeichnet hat, nie entwickeln können. Aus diesem Grund wird man auch der Königserhebung Alarichs eine doppelte Bedeutung zuweisen müssen: Sie festigte den Verband nach innen, symbolisierte aber auch seine Geschlossenheit nach außen. Komplementär dazu verhält sich Alarichs permanenter Anspruch auf eine hohe Position innerhalb der römischen Militärhierarchie: Ebenso wie das Königtum bewirkte das Amt des magister militum eine institutionelle Verfestigung und stärkte somit die Kohäsion der Gemeinschaft.
Gleichzeitig konnte für deren Mitglieder ein Status innerhalb der römischen Welt definiert werden, denn dort bewegte sich ja der Verband: Alarichs Leute wurden nun wie reguläre Soldaten bezahlt, und der Anführer selbst erhielt Zugang zur höchsten politischen Bühne des Reiches. Königtum und magisterium militum korrespondierten jedenfalls, ja bedingten einander und konstituierten in ihrer Verzahnung den besonderen Weg, den Alarich im Unterschied zu anderen Barbarenführern eingeschlagen hatte: Er hatte sich nicht einseitig für den Dienst im Imperium Romanum entschieden und dabei den Verzicht auf eine Führungsposition innerhalb eines barbarischen Kontextes in Kauf genommen; er hatte sich aber auch nicht mit seinem Barbarenverband vollständig außerhalb der römischen Strukturen verankert und das Reich lediglich als Reservoir für Plünderungen betrachtet.
Alarichs Position changierte vielmehr zwischen den Strukturen des Imperium Romanum (das er nie verließ) und der Welt des Barbaricum (die er wohl nie betrat). Daraus gewann sein Verband eine bis dahin unbekannte Geschlossenheit und innere Kohäsionskraft, insbesondere mit der Fundierung auf dem Amt des magister militum darüber hinaus auch eine Vorbildwirkung für spätere Akteure; dem gotischen König selbst erwuchsen daraus indes zugleich die Ursachen für sein persönliches Scheitern.
Dieses Scheitern resultierte konkret daraus, dass es Alarich bis zuletzt nicht gelang, sich aus der Abhängigkeit vom Römischen Reich und seinen Autoritäten zu emanzipieren, in die er sich selbst dadurch begeben hatte, dass er sein und seines Verbandes Schicksal an die Erfüllung seiner Forderungen geknüpft hatte. Bis zuletzt blieb ihm die nötige Autonomie versagt, um nach einer möglichen Landnahme ein auch politisch unabhängiges und militärisch hinreichend abgesichertes Gebilde aufzubauen. Selbst im römischen Westen, der im ersten Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts eine höchst turbulente Phase durchmachte, hatten sich die Strukturen noch nicht so weit gelockert, dass die Etablierung eines unabhängigen gotischen regnum möglich gewesen wäre.
Stattdessen wurde Alarich immer wieder zum Spielball der widerstreitenden Machtinteressen politischer Amtsträger im Osten und im Westen degradiert. Dadurch wurde sein Verband zwar mehrfach vor der Vernichtung bewahrt (weil man sein militärisches Potential benötigte), aber er verblieb umso mehr in wechselnden Abhängigkeiten, und selbst die Eroberung Roms sollte an dieser Situation zunächst nichts ändern. Alarich wurde auf diese Weise zum ersten prominenten Opfer des sich zuspitzenden Entfremdungsprozesses zwischen dem römischen Westen und dem römischen Osten; nicht nur sein Pendeln zwischen gentilen und römischen Strukturen wurde ihm also zum Verhängnis, sondern vor allem sein innerrömisches Changieren zwischen den Reichsteilen, seine mangelnde interne Festlegung.
So kann man abschließend resümieren, dass ausgerechnet Alarich, der vielfach als Inbegriff des germanischen Heldenkönigs der Völkerwanderungszeit, ja sogar als früher Exponent des „Gedanken[s] eines römischen Reiches deutscher Nation“ gilt, in jeder Hinsicht ein Produkt römischer Politik und römischer Strukturen war (auch wenn er sie partiell aufbrach) – beginnend mit seiner Funktion als untergeordneter Anführer eines barbarischen Truppenkontingents über seine zahllosen Anläufe, eine feste Einbindung in die römische Militärhierarchie zu erreichen, bis hin zu seiner Einsetzung eines römischen Usurpators und zum Ausspielen seiner letzten, allerdings weit überschätzten Trumpfkarte in Gestalt der Ewigen Stadt Rom.