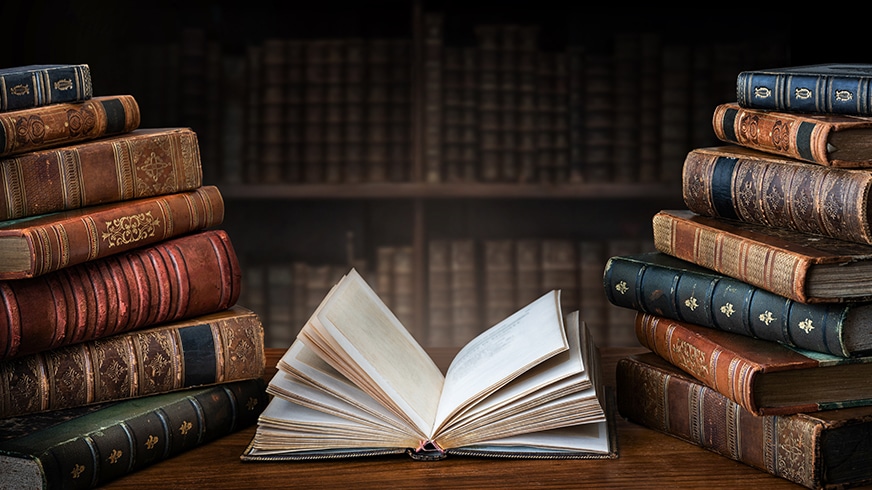Einführung: Wieso heißt Theoderich „der Große“?
Der gotische König Theoderich, der Sohn des Thiudimir, trägt hierzulande den Beinamen „der Große“. Das war nicht immer so. Theoderich in dieser Weise zu benennen wurde erst im 19. Jahrhundert üblich, und auch dann nur im deutschsprachigen Raum. Im frankophonen und anglophonen Bereich wird ihm der Beiname „der Große“ bis heute in der Regel vorenthalten. Für die deutsche Entwicklung war die Politisierung des Nationalbewusstseins in und nach den Napoleonischen Kriegen maßgeblich. König Ludwig I. von Bayern trug sein Teil dazu bei, indem er den gotischen König in die Walhalla, den „Ehrentempel des Vaterlandes für die rühmlich ausgezeichneten Deutschen“, aufnahm und dort mit dem Prädikat „der Große“ vor anderen „Ahnen“ auszeichnete.
Im deutschen Kaiserreich galt es für ausgemacht, dass Theoderich in die Reihe der welthistorisch bedeutsamen Herrschergestalten gehöre; in diesem Urteil stimmte der preußische Protestant Otto Hintze (1861-1940) mit dem katholischen Bayern Georg Pfeilschifter (1870-1936) völlig überein. Hintze führte Theoderich 1901 in einer vertraulichen Denkschrift als „Haupt der Germanenstämme neben dem Kaiser“ an, dessen Größe unbestritten sei. Der Kirchenhistoriker Pfeilschifter rühmte den König in einer 1910 veröffentlichten Biographie des Königs, weil er das katholische Bekenntnis geduldet und „bleibende kulturelle Werte“ geschaffen habe; obendrein habe er ein „starkes gotisches Selbstbewußtsein“ gehabt und „national gotisch“ gedacht.
Völlig außer Frage stand auch, daß Theoderich Germane gewesen und seine Herrschaft darum Teil der deutschen Geschichte sei, ungeachtet der Tatsache, daß er fernab der Gebiete gewirkt hatte, die zum Reich Bismarcks gehörten. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde Theoderich zunehmend für völkische und rassistische Ideen vereinnahmt. Im Dritten Reich stand Theoderich hoch im Kurs; in Broschüren und Wandkarten wurde das Bild eines germanischen Volkskönigs verbreitet, der unter der Sonne Italiens ein weises Regiment führte.
Aus nationalsozialistischer Sicht war seine Gestalt jedoch durchaus problematisch. Dass er den Schutz von Juden vor Gewalttaten zu seinen Herrscherpflichten gezählt hatte, ließ sich kaum bestreiten. Dass er sich als Herrscher über zwei Völker, Goten und Römer, verstanden hatte, die in seinem Reich mit verteilten Aufgaben einträchtig und zum gegenseitigen Vorteil zusammen leben sollten, widersprach allen Grundsätzen völkischen und rassistischen Denkens. Und natürlich passte Theoderichs italisches Reich weder zur Achse Berlin – Rom noch zu der erstrebten Eroberung von Lebensraum im Osten. Gleichwohl hat es nicht an Versuchen gefehlt, das Bild Theoderichs im Sinne der NS-Ideologie zu retuschieren.
Die Theoderich-Biographie des konservativen Althistorikers Wilhelm Ensslins (1885-1965), eines Mannes protestantischer Konfession und deutschnationaler Gesinnung, die während des Zweiten Weltkriegs geschrieben wurde und 1947 in erster Auflage erschien, ist gegen die Vereinnahmung Theoderichs durch NS-Ideologen gerichtet. Theoderich war für Ensslin „der letzte der Germanen, der, vom Geiste Roms berührt, germanische Volkskraft und sich selbst für die alte Römerwelt eingesetzt hat.“ Ensslin zeichnete Theoderich als einen germanischen Helden, der als König Italiens seinem Volk verbunden blieb, dabei aber die antike Kultur bewahren wollte, den Wohlstand aller Untertanen förderte und nach außen für Frieden und Verständigung unter den Herrschern des westlichen Europas eintrat. Ensslins Biographie, deren wissenschaftliche Qualität sogleich international anerkannt wurde, entsprach daher dem nach 1945 verbreiteten Bestreben, sich auf Traditionen zu besinnen, die sich als Fundament eines geeinten Europas zu eignen schienen. Im Zeichen eines christlichen Abendlandes sollte die politische und moralische Katastrophe Deutschlands bewältigt werden.
Ensslins Theoderich-Biographie ist fest in der Germanen-Ideologie des 19. Jahrhunderts verwurzelt. Das Germanische war für ihn eine stabile und wirksame Größe, Theoderich ein germanischer Herrscher, der seinem Volk diente, indem er ein Reich in Italien schuf, seine römischen Untertanen dabei aber zu ihrem Recht kommen ließ. Die seit der Napoleonischen Ära kontrovers diskutierte Frage, ob Theoderich die Verschmelzung dieser ungleichen Bevölkerungsgruppen anstrebte, verneinte Ensslin. Er hielt die gleichberechtigte Koexistenz einer kleinen Minderheit gotischer Krieger mit der großen Mehrheit römischer Zivilisten aber auch nicht für grundsätzlich problematisch, solange ein Herrscher vom Format Theoderichs regierte. Die kurze Dauer des von Theoderich begründeten Reichs lag seiner Ansicht nach in Faktoren begründet, die außerhalb seiner Kontrolle lagen, im Expansionismus Chlodwigs und im Revanchismus Justinians, aber auch im Scheitern der Nachfolgeregelung.
Neue Deutungen wurden in Deutschland erst am Ende des 20. Jahrhunderts vorgelegt. Man sah im gotischen Italien jetzt ein Exempel für die gescheiterte Integration einer eingewanderten Minderheit und mutmaßte, der konfessionelle Gegensatz zwischen Katholiken und sogenannten Arianern sei die Achillesferse der Herrschaft Theoderichs gewesen.
Andere dagegen sahen in Theoderich einen überaus erfolgreichen Vorreiter des Multikulturalismus; wenn sein Reich schon eine Generation nach seinem Tod unterging, so hieß es auf dieser Seite, lag das nicht etwa an einem Konstruktionsfehler, sondern war eine Folge des Schlachtenglücks. In einem kürzlich erschienenen Buch eines nordamerikanischen Historikers kann man lesen, dass die Herrschaft Theoderichs ein wahres goldenes Zeitalter für das von ihm erneuerte Weströmische Reich gewesen sei. Diese Lobeshymnen sind direkt aus zeitgenössischen Quellen entnommen. Die spätantike Herrscherpanegyrik kehrt im Gewande moderner Wissenschaftsprosa zurück.
Ich habe meine Theoderich-Biographie, erschienen in München bei C. H. Beck im Jahr 2018, bewusst von anderen Voraussetzungen aus entwickelt. Der Germanenbegriff muss beiseite bleiben, weil er in der wissenschaftlichen Diskussion der letzten 50 Jahre fast alle Inhalte eingebüßt hat, die noch Ensslin mit ihm verband, und weil er für das Selbstverständnis Theoderichs und seiner Zeitgenossen keine Rolle gespielt hat. Germanisch ist für mich ein Begriff der modernen Sprachwissenschaft; er dient zur Klassifikation von Sprachen, nicht von Personen.
Ebenfalls ausgeklammert bleibt die Frage nach dem Menschen Theoderich. Politisches Handeln aus dem Charakter von Entscheidungsträgern zu erklären ist in der Geschichtswissenschaft mit Recht in Verruf geraten. Die Frage ließe sich mit unseren Mitteln überdies auch gar nicht beantworten. Theoderich als Sohn und Bruder, Vater und Ehemann ist für uns nicht fassbar. Wir wissen nichts über seine inneren Beweggründe, können auch nicht sagen, was der Glaube an Jesus Christus ihm persönlich bedeutete, ob er seine Sünden bereute, auf das ewige Leben hoffte oder das Jüngste Gericht fürchtete. Theoderichs Persönlichkeit läßt sich nur in ihren Handlungen greifen.
Theoderichs Handlungen aber lassen sich nur verstehen, wenn man berücksichtigt, daß er seine Laufbahn als Anführer eines mobilen Kriegerverbands begann, der vor der Eroberung Italiens weite Teile Südosteuropas durchstreifte. Die Herrschaft in Italien verdankte er den Kriegern, die mit ihm von der unteren Donau über die Alpen gezogen waren und in einem vierjährigen, verheerenden Krieg den Sieg über die Soldaten Odovakars davongetragen hatten. Die Mehrheit dieser Krieger rechnete sich zu den Goten und wurde von anderen so wahrgenommen, auch wenn die tatsächliche Herkunft oftmals viel komplizierter gewesen sein dürfte.
Nachdem Theoderich die Kontrolle über die Ressourcen dieses immer noch reichen Landes erlangt hatte, mußte er diese Gewaltgemeinschaft in sein Reich integrieren. Es waren wohl etwa 20.000 bewaffnete und kampferprobte Männer mit ihren Frauen und Kindern, die über viele Jahre hinweg Entbehrungen und Strapazen auf sich genommen, Verwandte und Freunde verloren und oftmals ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hatten. Diese entwurzelten Menschen erwarteten nun eine angemessene Belohnung; sie beanspruchten ein komfortables und krisensicheres Auskommen und eine ihrem Selbstbewusstsein entsprechende Betätigung und Stellung. Nur wenn er diese Männer und Frauen zufrieden stellte, konnte Theoderich darauf hoffen, seine Herrschaft in Italien auf Dauer zu behaupten.
Freilich war das nur eine notwendige, keine ausreichende Voraussetzung für die Verstetigung der Herrschaft eines gotischen Königs in einem Land, in welchem einst römische Kaiser regiert hatten. Theoderichs Herrschaft in Italien erklärt sich nicht aus einem kaiserlichen Auftrag oder Amt, so lautet meine These; sie beruhte auf der Loyalität seines Heeres und der Kooperation der einheimischen Eliten, vor allem der Senatoren und der katholischen Bischöfe.
Ich werde im folgenden zunächst mit knappen Strichen die soziale Existenzform der Goten skizzieren, die mit Theoderich seit 474 kreuz und quer über den Balkan und schließlich nach Italien zogen, dann näher auf seine Herrschaft in Italien eingehen und zum Abschluss die Frage erörtern, worin die historische Bedeutung Theoderichs besteht.
Theoderich und seine Goten auf dem Balkan
Werfen wir also zunächst einen Blick auf die Zeit, in der Theoderichs Goten zwischen Plattensee und Bosporos agierten. Ich kann mich kurz fassen, da Verena Epp auf dieses Thema bereits eingegangen ist. Die Goten, die Theoderich 474 zu ihrem König machten, sind in unseren Quellen ab der Mitte des 5. Jahrhunderts fassbar; ihre Familien waren damals in Pannonien (Ungarn) ansässig. Damals standen drei Brüder an ihrer Spitze, einer von ihnen war Thiudimir, der Vater Theoderichs; anscheinend handelte es sich um eine Koalition dreier Verbände. Thiudimir und seine Brüder Valamir und Vidimir durchzogen damals unter der Führung des hunnischen Königs Attila weite Teile West- und Südosteuropas; in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern kämpften sie 451 im Heer Attilas gegen ein westgotisches Heer unter dem Oberbefehl des kaiserlichen Feldherrn Aëtius. Der Ostgote Andag rühmte sich nach der Schlacht, den westgotischen König Theoderich eigenhändig erschlagen zu haben.
Diese Goten bildeten eine militarisierte und hochgradig mobile Gesellschaft, die durch einen kriegerischen Ehrenkodex geprägt war. Entscheidend für ihre Konstitution und Reproduktion war die Aneignung von Gütern durch angedrohte oder ausgeübte Gewalt. Die materielle Existenz wurde durch Beute, erpresste Leistungen und Subsidien gesichert. Diese Männer waren weder Söldner noch Soldaten; Frauen und Kinder gehörten ebenfalls zu dieser Gemeinschaft. Vieles spricht dafür, dass diese Personen, die in den zeitgenössischen, aber nicht-gotischen Quellen durchweg als Goten angesprochen werden, über ein ethnisches Identitätsbewußtsein verfügten, sich also als Teil einer durch gemeinsame Herkunft und Abstammung verbundenen Gemeinschaft verstanden.
Grundlage dieses ethnischen Identitätsbewusstseins war neben der gotischen Sprache wohl schon zu dieser Zeit eine spezifische Form des Christentums, die von ihren Gegnern als Arianismus bezeichnet wurde, besser aber homöisches Christentum genannt wird. Das Glaubensbekenntnis der Homöer war zu der Zeit, als die Goten an der unteren Donau das Christentum annahmen, auch dasjenige der Reichskirche gewesen. Die gotischen Christen hielten indessen daran fest, nachdem Kaiser Theodosius (379-395) dem Symbol von Nizäa in der Reichskirche zur Durchsetzung verholfen hatte.
Die homöischen Christen bildeten seitdem eigene Gemeinden, mit eigenem Klerus, einer gotischen Liturgie und auch einer gotischer Bibel. Die Goten Thiudimirs und seiner Brüder waren jedoch keineswegs die einzigen Personenverbände, deren Anführer sich als Goten verstanden; von den Goten, die seit 418 in Aquitanien ansässig waren, ganz abgesehen, gab es auch auf dem Balkan, aber auch auf der Krim noch andere Gruppen, die sich so identifizierten.
Die Ereignisgeschichte der Jahre 451 bis 488 ist verwickelt und verwirrend. Im vorliegenden Zusammenhang genügt es, wenige Grundtatsachen hervorzuheben. Nach dem Zerfall des Hunnenreichs machten die in Pannonien ansässigen, in diesem Sinne also pannonischen, Goten sich selbständig. Es folgten zwei Jahrzehnte ständiger Raub- und Kriegszüge; König Valamir fiel im Kampf gegen eine suavisch-skirische Koalition. Da eine dauerhafte Existenzsicherung in Pannonien nicht gelang, trennten sich die Wege: Ein Teil zog 473 unter Führung des Königs Vidimir Richtung Italien und von dort weiter nach Gallien, wo er sich auflöste. Thiudimir zog mit dem anderen Teil Richtung Makedonien. Als er 474 in der makedonischen Stadt Kyrrhos starb, wurde Theoderich umgehend zu seinem Nachfolger erhoben.
Theoderich traf in diesem Raum auf einen anderen gotischen Anführer, der zu unserer Verwirrung ebenfalls Theoderich hieß und deshalb in der modernen Forschung mit seinem Beinamen Strabon bezeichnet wird. Dieser Theoderich hatte in Thrakien, auf dem Boden des heutigen Bulgarien, eine Gefolgschaft um sich geschart, die es an Größe mit derjenigen „unseres“ Theoderich durchaus aufnehmen konnte. Diese von Historikern so genannten thrakischen Goten waren dem Kaiser kraft eines 473 geschlossenen Vertrags zu militärischem Dienst verpflichtet und bezogen dafür Jahrgelder; ihr Anführer wurde mit dem höchsten militärischen Rang des Reiches, dem Amt eines Heermeisters ausgezeichnet.
Theoderich und seine Goten bedrohten diese privilegierte Stellung, indem sie ähnliches für sich selbst erstrebten. Die kaiserliche Regierung sah sich außerstande, die Ansprüche beider Theoderiche zu befriedigen, und versuchte daher, die beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen. Aus dieser Dreieckskonstellation resultierte ein auf dem Rücken der römischen Provinzialbevölkerung ausgetragener Machtkampf zwischen den beiden Theoderichen, der bis 481 andauerte, als der „andere“ Theoderich bei einem Reitunfall den Tod fand.
„Unser“ Theoderich vermochte in der Folge, die Anhänger seines toten Widersachers für sich zu gewinnen, und konnte seine Gefolgschaft dadurch auf etwa 20.000 Krieger vergrößern. Eine dauerhafte Regelung des Verhältnisses zum Imperium Romanum aber gelang auch danach nicht, obwohl er 483 das Heermeisteramt und 484 sogar das prestigeträchtige Amt eines Konsuls erlangt hatte.
Der Kriegerverband Theoderichs erfüllt in dieser Phase seiner Existenz alle Kriterien, die eine Gewaltgemeinschaft definieren: Sein Kern bestand aus waffenfähigen und kampfgeübten Männern; der innere Zusammenhalt und zeitweise auch das Überleben der Gruppe wurde durch Beute und Subsidien gesichert. Die Größe und Zusammensetzung dieser Gewaltgemeinschaft war starken Schwankungen unterworfen, weil ihre Macht nicht ausreichte, um eine dauerhafte Anerkennung und ökonomische Absicherung als reichsangehöriges Kriegervolk zu erreichen. Die wirtschaftliche Existenz des Verbandes, den Theoderich anführte, blieb daher stets prekär. Der Kaiser zahlte nur unregelmäßig Subsidien; Beute, Schutz- und Lösegelder brachten kurzzeitig hohe Einnahmen, hielten aber nie lange vor. Theoderichs Gefolgsleute hatten selten ein festes Dach über dem Kopf und litten oftmals Hunger. Die Raubwirtschaft war zugleich eine Mangelwirtschaft.
Integration durch Separation: Die Herrschaft Theoderichs in Italien
Nachdem sich ein dauerhafter Ausgleich zwischen Zenon und Theoderich auf dem Balkan als unmöglich erwiesen hatte, beauftragte der Kaiser den gotischen König im Jahre 488, nach Italien zu ziehen, Odovakar, der dort seit 476 als König herrschte, zu beseitigen und an dessen Stelle so lange zu herrschen, bis er selbst dorthin kommen werde. Theoderich hat diesen Auftrag bekanntlich erfolgreich ausgeführt. Er hat dazu jedoch viel länger gebraucht, als er und seine Männer sich vorgestellt oder jedenfalls gewünscht haben werden. Der Krieg gegen Odovakar dauerte mehr als drei Jahre und verwüstete große Teile Ober- und Mittelitaliens.
Der Ausgang stand lange auf des Messers Schneide, auch wenn Odovakar seit 490 in Ravenna eingeschlossen war. Erst am 5. März 493 konnte Theoderich in Ravenna einziehen, nachdem er einen Vertrag beschworen hatte, künftig gemeinsam mit Odovakar zu herrschen. Keine zwei Wochen später war Odovakar tot, heimtückisch erschlagen von dem Mann, der einen Eid geleistet hatte, die Herrschaft mit ihm zu teilen.
Theoderich wurde durch diese Bluttat, der ein Massaker an den Gefolgsleuten Odovakars folgte, zum alleinigen Herrscher in Italien. Niemand konnte es in diesem Moment wagen, sich ihm und seinen Leuten in den Weg zu stellen. Theoderich nutzte diese Macht, um seine Gefolgsleute zu versorgen. Er verwandelte die mobile Gewaltgemeinschaft, mit deren Hilfe er Italien erobert hatte, in ein stehendes Heer, indem er seine Krieger mit Landgütern ausstattete. Die Goten im Heer Theoderichs erhielten also Besitztitel für Landgüter, aus denen sie Grundrenten bezogen; zusätzlich bezogen sie vom König eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von fünf Goldstücken, solange sie der militärischen Dienstpflicht unterlagen.
Denn Theoderich bestellte seine Goten Jahr für Jahr zur Musterung an seinen Hof und überzeugte sich persönlich von der Kampfkraft seines Heeres. Die Goten im Reich Theoderichs wurden dadurch zu einer militärischen Funktionselite; das Heer galt als bewaffneter Teil des gotischen Volkes, jedenfalls soweit es unter der Herrschaft Theoderichs stand. Umgekehrt galt, dass der Waffendienst für den König Goten vorbehalten sei. Römer sein war im Sprachgebrauch der königlichen Kanzlei gleichbedeutend mit Zivilist sein. Im Imperium Romanum galt das Gegenteil: Wer für den Kaiser die Waffen führte, galt ipso facto als Römer, mochte er seiner Herkunft nach auch Armenier, Hunne oder Gote sein. Theoderich konzipierte sein Königtum in Italien als Herrschaft über zwei Völker, über Goten und Römer, denen verschiedene Lebensformen und Betätigungsfelder zugewiesen waren, auch wenn sie einträchtig und zum gegenseitigen Vorteil zusammenwirken sollten.
Theoderich etablierte also eine funktionale Arbeitsteilung zwischen römischen Zivilisten und gotischen Kriegern: Die einen sollten für den König kämpfen, die anderen ihre Pflichten als Untertanen erfüllen, vor allem natürlich ihre Steuern und Abgaben zahlen. Eben darum dachte der König auch ganz und gar nicht daran, Goten und Römer zu einer neuen, einheitlichen Funktionselite zu verschmelzen, wie Alexander der Große das für Makedonen und Iraner geplant zu haben scheint. Theoderichs Politik zielte gerade nicht auf Fusion, sondern auf Separation. Ich habe das „Integration durch Separation“ genannt.
Nun hätte Theoderichs Herrschaft in Italien kaum drei Jahrzehnte Bestand haben können, wenn er auf den entschlossenen Widerstand der einheimischen Eliten gestoßen wäre. Theoderich gelang es jedoch, die standesbewussten Senatoren zur Kooperation zu bewegen, obwohl er ihnen am Anfang nicht unerhebliche finanzielle Opfer abverlangte, um seine Goten mit Landgütern auszustatten. Dieses Arrangement mit den Senatoren war möglich, weil Theoderich die Privilegien dieses Standes in vollem Umfang aufrechterhielt und seine Angehörigen am Regiment beteiligte. Denn Theoderich übernahm den spätrömischen Staatsapparat im Wesentlichen unverändert.
Alle leitenden Posten in der zivilen Verwaltung wurden mit Personen besetzt, die aus senatorischem Milieu stammten. Die Leitung der zivilen Ministerien lag bei hochrangigen Senatoren. Die königliche Kanzlei kommunizierte in den althergebrachten und gewohnten Formen; die Schreiben, die Cassiodor im Namen und Auftrag Theoderichs verfasste, hätten kaiserlichen Kanzleien Ehre gemacht. Das römische Recht blieb grundsätzlich in Geltung. Vor römischen Gerichten wurde weiterhin in römischen Formen verhandelt. Nur wenn Goten betroffen waren, sollten Fälle von gotischen Richtern entschieden werden.
Für den König war die Kooperation der Senatoren auch deswegen von unschätzbarem Wert, weil das Steuersystem nur funktionieren konnte, wenn die Zentrale auf die soziale Macht der lokalen Eliten zurückgreifen konnte. So aber wurde Theoderich zum nach dem Kaiser reichsten Herrscher seiner Zeit, der über stetige und berechenbare Einkünfte in einer Höhe verfügen konnte, von der sein Vater und seine Onkel nur hatten träumen können. Theoderichs Tochter Amalasvintha fand im Königsschatz mehr als 40.000 Pfund Gold vor.
Erstaunlicher mag auf den ersten Blick wirken, daß Theoderich auch mit den katholischen Bischöfen seines Reiches ein gutes Verhältnis hatte. Eine Voraussetzung dafür war, daß der König nicht daran dachte, seinen Untertanen das homöische Bekenntnis aufzudrängen, wie es einige vandalische und westgotische Könige getan hatten. Theoderich machte zwar keinen Hehl daraus, daß er einer anderen Konfession angehörte, die er nach Kräften förderte – man denke nur an die sogenannte Hofkirche Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna.
Der König respektierte aber den Besitzstand und die Privilegien der katholischen Gemeinden und Kleriker. Da er die Koexistenz zweier christlicher Konfessionen anerkannte, trat de facto ein bi-konfessioneller Zustand ein, der freilich nur praktiziert, aber nicht thematisiert oder gar legitimiert werden konnte. Die katholischen Bischöfe Italiens aber sahen in Theoderich auch deswegen ein verschmerzbares Übel, weil die Kaiser Zenon und Anastasios versuchten, den in ihrem Reich mit großer Heftigkeit geführten Streit um die menschliche Natur Christi durch eine Kompromissformel, das sogenannte Henotikon, zu beenden, die im Westen, namentlich vom Papst, abgelehnt wurde.
Solange in Italien Theoderich herrschte, reichte der Arm des Kaisers nicht bis zu ihnen. Tatsächlich wurde Theoderich sogar als Schiedsrichter angerufen, als es Ende 498 zu einer Doppelwahl im römischen Bistum kam. Theoderich entschied damals gegen Laurentius und zugunsten des Symmachus, weigerte sich aber später, über die Anklagen zu befinden, die gegen die Amtsführung des Symmachus erhoben wurden. Erst 506 beendete er das Schisma, indem er Laurentius absetzen ließ.
Ein kurzes Wort sei schließlich der Außenpolitik Theoderichs gewidmet. Theoderich, der im Auftrag Zenons gegen Odovakar gezogen war, musste einige Jahre warten, bis sich Kaiser Anastasios, der 491 Nachfolger Zenons geworden war, bereit fand, die Herrschaft des gotischen Königs in Italien anzuerkennen. Im Jahre 497 oder 498 wurde dann aber ein Vertrag geschlossen, der bis zum Tode des Königs Bestand hatte, wenngleich es zwischen 504 und 508 auf dem Balkan zu Konflikten kam, die auch mit militärischen Mitteln ausgetragen wurden. Eine Kriegserklärung blieb indessen aus; Anastasios stellte den Vertrag von 497/498 niemals grundsätzlich in Frage, und auch sein Nachfolger Justin tat das in seiner Regierungszeit nicht.
Die Herrscher des Westens wollte Theoderich zunächst durch Heiraten an sich binden. 506 versuchte er, den drohenden Krieg zwischen seinem Schwiegervater Chlodwig und seinem Schwager Alarich durch Vermittlung zu verhindern. Als das misslang, trat er 508 in den Krieg ein, drängte den siegreichen Chlodwig zurück und eroberte nicht allein die Provence, sondern auch das Westgotenreich in Hispanien, das er fortan in Personalunion mit dem Gotenreich in Italien regierte. Theoderich konnte sein Herrschaftsgebiet dadurch nahezu verdoppeln und gewann erhebliche Ressourcen hinzu.
Theoderich der Große – eine Bilanz
Das gotische Königreich in Italien überdauerte seinen Gründer nur um eine Generation. Theoderich starb am 30. August des Jahres 526, ohne seine Nachfolge geregelt zu haben. Der Hof einigte sich auf seinen minderjährigen Enkel Athalarich, was dessen Mutter Amalasvintha faktisch zur Regentin machte. Athalarich wiederum starb 534, ohne jemals selbst regiert zu haben. Daraufhin ergriff Amalasvintha die Flucht nach vorn, ernannte sich selbst zur Königin und bestellte Theoderichs Neffen Theodahad zu ihrem Mitkönig. Als Theodahad Amalasvintha erst inhaftieren und dann umbringen ließ, befahl Justinian die Invasion Italiens. Damit begann der römisch-gotische Krieg, der 540 mit einem vollständigen Sieg der kaiserlichen Truppen zu enden schien, aber bald wieder aufflammte und noch weitere 12 Jahre dauerte. Die Niederlage Tejas am Milchberg bei Neapel im Oktober 552 beendete zwar nicht den Krieg, wohl aber das gotische Königtum in Italien.
Die kurze Dauer des gotischen Reiches in Italien wirft einen Schatten auf das Bild seines Gründers. Theoderich war ohne Zweifel erfolgreich, insofern er sich in Italien gut drei Jahrzehnte an der Macht hielt und das Land in dieser Zeit vor äußeren Feinden weitgehend abschirmte. Aber er gehört nicht zu den Herrschern, die Weichen für die folgenden Jahrhunderte gestellt haben. Er hat auch keine politische Tradition gestiftet, die das Ende seines Reiches überdauert hätte. In dieser Hinsicht hält Theoderich den Vergleich mit Constantin dem Großen oder Karl dem Großen nicht aus.
Damit ist die Frage freilich noch nicht beantwortet, ob Integration durch Separation die richtige Politik war, wenn er eine dauerhafte Herrschaft begründen wollte. Aus der Rückschau fällt die Feststellung leicht, daß die sprachliche und kulturelle Einkapselung einer so kleinen Gruppe von Einwanderern nicht unbegrenzt bestehen bleiben kann. Militärische und zivile Eliten tendieren dazu, ihr Kapital an Ansehen, Macht und Reichtum über kurz oder lang zu fusionieren. Genau das geschah ja zwei Generationen später im Reich der Westgoten. Dort wurde 589 auch die konfessionelle Schranke zwischen Goten und Römern beseitigt.
Für Theoderich lag das noch außerhalb des Vorstellbaren. In jedem Fall sollte man sich hüten, die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der inneren Politik Theoderichs mit derjenigen nach den Ursachen des militärischen Scheiterns seiner Nachfolger zu vermengen. Im Vergleich mit dem Reich der Vandalen in Nordafrika, das dem Angriff Belisars binnen eines Jahres erlag, fällt gerade die enorme Resilienz der gotischen Krieger in Italien ins Auge. Auch wenn das Gotenreich in Italien dem Imperium an finanziellen Ressourcen weit unterlegen war, hing der Ausgang des Krieges in hohem Maße von kontingenten Faktoren ab.
Theoderichs Außenpolitik beruhte auf der Anerkennung einer Pluralität von Herrschern. Die Existenz des Imperium Romanum stand für ihn außer Frage. Er hat für seine Ziele durchaus militärische Mittel eingesetzt und auch die Eroberung von Gebieten keineswegs verschmäht, wenn sie mit kalkulierbarem Risiko möglich war. Er betrieb aber keine Kriegs- und Eroberungspolitik als Selbstzweck wie sein Schwager Chlodwig. Seit er Herr Italiens war, hatte er es nicht mehr nötig, sich auf diese Weise Güter anzueignen. Aber er war auch bereit, räumliche Grenzen seiner Macht anzuerkennen; und er beanspruchte keine universale Herrschaft.
Dass Theoderich Christen, die einer anderen Konfession anhingen als er selbst, gestattete, ihren Glauben frei auszuüben, ja Angehörige einer anderen Konfession sogar mit den höchsten Würden auszeichnete, hat ihm seit den Religionskriegen des 16. Jahrhunderts Sympathien eingetragen. Aufgeklärte Geister hielten ihm darüber hinaus zugute, daß er Juden den Schutz gewährte, den ihnen Kaiser Justinian und viele, die nach ihm kamen, vorenthielten. Aber es wäre verkehrt, Theoderich deswegen zum Verfechter des modernen Toleranzgedankens zu stilisieren. Toleranz ist mehr und anderes als bloße Duldung. Wer in der Geschichte vor allem Vorbilder für eine aktive Reformpolitik sucht, wird bei Theoderich ebenfalls nicht fündig werden. Sein politisches Handeln zielte ganz und gar auf die Konservierung des sozialen status quo. Damit meine ich nicht allein, dass Theoderich ebenso wenig wie irgendein anderer Herrscher seiner Zeit glaubte, es sei seine Aufgabe, die Ungleichheit von Lebenschancen und Daseinsrisiken zu verringern. Auch der missionarische Impetus, mit dem Justinian als Gesetzgeber die Verchristlichung des Imperium Romanum betrieb, gehen dem gotischen König vollkommen ab.
Man kann die historische Bedeutung Theoderichs auch auf andere Art bemessen. Man kann versuchen, die Wirkungen abzuschätzen, die direkt oder indirekt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, bei Lebzeiten oder nach dem Tode von ihm ausgingen. So betrachtet, ragt er über die meisten seiner Zeitgenossen hinaus. Der Aktionsraum Theoderichs war im Wesentlichen auf Europa beschränkt. Bis 488 agierte er persönlich im südöstlichen Europa zwischen Plattensee und Bosporos; nach Kleinasien kam er nur einziges Mal und auch das nur für sehr kurze Zeit. Seit 489 hielt er sich so gut wie ausschließlich in Oberitalien auf.
Theoderichs Feldherren aber operierten in einem Raum, der von der iberischen Halbinsel bis nach Serbien reichte. Seine diplomatischen Kontakte erstreckten sich noch weit darüber hinaus, im Norden bis nach Skandinavien, im Süden bis nach Tunesien und im Osten bis nach Konstantinopel. Dagegen scheint Theoderich keine Beziehungen zum Reich der Sassaniden, den arabischen Stammesbünden der Ghassaniden oder Lakhmiden oder den Herrschern von Axum (im heutigen Äthiopien) unterhalten zu haben. Der König respektierte hier den Vorrang des Kaisers. Erst Theoderichs Nachfolger haben versucht, Beziehungen zum Perserkönig aufzunehmen, jedoch vergeblich.
Der Resonanzraum Theoderichs war freilich schon zu Lebzeiten erheblich größer; er schloss den römischen Orient durchaus ein; byzantinische und syrische Chronisten kennen Theoderich und berichten von seinen Taten. Im lateinischen Westen war der König niemals vergessen. Karl der Große ließ ein Reiterstandbild des Königs aus Ravenna nach Aachen bringen. In Ravenna und Verona knüpfte sich die Erinnerung an Monumente, die dem König zu Recht oder Unrecht zugeschrieben wurden. Im Kloster Mons Olivetus in Verona entstand im 12. Jahrhundert eine Sammelhandschrift mit lateinischen Texten zur Geschichte Theoderichs und der Goten, die mit Federzeichnungen illustriert ist; eine davon zeigt Theoderich und Odovakar im ritterlichen Zweikampf. (Abb. 3) Die Varien Cassiodors überlieferten der Nachwelt das Bild eines Königs, der im Verein mit römischen Senatoren eine mustergültige Herrschaft ausgeübt habe. Eine Sammelhandschrift des 12. Jahrhunderts aus dem Kloster Fulda zeigt Theoderich in der Gestalt eines deutschen Königs, gepaart mit seinem „Kanzler“ Cassiodor.
Diesem positiven Theoderich-Bild stand jedoch ein negatives gegenüber. Dieses negative Theoderich-Bild speiste sich vor allem aus zwei Quellen: den Dialogen Papst Gregors des Großen und dem Trost der Philosophie des Boethius, die im hohen und späten Mittelalter eines der beliebtesten Lesebücher für Kleriker war. Boethius sorgte dafür, dass Theoderich stets mit dem Makel des Tyrannen behaftet blieb, der einen Weisen zum Tode verurteilt hatte. Gregor der Große setzte die Geschichte in Umlauf, daß den häretischen König die verdiente Strafe für seine Sünden ereilt habe: Seine unschuldigen Opfer, der Papst Johannes und der Patrizier Symmachus, hätten ihn in einen Vulkan gestürzt. Dieser „Höllensturz“ Theoderichs fand Eingang in die meisten historiographischen Berichte des gesamten westeuropäischen Mittelalters.
Großen Nachruhm erlangte Theoderich nach seinem Tode im gesamten germanischsprachigen Europa, von Skandinavien bis nach Österreich. Aus dem gotischen König Theoderich wurde Dietrich von Bern (Verona), ein König, der aus seinem italischen Reich vertrieben wurde und vergeblich versuchte, dieses Reich zurückzugewinnen. Der Amaler Theoderich streifte dabei jede Bindung an Volk oder Familie ab und verwandelte sich in einen heimatlosen, kämpfenden und duldenden Helden, der Achtung gebietet und Mitleid verdient. Man empfand den König zwar als Gestalt der fernen Vergangenheit, konnte und wollte ihn aber keiner bestimmten Völkerschaft mehr zuordnen.
Dietrich von Bern wird niemals als Gote bezeichnet. Die frühesten Zeugnisse für diese erstaunliche Verwandlung stammen freilich erst aus dem 9. Jahrhundert. Das althochdeutsche Hildebrandslied aus der Zeit um 830, von dem nur 68 Langverse erhalten sind, scheint die Kenntnis des Stoffs vorauszusetzen; ebenso das etwa gleichzeitige altenglische Gedicht Deors Klage. Aus dem 13. Jahrhundert sind mehrere Epen in mittelhochdeutscher Sprache überliefert, die von Dietrich erzählen. Das bedeutendste und bekannteste ist natürlich das Nibelungenlied, das im 19. Jahrhundert durch die Nachdichtung Karl Simrocks ein neues Leben erhielt, während die Dietrich-Epik des hohen Mittelalters seit dem 16. Jahrhundert der Vergessenheit anheimfiel.
Kaiser Maximilian I. nahm eine Statue Theoderichs in die Heldengalerie auf, die sein Grabmal in der Innsbrucker Hofkirche umgibt (Abb. 5). Auch Martin Luther hat noch gerne gegen das „lose Geschwetz“ von Dietrich von Bern polemisiert, dem man allerhand Wundertaten zuschreibe. Sein Gegner Johannes Cochläus, ein Humanist und Kenner Cassiodors, veröffentlichte 1544 in Ingolstadt die erste Biographie des Königs, die auf den zeitgenössischen Quellen beruht. Damit begann die Geschichte der modernen Auseinandersetzung mit Theoderich, die bis heute andauert. Davon wäre bei anderer Gelegenheit zu sprechen.