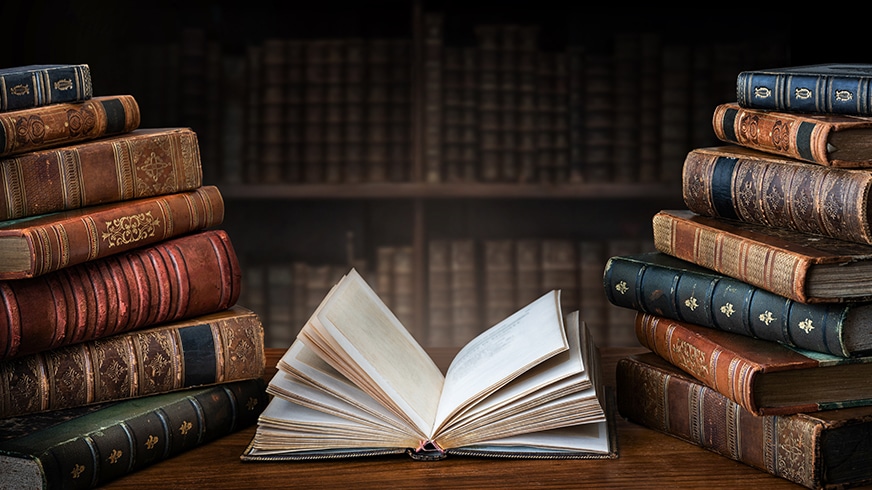Der Himmel verdunkelt sich 536/7, gut zehn Jahre nach dem Tod Theoderichs des Großen, im ganzen Mittelmeerraum. Dieses Naturphänomen, dessen Gründe strittig sind, ist selbst außerhalb des Mittelmeerraums, gut belegt. Für eine längere Zeit scheint das Sonnenlicht an Strahlkraft verloren zu haben. In China brachen Hungersnöte aus, in Mesopotamien fiel Schnee, in Nordamerika wuchsen die Bäume langsamer. Für mehrere Jahre scheint das Klima abgekühlt zu sein. Missernten traten ein, die Menschen wurden geschwächt.
Die schwerste aller Katastrophen war die große Justinianische Pest, eine Seuche, die den Mittelmeerraum und seine Umgebung für Jahrzehnte verheeren sollte. Was seit 541 den Römern widerfuhr, übertraf die frühere Seuche bei weitem, auch wenn die heutige Forschung die Wirkungen der Pest teils relativiert: Von Ägypten her kommend breitete sie sich über Syrien bis nach Kleinasien aus und erreichte auf dem Seewege schon im Frühjahr 542 Konstantinopel. Gerade in den Städten, raffte sie Tausende hin.
Zeitgenossen mussten ein solches Ereignis vor allem als eine göttliche Strafe deuten. Justinian, der selbst erkrankt war, aber überlebt hatte, sprach später, als die Pest überstanden schien, von einer Belehrung, die den Menschen durch Gottes Gnade zuteil geworden sei, und versuchte, sie durch Strafen zu bessern. Doch blieben die Wirkungen fatal, denn die Seuche kehrte mehrmals wieder.
Das Oströmische Reich verlor massiv an Ressourcen, was sich auch im Krieg gegen die Goten zeigen sollte, zumal die Probleme im Osten, dem Zentrum der Macht, Vorrang haben mussten. Als die Naturkatastrophe ihre volle Wucht entfaltete, hatte das Ostgotenreich gegenüber der Zeit des Todes Theoderichs schon erhebliche Veränderungen durchgemacht. Es sollte einen langen Weg in die Niederlage gehen, der sehr windungsreich, aber nicht unausweichlich war. Nicht alle Details der Feldzüge werde ich vorstellen, nicht jeden Personenwechsel; ich versuche vielmehr die Hauptlinien herauszuarbeiten und komme auf die Hauptakteure zu sprechen.
Das Römische Reich beherrschte Justinian, einer der langlebigsten Herrschers, dessen Name sich mit großer Prachtentfaltung verbindet – die Hagia Sophia zeugt noch heute davon – und der lange herrschte. Mit dem Namen des Kaisers ist ferner eine auf den ersten Blick äußerst erfolgreiche Eroberungspolitik verbunden. Zunächst besiegte er die Vandalen in Nordafrika, dann die Ostgoten in Italien, zugleich drang er auf die Iberische Halbinsel vor, sicherte den Balkan und eignete sich sogar einen Teil des heutigen Georgiens an. Doch ist fraglich, ob das so geplant war. Die Interventionen im Vandalenreich und in Italien ergaben sich jeweils aus günstigen Situationen. Und den gefährlichsten Gegner bildete das Perserreich. Seit 526 herrschte Krieg, also schon zum Regierungsantritt Justinians, immer wieder unterbrochen von Friedensschlüssen, auf die man sich aber nicht verlassen konnte. Am klügsten wäre es gewesen, alle Ressourcen dort zu konzentrieren.
Denn fast während der ganzen Zeit der Gotenkriege stand das Römische Reich in einem Mehrfrontenkrieg. Hinzu kamen Herausforderungen im Inneren: kirchenpolitische Streitigkeiten, Unruhen in der Hauptstadt, und eben die großen Katastrophen. Schon dies zeigt, dass das Römische Reich stets Gefahr lief, seine Kräfte zu überdehnen, und ebenso, dass ein Sieg gegen die Goten keineswegs sicher war. Es war auch keineswegs unstrittig, dass es sinnvoll war, so viele Kräfte in Italien zu binden. Die Geschichte der Herrschaft Justinians ist auch eine Geschichte der Überspannung der Kräfte eines Reiches.
Doch auch das Ostgotenreich hatte massive interne Probleme, die Theoderich durch eine funktionale Separierung von Goten und Römern unter Kontrolle gehalten hatte. Zum einen war die Nachfolge Theoderichs strittig, wie wir sehen werden. Ferner rang man um Lebensstile: Wie weit sollten Goten sich auf eine römische Lebensform einlassen? Auch hatte sich das komplexe Bündnissystem Theoderichs aufgelöst. Die Goten waren im Zweifel auf sich gestellt.
Aber die Gotenherrschaft stieß bei den Einwohnern Italiens nicht nur auf Ablehnung. Eine Reihe von Romanen arbeitete für die Goten. Es war also gar nicht klar, dass Goten gegen Römer standen; für viele Menschen waren die ethnischen Grenzen nicht entscheidend, sondern persönliche Loyalitäten, regionale Verbundenheit oder schlichtweg Karriereinteressen. Dennoch: Die Goten blieben eine Minderheit; ihre italischen Freunde waren keineswegs verlässlich. Ein großer Teil der italischen Bevölkerung fühlte sich mehr dem Kaiser verbunden als den Goten. Die Goten hatten sich vieler Gegner zu erwehren.
Vitigis: Der römische Scheinsieg
Mehrfach konnte man den Eindruck gewinnen, dass der Kampf um Rom beendet sei, doch immer neu brach er hervor. Um das Spannungsmoment zu verdeutlichen, habe ich meinen Ausführungen so gegliedert, dass sie auf scheinbare Friedenszustände hinführen. Nach Theoderichs Tod verschärften sich die desintegrativen Tendenzen im Ostgotenreich. Sein Enkel Athalarich kam 526 – entgegen gotischer Tradition – minderjährig auf den Thron; dass seine Mutter Amalasvintha als Frau für ihn die Regentschaft ausübte, war für viele Goten ebenfalls anstößig. Ostrom aber akzeptierte die Herrscherin, zumal sie alles tat, um die Beziehungen zu Konstantinopel zu festigen.
Das musste sie auch, denn sie hatte viele Gegner. Viele Senatoren arbeiteten indes bereitwillig mit ihr zusammen. Cassiodor, Spross einer angesehenen senatorischen Familie und unter Theoderich in hohen Ämtern bewährt, wurde 533 Prätoriumspräfekt. Seine Schreiben, von denen etliche erhalten sind, zeugen von dem Willen, einen Ausgleich zwischen Goten und Römern zu finden. Sie belegen auch das Bemühen, Athalarich bei den Untertanen Akzeptanz zu verschaffen, die sich mit dem neuen Herrscher in wechselseitigen Eiden verbanden. Die Westgoten auf der Iberischen Halbinsel bestimmten Amalarich, einen anderen Theoderich-Enkel, der bislang unter der Aufsicht seines Großvaters geherrscht hatte, zu ihrem neuen Alleinherrscher, so dass sich dieser Reichsteil wieder verselbständigte.
Amalasvinthas Position blieb prekär; gerade ihre, wie es scheinen mochte, nachgiebige Haltung gegenüber dem Kaiser sorgte bei vielen Goten für Unmut. Andererseits machte Justinian Anstalten, in die inneren Verhältnisse des Gotenreiches einzugreifen. Traditionsbewusste Goten mussten auf den heranwachsenden Athalarich setzen, den letzten Enkel Theoderichs. Doch er starb 534, kaum 18 Jahre alt. Da ließ Amalasvintha sich, offenbar ganz eigenmächtig, Königin nennen und ersah ihren Vetter Theodahad als letzten Spross der gotischen Königsfamilie zum Mitherrscher aus. Er galt als gebildet im klassischen Sinne und als ausgesprochen römerfreundlich, aber auch als geldgierig. Amalasvintha fand bald darauf den Tod, und niemand konnte ernsthaft glauben, dass Theodahad daran unbeteiligt gewesen sei. Das bedeutete eine Provokation für alle anderen und eine günstige Gelegenheit zur für Justinian, mit einer Intervention zu drohen.
Theodahad, dem der Unwillen seiner römischen Untertanen, aber auch vieler Goten entgegenschlug – es ging ja um die Tochter des großen Theoderich –, zeigte sich gegenüber dem Kaiser weiterhin willfährig, selbst als dieser in die inneren Angelegenheiten des Ostgotenreichs eingriff, indem er etwa für ein Kloster Steuererleichterungen forderte.
Doch zu keinem Zeitpunkt gewinnt man den Eindruck, dass der Kaiser ernsthaft einen Frieden mit Theodahad in Erwägung zog, auch wenn Verhandlungen geführt wurden. Der Krieg kam: Theodahad und seine Gattin Gundeliva schrieben weiter ehrerbietig an Kaiser und Kaiserin. Die Verhandlungen gingen weiter: Für den Historiker Prokop, der Insiderkenntnisse reklamiert, erwies sich Theodahad dabei als jemand, der allein an der Sicherung des eigenen Wohlergehens interessiert gewesen sei. Der stadtrömische Senat sandte einen – natürlich von Cassiodor formulierten – Brief an den Kaiser, in dem er um Frieden mit dem König bat und dafür gleichsam Rom und die Apostel Petrus und Paulus als Bittsteller auftreten ließ. Zugleich hielt Theodahad es für angezeigt, den frisch geweihten Papst Agapet I. noch Ende 535 nach Konstantinopel zu entsenden, damit dieser seine geistliche Autorität nutze, um den Kaiser von einem weiteren Vorrücken abzuhalten. Der Bischof aber interpretierte seinen Auftrag ganz anders und kritisierte Justinian scharf für seine Religionspolitik, verschärfte also den Konflikt. Er war nicht der erste gotische Gesandte römischer Herkunft, der seine Herrscher im Stich ließ.
So kam es zum Krieg: Zwei Stoßrichtungen verfolgte der römische Angriff. Einige Truppen rückten auf dem nordwestlichen Balkan vor, errangen aber kaum Erfolge. Der bewährte Feldherr Belisar hingegen, vom Süden kommend, siegte im Sturmlauf. Er landete noch 535 auf Sizilien, das er bis zum Ende des Jahres eroberte. Nach einigen Rückschlägen gelang Belisar die riskante Überquerung der Straße von Messina. Nicht wenige Goten traten in die oströmische Armee über. Die kaiserlichen Truppen zogen eilends nach Neapel, das, zu Wasser und zu Lande belagert, erbittert Widerstand leistete, so dass mehrere Attacken Belisars blutig scheiterten.
Besonders unterstützt wurden die anwesenden germanischen Einheiten von den Juden der Stadt, die wohl ahnten, was ihnen drohte, wenn sie unter die Knute des unduldsamen Justinian gerieten. Dank einer List – sie krochen durch wasserlose Aquädukte in die Stadt – vermochten sich die Römer der Stadt zu bemächtigen und plünderten sie brutal. Neapel, seit Jahrhunderten römisch, wurde wie eine feindliche Stadt behandelt. Das war ein Menetekel für das Schicksal Italiens während der nächsten Jahrzehnte, die zu den furchtbarsten seiner Geschichte werden sollten.
Weiter ging es nach Norden: Rom war das Ziel. Bestürzt über den raschen Vormarsch setzten die Goten Theodahad ab und riefen den bewährten Militär Vitigis in Ravenna zum König aus, der Mathesuentha, die Tochter Amalasvinthas, heiratete, so dass eine Verbindung zum Königshaus der Amaler entstand. Theodahad, der letzte Amaler im Mannesstamm, wurde von einem Landsmann ermordet. Vitigis versicherte sich der Loyalität Roms, ging aber wieder nach Ravenna zurück, wobei er es nicht versäumte, einige Senatoren als Geiseln (und Legitimitätsgrundlage?) mitzunehmen. Am 9./10. Dezember 536 gelangte die Stadt gleichwohl wieder in römische Hand; in derselben Nacht, da die Truppen Belisars einmarschierten, sollen die Ostgoten entwichen sein. Die erste Eroberung Roms in diesem Krieg, die noch ohne Zerstörungen erfolgte. Schlimmeres solle kommen. Aus römischer Sicht war dies ein großer Sieg. Das Neue wie das Alte Rom standen unter dem römischen Kaiser; das Reich schien erneuert.
Doch jeder wusste: Rom war keineswegs das Zentrum gotischer Macht, denn dies lag in Ravenna. Dieser Krieg war noch nicht entschieden; er ging vielmehr erst richtig los, denn Vitigis erwies sich als formidabler Gegner, militärisch wie diplomatisch. Seine Gesandten erreichten den Kaiser mit einem Schreiben voller Ehrerbietung, aber nicht ohne Hinweis darauf, dass es keinen Grund für einen Krieg gegen die Goten gebe, da er mit Mathesuentha verheiratet sei, der rechtmäßigen Erbin. Damit überzeugte er den Kaiser natürlich nicht, unterstrich aber seine prinzipielle Loyalität gegenüber den Auffassungen Roms. Er hütete sich während der ganzen Zeit seiner Herrschaft, Münzen mit seinem Bild zu prägen, ja er ließ sogar welche im kaiserlichen Namen Justinians schlagen. Formell war er mithin ein loyaler Untertan.
Doch nachgeben wollte er nicht. Er rief einen Akteur der Zukunft auf den Plan: die Franken, die Gallien beherrschten. Amalasvintha hatte ohnmächtig zusehen müssen, wie sie sich Thüringer (531/2) und Burgunder (532) unterwarfen. Jetzt zeigte Vitigis sich bereit, Gebiete jenseits der Alpen den Franken zu überlassen. Die nahmen die Franken gerne, doch die Unterstützung blieb lau. Es gab eben keine germanische Treue. Doch Vitigis errang durchaus Erfolge. Er drang nach Salona vor, um es zu belagern. Auch der Kampf um Rom flammte 537/8 wieder auf: Nur über wenige Tausend Mann gebot Belisar, und auch Entsatztruppen, die später eintrafen, konnten ihm nicht wirklich helfen. Justinians Erfolg in Italien stand auf der Kippe, und Rom litt.
Drängend waren die Probleme der belagerten Stadt, obwohl Belisar die Befestigungsanlagen verstärkt hatte: Die Goten, deren Zahl in die Zehntausende ging, unterbrachen die überlebenswichtigen Aquädukte Roms und konnten schließlich Porto, den Hafen Roms, einnehmen, auch die Versorgung zu Lande blockieren – Vitigis ging die Rückeroberung Roms offenbar umfassend an. Belisar wusste seinerseits Nadelstiche zu setzen; die gut ausgebildeten römischen Truppen brachten den Goten empfindliche Verluste bei, und es gelang sogar Schlüsselstellungen in Latium zu besetzen, so dass nunmehr die Goten mit Versorgungsproblemen zu kämpfen hatten. An Hunger und Seuche trugen sie schwer, zudem hörte man, dass ein weiteres römisches Entsatzheer nahte. Einen Waffenstillstand konnte Belisar nutzen, um für Nahrung zu sorgen. Die Hoffnung des Vitigis, Justinian zu einem Frieden bewegen zu können, schlug fehl; er musste die Belagerung im März 538 aufheben. Ein Jahr und neun Tage hatte sie gewährt.
In der Zeit waren die Leute Justinians anderswo vorgedrungen und hatten Orte wie Mailand und Rimini erobert. Doch anderswo beherrschten gotische Truppen das Feld, Vitigis war noch nicht geschlagen, und leicht konnten römische Einheiten abgeschnitten werden. Zudem kam es auf römischer Seite zu Befehlsverweigerungen. Belisars Ansehen erodierte: Justinian schickte 538 eine weitere oströmische Armee, geführt von Narses, dem bewährten Eunuchen. Fast unvermeidlich gerieten die beiden Männer in Streit. Und dann kam noch ein weiterer Rivale, Johannes, hinzu. Alle drei Feldherren brannten vor Ehrgeiz, waren dem Kaiser gegenüber loyal und einander verhasst. Jetzt rivalisierten sie zum Schaden des Reiches und ihres Kaisers. An verschiedenen Orten fanden schwierige Operationen statt, immer wieder gehemmt durch die unzureichende Zusammenarbeit. Die Bevölkerung litt unendlich, zumal auch Hungersnöte eintraten.
Schließlich sprach der Kaiser ein Machtwort: Er berief Narses im Frühjahr 539 wieder ab. Belisar war erneut alleiniger Kommandeur. Systematisch befestigte der alte Haudegen die Position Ostroms. Da tauchten unvermutet Tausende von fränkischen Kriegern in Ligurien auf. Keiner wusste, auf wessen Seite sie standen, und tatsächlich bekämpften sie Goten wie Römer. Vergebens erinnerte Belisar ihren König Theudebert (533 – 548) an seine Verpflichtungen gegenüber dem Kaiser, und die Goten hatten keinen Vorteil von ihrem Landverzicht. Die Franken zogen erst ab, als auch sie von Seuchen und Versorgungsengpässen bedroht waren. Einige Teile des ostgotischen Gebiets hielten sie dennoch unbehelligt besetzt.
Wie ein Kugelblitz hatte die fränkische Invasion Oberitalien durchsaust, vieles in Brand gesetzt, aber die Machtverhältnisse nicht grundlegend verändert. Der römische Druck wuchs, und für die Goten wurde es immer enger. Ende 539 begann die Belagerung Ravennas, das zu Land und zu Wasser eingeschlossen wurde. Doch die Stadt, in der König Vitigis ausharrte, war gut versorgt, und dank ihrer Lage in den Lagunen praktisch uneinnehmbar. Während Belisar die Ravennaten auszuhungern suchte und viele Goten in Italien zu ihm überliefen, nahmen der römische Feldherr und der Ostgotenkönig wieder Verhandlungen auf.
Da fassten die Goten, vom Hunger gequält und mit Vitigis ohnedies unzufrieden, einen kühnen Entschluss. Sie boten Belisar ihre Unterwerfung an – unter der Maßgabe, dass er selbst Kaiser des Westens werde. 476 war Romulus Augustulus abgesetzt worden, jetzt, 540, sollte er einen Nachfolger bekommen. Belisar nahm im Mai an, indem er einen Eid darauf leistete und zusagte, die gotischen Traditionen zu respektieren, aus römischer Sicht Hochverrat. Die Tore wurden ihm geöffnet, er zog in die Stadt ein und kümmerte sich um die Versorgung mit dem Lebenswichtigen. Vitigis wurde als Kriegsgefangener mit allen Ehren behandelt, die gotischen Kommandeure strömten nach Ravenna, um dem neuen Herrscher des Westens zu huldigen. Erst als Belisar sich auf kaiserlichen Befehl daran machte, gen Konstantinopel aufzubrechen, erkannten die Goten, dass sie verraten waren. Wer konnte, floh. Der römische Sieg schien da. Alles war jetzt gut aus römischer Sicht. Doch es schien nur gut.
Totilas Zwischenerfolge
Es hatte ja die Verdunkelung der Welt gegeben, die Pest begann um sich zu greifen, zudem attackierten die Perser erfolgreich Syrien, und die kirchlichen Streitigkeiten, die das Römische Reich heimsuchten, wurden stärker. Ende 541 einigten die Goten sich nach viel Streit auf einen gewissen Totila als König. Die Gewichte begannen sich zu verschieben. Vermutlich überraschte Totila die Römer mit seinen energischen Anstrengungen im Kampf, doch dürfte man ihn anfangs kaum ernstgenommen haben. Das sollte sich ändern. In der Darstellung Prokops wurde Totila zum strahlenden Feind Roms, in dem sich der ganze Mut der Goten, ihre Widerständigkeit zu verkörpern schien, und man kann ihm eine bemerkenswerte Fähigkeit, Menschen zu motivieren und unter schwierigen Umständen durchzuhalten, gewiss nicht absprechen.
Justinian scheute offenbar eine Konzentration der Kräfte in Italien – eine Massierung hätte für den misstrauischen Kaiser gefährlich werden können. Es war so kein Krieg mit einer klaren Front, er wurde vielmehr auf einzelnen kleineren Kriegsschauplätze ausgetragen, flammte kurzzeitig an dem einen, dann an dem anderen Ort auf.
Wo sie die Macht besaßen, begannen die Römer Steuern streng einzutreiben und machten sich damit unbeliebt. Das bereitete Totila den Boden; seinen Kampf gegen Justinian inszenierte er als Kampf Italiens gegen eine Bedrückung, nicht einfach als Krieg der Goten gegen die Römer; manch ein römischer Überläufer schloss sich ihm an. Selbst die Senatoren suchte er für sich zu gewinnen, doch vergebens, zumal auch er sie von ökonomischen Zumutungen nicht verschonen wollte. Anders als die früheren ostgotischen Könige konnte er sich somit nicht auf eine erfahrene Verwaltungselite stützen.
Gegen Justinian kämpfte Totila seit 542 trotzdem erfolgreich, denn es ging eben gegen einen Herrscher, der mit Pest und Persern zu ringen hatte, mit römischen Militärs, die nicht in der Lage waren, ihre Aktionen zu koordinieren. Er errang Schlachtensiege, Teile Mittelitaliens fielen an ihn und 543 weite Regionen Süditaliens einschließlich Neapels, so dass die Verbindung zwischen Rom und dem getreidereichen Sizilien gefährdet war. Doch er stand auch unter Druck: Man klagte darüber, dass Totila auf dem Lande Sklaven freilasse und Kolonen von ihren Abgaben befreie, gewiss kein Ausdruck eines sozialrevolutionären Impetus, sondern, soweit sie stattfand, der Not geschuldet.
Der kaiserliche Militärapparat hingegen entfaltete sich allmählich. Erneut musste der Kaiser auf seinen erfahrensten Militär zurückgreifen. Belisar, der in der Zwischenzeit einer Intrige zum Opfer gefallen war, wurde teilrehabilitiert und 544 mit dem Kommando in Italien betraut. Begleitet von einem schwachen Heer, musste er auf eigene Kosten neue Kämpfer anwerben. Ende 544 dürfte er in Ravenna gelandet sein, doch man wusste, wie schwach seine Truppen waren. Teile seines Heeres fielen ab, und währenddessen machte Totila weiter Fortschritte. Anderswo, vor allem in Süditalien, kamen die Kaiserlichen voran; doch der dortige Kommandeur Johannes fügte sich nicht den Befehlen Belisars – das alte Problem.
Totila war erfolgreich, trotz seiner wenigen Truppen und knappen Ressourcen. 545/6 belagerten die Goten Rom erneut und nahmen die ausgehungerte Stadt am 17. Dezember 546 durch Verrat ein. Die zweite Eroberung, jetzt die einer geschwächten Stadt. Belisar lag krank in Portus; ihm fehlten die Mittel, der alten Hauptstadt so zu helfen, wie er es wenige Jahre zuvor vermocht hatte.
Der Sieg im Kampf um Rom zeigt Totila auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Selbstbewusstseins. Entgegen allen Erwartungen demonstrierte er Milde. Totila gab seine Attitüde indes bald auf. Er ließ die römische Bevölkerung, allen voran die verbliebenen Senatoren, nach Kampanien verbringen, vielleicht auch als Geiseln. Vierzig Tage soll Rom von Menschen verlassen gewesen sein. Diese Behauptung ist gewiss übertrieben, gibt aber einen Eindruck von dem Schrecken. Immer mehr erwiesen die Truppen Totilas, die sich zunehmend aus dem Krieg ernähren musste, als Schreckgespenst und mutierten zu einer Gewaltgemeinschaft.
Und die Lage änderte sich: Totila versuchte als Herr Roms Friedensverhandlungen mit Justinian zu eröffnen, scheiterte aber damit. Trotz aller Schwierigkeiten Belisars währte die Zeit der gotischen Herrschaft über Rom nur kurz. Schon im April 547, als die Kaiserlichen in Süditalien vordrangen, musste Totila seine Truppen aus dem übergroßen, nicht zu verteidigenden Mauerrund abziehen – eine Entwicklung, die für sein Wirken, für die Überdehnung des gotischen Potentials charakteristisch ist. Belisar rückte wieder ein, befestigte die Stadt neu und führte die Bevölkerung heim, während Totila sich Schmähungen von seinen Leuten anhören musste. Die dritte Besetzung Roms wird mithin als eine geschildert, von der die Bevölkerung profitierte, jedenfalls die römische.
Weiter gingen die zermürbenden Kämpfe der geschwächten Kriegsgegner; in verschiedenen Teilen Italiens kämpfte man jetzt. Ein Waffenstillstand mit den Persern im Jahre 545 erlaubte es Justinian sogar, eine gewisse Verstärkung zu schicken, aber weniger, als Belisar für nötig hielt. In verschiedenen Teilen erlebten und erlitten die Soldaten wie die Zivilbevölkerung Scharmützel und Gefechte, Belagerungen und Eroberungen, aber eine Entscheidungsschlacht kam nicht zustande. Belisar wurde schließlich 548/9 abberufen und zunächst nicht durch einen Oberkommandierenden für Italien ersetzt; weiter ging das Hin und Her. Das muss für die gewöhnliche Bevölkerung Italiens furchtbar gewesen sein.
Wohl Anfang 550 geschah, was alle Freunde Roms schockieren musste. Rom fiel neuerlich an Totila, die vierte Eroberung der Stadt. Der König verfuhr jetzt anders als bei der ersten Besetzung: Er reparierte die Mauern, siedelte Menschen an, darunter auch die von ihm exilierten Senatoren – und hielt Wagenrennen ab. So meldete er an, dass er sich dem Kaiser ebenbürtig fühlte. Vermutlich waren dies übrigens die letzten Wagenrennen im Circus Maximus. Eine Tradition, die mehrere Jahrhunderte gewährt hatte, kam an ihr Ende, und dafür stand ein gotischer Herrscher in der Ewigen Stadt. Dies schien den Sieg der Goten zu repräsentieren. Alle schien gut, jetzt aus gotischer Sicht. Doch nichts war gut.
Der Sieg des Narses
Wieder bot Totila dem Kaiser Frieden an, wieder vergebens. Da holte Totila zum vermeintlich tödlichen Schlag aus, indem er das kornreiche Sizilien angriff. Neue Kommandeure entsandte der Kaiser, mit geringem Erfolg, schließlich griff er auf den vielbewährten mit ihm verwandten Germanus zurück. Die Witwe des Vitigis, Mathesuentha, wurde seine Gemahlin, so dass auch Goten hoffnungsvoll auf ihn blicken mochten. Die gotische Prinzessin hatte sich mit einem führenden Römer verbunden, der tatsächlich den Feldzug nach Italien übernehmen sollte. Ihn erreichten Angebote von Goten, die bereit waren, zu ihm überzugehen. Endlich war der Gotenkrieg militärisch und psychologisch so wohlvorbereitet, dass er einfach gelingen musste. Doch Germanus starb auf dem Marsch nach Italien.
Narses, Justinians Mann für schwere Fälle, erhielt den Oberbefehl über Italien, und ihm gelang es, ohne ernstzunehmenden Rivalen zu agieren. Er führte jene große Zahl von Truppen zusammen, die sich Belisar immer gewünscht hatte, zudem erhielt er Geld genug, um seinen Männern ihren Sold zu zahlen wie auch den ausstehenden Sold an die Truppen in Italien. Überraschend schnell drang er nach und in Italien vor. Sein Vorgehen war weitaus energischer, als man es lange erlebt hatte. Totila versuchte an anderen Orten Stärke zu zeigen, indem er etwa einen Raubzug nach Korfu unternehmen ließ oder Sardinien und Korsika besetzte, aber das blieb ohne nachhaltigen Erfolg, auch wenn die Römer viele Schiffe verloren.
Schließlich blieb ihm nichts, als Narses entgegenzuziehen. Denn dieser stieß entschlossen nach Süden vor. Die Entscheidungsschlacht nahte, die der Gote so lange vermieden hatte. 552 stand man sich in der Nähe des heutigen Perugia gegenüber, bei Taginae/Tadinae. Die Gemarkung hieß auch Busta Gallorum, ein unheilverkündender Name, Brandstätten der Gallier. Das römische Heer war zahlenmäßig weit überlegen, ein Vorteil indes, den es in der Gebirgslandschaft, die der Gote klugerweise gewählt hatte, nur begrenzt ausspielen konnte. Die Schlacht mündete dennoch in eine blutige Niederlage der Goten, auch Totila kam bald danach zu Tode.
Dennoch gaben die Goten nicht auf. Narses drang in Italien vor, mehrere Städte, vor allem Rom vermochte er zu gewinnen, das ein fünftes Mal erobert wurde. Eine größere Gruppe entkommener Goten sammelte sich in Pavia, um dort Teja zum König zu erheben. Sie schlugen sich Richtung Süden durch, um dort den Königsschatz zu sichern. An der Südseite des Vesuvs vermochten sie eine feste Stellung aufzubauen, die von der See aus versorgt wurde. Als diese Versorgungslinie zusammenbrach, zog sich Teja mit seinen Getreuen zum Mons Lactarius zurück, dem „Milchberg“ südlich von Neapel, und stellten sich den Römern dort 552 in einem verzweifelten Kampf. Dieser sollte die Niederlage der Ostgoten besiegeln. Teja fiel im Kampf, die überlebenden Goten durften abziehen. Einige Städte hielten sie noch für Jahre; wirklicher Friede sollte so bald nicht einkehren.
Der Glanz Totilas leuchtet, so wollen es unsere Quellen, aus diesen Auseinandersetzungen hervor. Doch sein Kampf, seine Entschlossenheit, seine Beweglichkeit, seine Bereitschaft, unkonventionell zu handeln, sein Mut, führten zu nichts, die Goten vermochten nicht zu einem Ausgleich mit Ostrom zu kommen, geschweige denn ihre Stellung zurückzugewinnen. Totilas Handeln war fatal. Er brachte nur noch mehr Unheil über Italien, über gotische und römische Soldaten. Am Ende stand ein ausgeblutetes Land. Vernichtet war das Ostgotenreich, das über lange Zeit ein ruhiges Zusammenleben von Römern und Nicht-Römern im Kernland des Römischen Reiches ermöglicht hatte und durchaus in vielerlei Beziehung die klassische Tradition weitergeführt hatte. Nicht ohne Grund betrachtet ein moderner Forscher das Ostgotenreich Theoderichs des Großen als den letzten Retter der römischen Tradition, die Zerschlagung seines Reiches durch Justinian habe erst den Untergang Roms herbeigeführt, aber der hartnäckige Widerstand der Goten ist eben auch Teil der Rechnung.
Profiteur der Entwicklungen waren die Franken, die unter ihrem König Theudebert (533 – 548) mit großem Selbstbewusstsein agierten. Nicht nur, was die Goten ihm ohnehin im Bereich der Provence zugestanden hatten, sondern auch Teile Norditaliens unterwarf er sich. Nachdem er die alte Kaiserresidenz Arelate (Arles) gewonnen hatte, forderte er den Kaiser auch symbolisch heraus, indem er Goldmünzen in seinem eigene Namen prägte – ein kaiserliches Privileg – und Wagenrennen abhielt. Wer immer ihnen beiwohnte, wer immer die Münze in seiner Hand hielt, gewahrte die Schwäche des Kaisers und die Stärke Theudebert. Den kaiserlichen Anspruch der Franken sollte erst Karl der Große ungefähr 250 Jahre später realisieren. Was aber wäre geschehen, wenn der Nachfolger Theudeberts, der unmündige Theudebald (548 – 555), hätte entschlossener handeln können?
Der zweite Profiteur waren die Slaven: Das Wort Slaven war eine Fremdbezeichnung seitens der Römer für sehr unterschiedliche, schwer greifbare ethnische Gruppen, die auf dem Balkan auftauchten, wobei wir uns bewusst sein müssen, dass diese Autoren oft nur ungefähre Kenntnisse von den Völkerschaften hatten. Es ist auch gar nicht klar, ob die Völker, von denen römische Quellen sprechen, überhaupt ethnisch homogen waren oder welche Sprache sie verwendeten. Es lassen sich bestimmte kulturelle Praktiken beobachten, die sie verbanden. Vielleicht wurden sie erst durch diese Außenbezeichnung zu einer Gruppe, die sich als Slaven verstand. Auf jeden Fall gewannen nicht-römische Gruppen auf dem Balkan massiv an Bedeutung, da die römischen Ressourcen für andere Kriege genutzt wurden, und insofern profitierten sie auch von den Gotenkriegen.
Schließlich zu den Arabern. Mit arabischen Stämmen hatten die Römer seit Jahrhunderten zu tun. Sie ließen sich leicht spalten und führten oft Stellvertreterkriege für Römer und Perser. Deren Krieg mit den Persern schien am Ende der Regierungszeit Justinians beendet. Doch brach er bald wieder aus, bis die Römer 627 scheinbar den entscheidenden Sieg errangen. Doch gleichzeitig, kaum bemerkt von Persern und Römern sammelten sich Araber der Arabischen Halbinsel unter der Fahne einer Religion, des Islam. Ihnen gelangen rasche Siege. 636 wurde am Yarmuk das römische Heer besiegt. Bald gelangten weite Teile der Levante unter arabischer Herrschaft – auch nach Westen drangen sie vor, bekanntlich über die Iberische Halbinsel bis zum Frankenreich, ferner nach Sizilien.
Drei im 6. Jahrhundert teils kaum definierte, jedenfalls zerstrittene Gruppen von der Peripherie profitieren mithin vom Ressourcenmangel des Römischen Reiches. Der Sieg Justinians war ein Pyrrhussieg. Er schwächte das alte Kernland des Reiches, Italien, auf Dauer, er rieb Ressourcen des Römischen Reiches auf, das seinen Schwerpunkt im Osten hatte. Die Niederlage der germanischen Goten trug dazu bei, die Grundlagen der klassischen Mittelmeerwelt zu zerstören, die sie mitgetragen hatten.