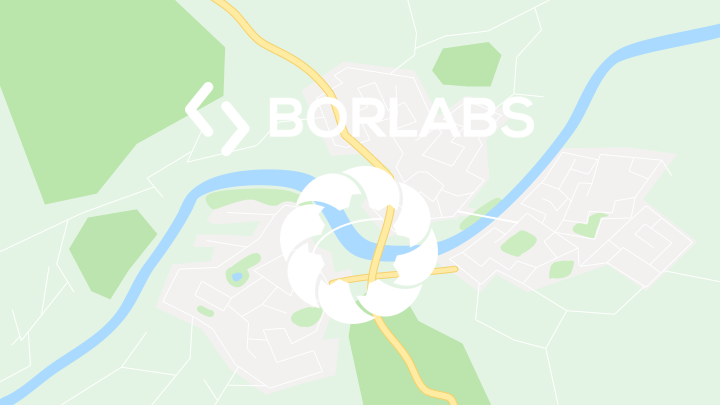Biografisches
Edith Stein ist nicht auf einen einfachen Nenner zu bringen. Vieles, was anderswo auseinanderfällt, ist bei ihr notgedrungen unter Zwang, aber auch durch eigenen Entschluss zusammengehalten worden: Judentum und Christentum, aber auch Wissenschaft und Religiosität, Intellekt und Hingabe, anspruchsvolles Denken und Demut. Es gibt zwei Gesichter, die doch eines sind: die selbstbewusste, selbstkritische Doktorin und die Braut des Lammes mit dem rätselhaft schmerzlichen und tief innerlichen Gesichtsausdruck bei der Einkleidung. Dazwischen liegt ein Abstand, den Edith Stein wirklich mit Blut, mit Feuer, mit Leben, mit Glück, mit holocaustum gefüllt hat.
Das ungewöhnliche Leben dieser Frau, die seit 1999 zu den drei Mitpatroninnen Europas zählt, strebt in seiner ersten Hälfte steil und selbstsicher nach oben. Als elftes Kind einer jüdisch-kleinbürgerlichen Familie am 12.10.1891 – dem jüdischen Versöhnungstag – geboren, studiert die Einserabiturientin Philosophie, Germanistik, Psychologie und Geschichte in ihrer Heimatstadt Breslau, geht dann zum Philosophiestudium nach Göttingen – ein rascher intellektueller Aufstieg, der lange Zeit keine wirklichen Widerstände kennt. Die junge Frau, selbstsicher und hochbegabt, ist schon in den 20er Jahren bekannt als Meisterschülerin des großen Phänomenologen Edmund Husserl, der sie 1916 in Freiburg promoviert und anschließend – eine Premiere – als erste deutsche Assistentin in Philosophie anstellt.
Edith Stein vertritt einen Typus, der uns bei heiligen Frauen nicht vertraut ist. Sie hat nicht das Mütterliche der großen Elisabeth, nicht das Sorgende der Heilerinnen Hildegard oder Walburga, sie hat auch nicht das Dienende und Zurücktretende wie die Küchenschwester Ulrika Nisch, die mit ihr 1987 seliggesprochen wurde. Edith Stein vertritt den modernen Typus der selbstbewussten, intellektuellen Akademikerin. Sie gehört zu den ersten Frauen in der Männerdomäne Philosophie und hat, angezogen von der Wahrheitssuche, einen Lehrstuhl angestrebt, aber vier Habilitationsversuche zwischen 1918 und 1932 sind missglückt.
Zu der frühen, emanzipierten Studentin gehört auch psychologischer Scharfblick. Ihre Freunde schätzten sie und wichen ein wenig ihrer kritischen Zunge aus. „Entzückend boshaft“ konnte sie Fehler in einer Pointe aufspießen. Aber die junge Frau erfährt einen Umschwung durch große Leiden. Die überzeugte Patriotin – und sie blieb Schlesierin, Preußin und Deutsche bis zu Auschwitz – leidet unter dem Kriegsausgang 1918, unter dem Schicksal vermisster und gefallener Kommilitonen. Sie leidet auch an zwei unglücklichen Lieben; weder Roman Ingarden noch Hans Lipps erwidern ihre starke Zuneigung. Die Universität hat sich ihr – seit der eigenen Kündigung bei Husserl 1918 – verschlossen; sie hält private Seminare in Breslau. Aber die Philosophie kann die andrängende Sinnfrage nicht mehr beantworten.
Zwischen 1917 und 1921 tastet sich Edith Stein durch eine Wüste. Sie greift nach der Gestalt Jesu, sie liest Luther. Zunächst kannte sie nur den Protestantismus innerhalb der christlichen Konfessionen. Der Katholizismus in Breslau schien etwas „für die Dienstboten“: etwas Merkwürdiges, Unverstandenes, Abergläubisches. Sie liest das Brevier und Augustinus, sie liest Teresa von Avila – ihr Kopf arbeitet, das Herz noch nicht.
Aufstieg nach unten
Am Ende dieser Suche, auch der Lebensenttäuschungen, springt der Entschluss zur Taufe auf – in einer Juninacht 1921 in Bergzabern. Es ist Teresa von Avila, die mit ihrer „Lebensbeschreibung“ drei Entscheidungen auslöst: Christin, Katholikin, Karmelitin zu werden. Nach Taufe und Firmung 1922 kommt es freilich zunächst nur zum Lehrerinnenberuf im Lyzeum der Dominikanerinnen in Speyer (1923-1931). Mit der Taufe beginnt jedoch ein Zurückbiegen in ein unauffälliges und nach innen gewendetes Leben.
Nach einigen Vorträgen zum Thema „Frau“ ab 1928 tut sich ein größerer Wirkungskreis auf. Aber das Deutsche Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster (1932/33) wird der jüdischen Dozentin im Frühjahr 1933 verschlossen, und nun erfüllt sie sich den heimlichen Wunsch nach dem Karmel. Edith Stein hatte zwei Zuhause: in Breslau bei ihrer Mutter Auguste Courant – welche starke Frau im Porträt der Tochter in vielen Zügen enthalten ist. Das zweite Zuhause war die Kirche und im eigentlichen Sinn der Karmel. Gertrud von le Fort, tief beeindruckt von Edith Steins Erscheinung, schrieb 1952: „Im Karmel findet die Welt unserer Tage die Reihe der unerbittlichen Abschiede, wie sie heute von ihr verlangt werden, religiös vorgelebt – sie findet die ihr selbst so notwendige, vor nichts mehr zurückschreckende Verfügungsbereitschaft gegenüber den heute mehr denn je verhüllten Ratschlüssen Gottes – sie findet die Möglichkeit, in jede Nacht gläubig einzutreten als eben nicht mehr ihre eigene Nacht, sondern als die Nacht Gottes – im Karmel findet sie auch das unverständlichste ihrer Leiden gewürdigt, durch Aufopferung an die Ewige Liebe einbeschlossen zu werden in die Teilnahme am Erlösungsleiden des Kreuzes.“
Edith Steins Leben beugt sich nach einer steilen Aufwärtsbewegung an der Universität nach unten und nach innen. Alles, was an ihr unausgereift war, zu spitz, zu hell, zu selbstsicher, wird ihr in der zweiten Hälfte aus den Händen gewunden. Es gibt die verschlossene, die kluge, die beherrschte Meisterdenkerin Edith Stein. Es gibt auch die warme, mütterliche, Freundschaft und Halt gebende Karmelitin Teresia Benedicta vom Kreuz. Karmel ist der Ort, an dem sie sich in ungeahnter Weise noch einmal löst, wie nie zuvor in ihrem bürgerlichen Leben. Als die 42jährige, noch erschöpft von ihrem überaus schmerzlichen Abschied von der Mutter in Breslau, am 15.10.1933 die Schwelle des Kölner Karmels überschritt, begann ein letzter Lebensabschnitt. Wie kurz er sein würde, knapp neun Jahre, war nicht vorauszusehen. Ihre Arbeiten bis 1933 waren gedruckt; alles Spätere verschwindet in der Schublade.
In den Briefen dieser Jahre ab 1933 erscheint ein doppelter Zug: geistlich ebenso fruchtbar wie politisch düster. So sehr das Glück des inneren Weges spürbar wird, weil „der Herr mich wieder als kleines Kind behandelt“, so sehr wird zugleich das sich über dem jüdischen Volk zusammenziehende Unheil spürbar. In einem Brief von 1938 erscheint erstmals die Gestalt der „kleinen Esther“, die zum Sinnbild des eigenen Betens und Leidens für andere wird. Die von Gnade durchleuchteten Tage in Köln verschatten sich; ab der „Kristallnacht“ vom 9.11.1938 mit der Zerstörung der Synagogen und jüdischen Geschäfte wird die Flucht ins Ausland unabweislich. Ende 1938 wechselt die Karmelitin nach Echt/Holland – in der Hoffnung, dort den Nationalsozialisten zu entgehen.
Freilich zeigen die Briefe auch die nachdrückliche Tatsache an, dass Edith Stein nicht nur von der letzten Woche ihres Martyriums her zu lesen ist. Ihre öffentliche Sendung liegt bereits im Schritt aus der Welt der Wissenschaft in den Karmel. 1933 ist das Jahr, in welchem die vom familiären Trennungsschmerz verdunkelte, doch zielsichere Entscheidung zur endgültigen Hingabe fällt – alles Spätere ist darin im Kern einbeschlossen. Auch die Erkenntnis, dass der „Aufstieg auf den Berg Karmel“ wirklich vollzogen einen Abstieg bedeute. Der Abstieg führt ins Verborgene: in das nicht mehr unterbrochene Zwiegespräch mit dem Herrn ebenso wie in die „Tiefe der eigenen Seele“.
Karmel war Glück, Ankunft, aber ein Glück, von dem die Karmelitin weiß und ahnt, dass es Leiden-Müssen heißt. Sie stimmt dem Leiden zu, noch ohne seine Form zu kennen. Sie begreift es rasch als Kreuzesnachfolge, begründet in der „Blutsverwandtschaft“ mit Jesus. Und so macht sie, längst bevor sie dem leiblichen Martyrium ausgeliefert wird, ein innerliches Martyrium durch. Erich Przywara, der sie in den 20er Jahren geistlich begleitete, sprach später von einem „Antlitz des Einsturzes“.
Zeitliches Ende
Edith Stein wendet sich im Karmel endgültig ins Unsichtbare zurück; auch ihr Lebensende entzieht sich fast ganz ins Dunkel. In dem Passbild von 1938 verdichtet sich freilich einiges zur Sichtbarkeit: „Für diejenigen, die Edith von früher her kannten, war die Photographie (…) so fremd, daß wir das Bild fast nicht ansehen konnten. Ihr einfaches, unschuldiges, fast immer fröhliches und liebliches Wesen war durch Leiden ganz entstellt“, schrieb Hedwig Conrad-Martius, ihre Freundin und Taufpatin.
Nach der Besetzung Hollands im Mai 1940 durch die Nazis wird der Zugriff auch dort spürbar. Teresia Benedicta versucht, für ihre katholisch gewordene Schwester Rosa und sich selbst im Schweizer Karmel von Le Pâquier Aufnahme zu finden, was von den dortigen Behörden zu lange hinausgezögert wird. Am 26.7.1942 lassen die niederländischen Bischöfe ein Hirtenwort gegen die Judenverfolgung verlesen. Darauf werden in einem Racheakt die katholischen Juden, vor allem Ordensleute, verhaftet. Auch Edith Stein wird binnen einer Viertelstunde am 2.8.1942 von der Gestapo abgeholt; vor dem Einsteigen ermutigt sie Rosa: „Komm, wir gehen für unser Volk.“ Im Sammellager Amersfoort findet Edith Stein ihre Freundinnen Dr. Ruth Kantorowicz und Alice Reis, deren Taufpatin sie 1930 in Beuron gewesen war; anwesend ist auch die heiligmäßige Kölner Ärztin Dr. Lisa Maria Meirowsky und andere namentlich bekannte Gefährten. Edith Stein bildet darin eine Mitte gesammelter Ruhe. Im Durchgangslager Westerbork sorgt sie für die Kinder – anzusehen „wie eine Pietà ohne Christus“, von tiefem Kummer durchtränkt. Ein jüdischer Mitarbeiter fragt sie vor dem Abtransport am 7.8.1942, ob man noch etwas zu ihrer Rettung tun könne. Sie wehrt ab: „Tun Sie das nicht, warum soll ich eine Ausnahme erfahren? Ist dies nicht gerade Gerechtigkeit, daß ich keinen Vorteil aus meiner Taufe ziehen kann? Wenn ich nicht das Los meiner Schwestern und Brüder teilen darf, ist mein Leben wie zerstört.“ Ein Zettel mit dem Vermerk ad orientem stammt noch von einem Halt des Transportzuges im pfälzischen Schifferstadt – dann verlieren sich alle Spuren gemeinsam ins Dunkel, vermutlich in eine Gaskammer von Auschwitz am 9. August 1942.
Beginnende Ewigkeit
Auf Sr. Benedictas Schreibtisch in Echt lag ihr letztes Werk, die Kreuzeswissenschaft. Darin stehen die Sätze: „[Er] öffnet die Schleusen der väterlichen Barmherzigkeit für alle, die den Mut haben, das Kreuz und den Gekreuzigten zu umarmen. In sie ergießt sich sein göttliches Licht und Leben, aber weil es unaufhaltsam alles vernichtet, was ihm im Wege steht, darum erfahren sie es zunächst als Nacht und Tod.“ Das ist die neue/alte Deutung des Unheilen, für die Edith Stein heute steht. Kein einziges Verbrechen ist damit entschuldigt oder im Nachhinein religiös geschönt. Es gehört aber zu Edith Steins Geistigkeit und bezwingender Nüchternheit, dem Tod, „den Gott mir zugedacht hat“ (so ihr Testament), zuzustimmen und darin das Kreuz selbst zu begrüßen, ja es gerade im Zeichen des Verbrechens unmissverständlich zu erkennen.
Erinnerlich ist die erregte Debatte schon 1987 zur Seligsprechung: Starb Edith Stein als jüdische oder christliche Martyrin? Es ist zweifellos historisch redlich zu sagen, dass sie als Jüdin getötet wurde; es ist aber ebenso historisch redlich zu sagen, dass sie dieses Schicksal bewusst in der Nachfolge Jesu trug; ja, dass sie sich als Opfer auch für die endgültige Wendung ihres Volkes zu Christus verstand. Man mag dieses Selbstverständnis ablehnen – für sie selbst lässt es sich nicht abstreiten.
Das Leben solcher Zeugen verleiht den alten biblischen Behauptungen Blut und Farbe. Was Edith Stein zu verwirklichen strebt, ist das Unverdaute oder Ferngehaltene der christlichen Lehre, der Gedanke des Opfers: sich in eine Lücke einsetzen zu lassen, ohne diese Lücke selbst auszusuchen. Von daher ist ihr inneres Leben, so sehr es Anzeichen einer großen Freude gibt, wie von dem Schleier eines nahenden, dunklen Geheimnisses verhüllt.
Ihr zerstörtes Leben geht in eine kaum auszuleuchtende Stellvertretung über. Sühne ist im Munde Edith Steins kein sentimentales Missverständnis, keine überlebte theologische Vokabel. Sühne ist das unerklärlich Wirksame im Gewebe des gemeinsamen Daseins. Man sollte sich hüten, eine solche umfassende Versöhnung in einzelne Posten aufzulösen und nach den unmittelbar greifbaren Ergebnissen zu fragen. Edith Stein hat ein doppeltes Zeugnis vorgelegt: Sie hat Gott als den Leben-Steigernden erfahren, sie hat ihn auch als den Leben-Fordernden erfahren. Denken wir das Undenkbare, wenn der Name Auschwitz fällt: Es ist dort eine Frau auch „für Deutschland“ gestorben. Dank ihrer Proexistenz war noch im Grauen von Auschwitz Gnade wirksam. Wir Nachgeborenen sind zur dauernden Antwort auf die Schuld der Vorfahren gezwungen – aber dieses befleckte Land ruht auf den Schultern vieler Martyrer.
Geben wir das letzte Wort Reinhold Schneider: „Edith Stein, die vom Kreuz gesegnete Teresia, ist eine große Hoffnung, ja eine Verheißung für ihr Volk – und für unser Volk, gesetzt, daß diese unvergleichliche Gestalt wirklich in unser Leben tritt, daß uns erleuchtet, was sie erkannt hat, und die Größe und das Schreckliche ihres Opfers beide Völker bewegt.“