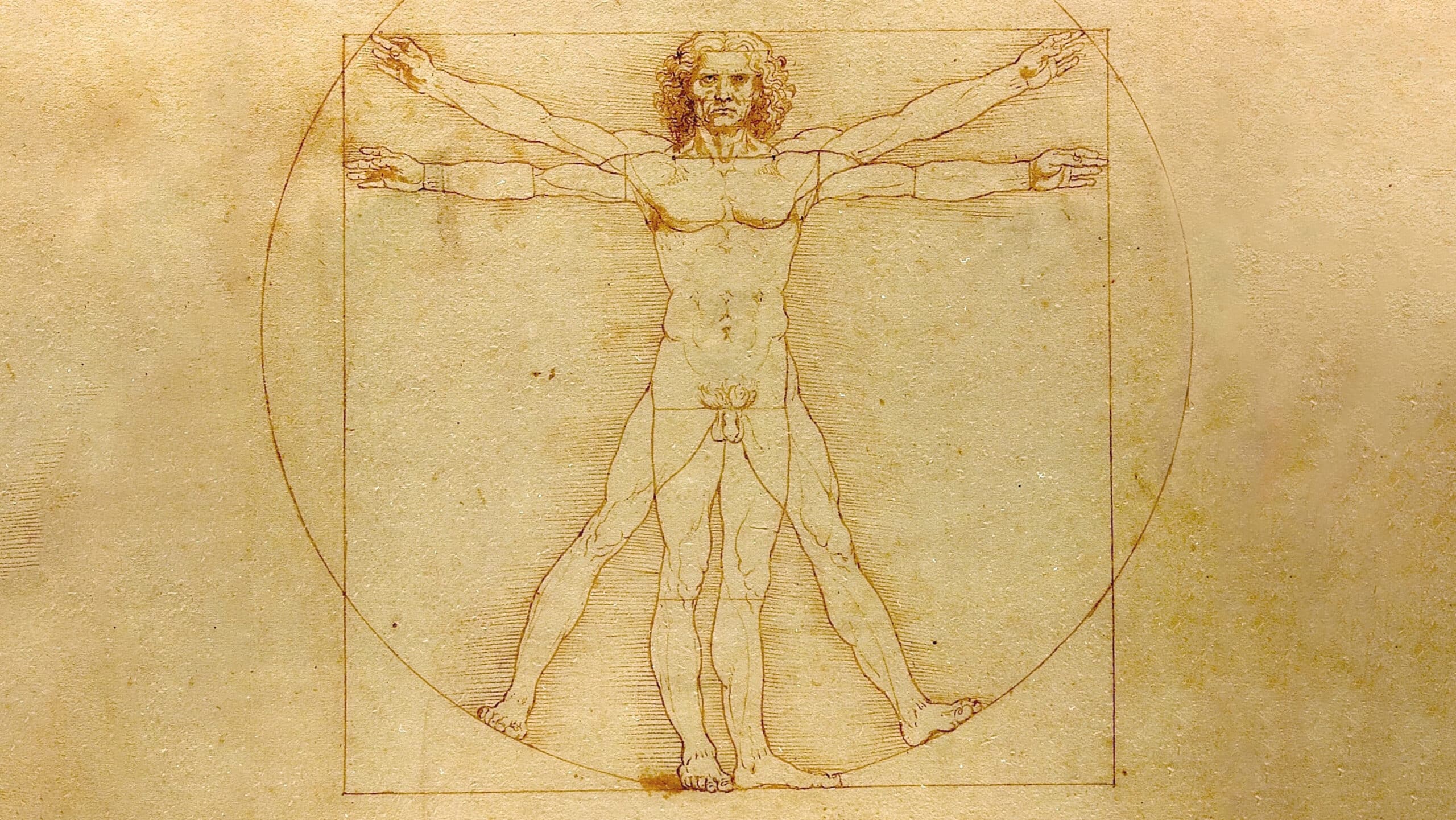Die christliche Botschaft ist auf vielfältige Weise mit Humanität verbunden. Das lässt sich in einem kurzen Vortrag lediglich andeuten. Also beschränkt sich der folgende Text darauf, die Verschränkung von Humanität und Christentum zu umreißen.
I.
Wir haben nur vage Vorstellungen von der geschichtlichen Entstehung des Begriffs der Menschheit. Aber es gibt die naheliegende Vermutung, dass dies mit der Entstehung der großen Kulturen im eurasisch-afrikanischen Raum, mit der Entfaltung institutionalisierter Religionen und mit der Verbreitung der Schrift durch ein kundiges Personal zusammenhängt.
Erste philosophische Konturen findet der Begriff dann in den Lehren der Vorsokratiker, von denen wir heute nur noch Bruchstücke kennen. Anders ist es mit der Philosophie, die Platon, von Sokrates angeregt und in seinem eigenen Denken so tiefsinnig wie kunstvoll zum Vortrag gebracht hat. Damit war zugleich der Anstoß zu einer wissenschaftlichen Form des philosophischen Denkens gegeben; Aristoteles sowie die nachfolgenden Schulen der Skeptiker, Stoiker und Epikuräer haben bereits zu verschiedenen Formen begrifflicher Fassung auch der Vorstellung vom Menschen geführt.
Eine weiterführende Präzisierung findet sie dann im Werk des großen, vorwiegend platonisch gesonnenen Anwalts der römischen Republik, der das drohende Ende seiner bereits demokratisch inspirierten politischen Kultur abwehren will: Marcus Tullius Cicero gibt dem Begriff der humanitas eine auf die persona und ihre dignitas gestützte, gleichermaßen innere wie äußere Fassung.
Cicero wird zwar von seinen Gegnern verfolgt und auf der Flucht ermordet; aber seine Schriften wirken auch nach dem fast einem halben Jahrtausend währenden Imperium fort und entfalteten eine breite Wirkung, die dann, weitere tausend Jahre später zum Aufstieg einer neuen Geisteshaltung führt, die bis heute unter dem Titel des Humanismus nachwirkt.
II.
Diese spätere Karriere ist auf das Engste mit der Ausbreitung des Christentums verbunden, dem sie schon in der Scholastik und dann in der langen Vorgeschichte der Reformation neue Impulse geben konnte. Dass darüber selbst noch 2017 beim Gedenken an die Reformation nach 500 Jahren nicht gesprochen werden sollte, zeigte, wie tief der Stachel im Fleisch der Kirchen noch heute sitzt.
Doch darüber wollte und will ich heute nicht sprechen. Ich möchte nur daran erinnern, dass Cicero der erste ist, dem wir unmittelbar vor und in der durch Christi Geburt markierten Zeitenwende ein Bewusstsein von der Bedeutung der Humanität verdanken.
Es ist nämlich so, dass bereits zwei Generationen nach Cicero gänzlich unabhängig von den erwähnten politischen und philosophischen Traditionen – und auch ohne auch nur den Begriff der Humanität zu erwähnen – das Anliegen der Humanität in einem uns auch heute noch zutiefst bewegenden Geschehen zur denkbar größten Menschheitsaufgabe erklärt worden ist. Festgehalten ist dieses Geschehen im Neuen Testament, in dem auch die humanistische Botschaft in einer bis heute durch nichts übertroffenen Anschaulichkeit und Eindringlichkeit ausgesprochen ist. Und das Unerhörte ist, dass diese Botschaft von einem Menschen ausgesprochen wird, der die Kühnheit hatte, sich als Mensch gewordener Gottessohn zu bezeichnen.
Wenn man einmal beiseitelässt, dass darin, wie es viele Zeitgenossen verständlicher Weise empfunden haben: eine Gotteslästerung liegen kann, ist das die denkbar beste Illustration der Funktion, in der sich der Mensch, unter Inanspruchnahme der Menschheit, einem Selbstverständnis verpflichtet, dem er weder in seiner natürlichen noch in seiner alltäglichen Verfassung genügen kann. Doch in der Selbstbezeichnung des Christus als Gottessohn wird diese Grenze zwischen Mensch und Gott aufgehoben, um sie im Kreuzestod dieses Christus sogleich wieder in Geltung zu setzen. – Doch auch darüber möchte ich nicht sprechen!
III.
An dieser Stelle muss es genügen, daran zu erinnern, wie dieser Jesus Christus über den Menschen gesprochen hat. Die humane Unmittelbarkeit des christlichen Glaubens, der es wagt, das selbstverschuldete Leiden des Menschen an sich selbst ins Zentrum seiner Zuversicht zu stellen, hat im ersten Jahrhundert der neuen Zeitrechnung und immer noch im Zentrum der antiken Welt ein unerhörtes Zeugnis für die Humanität der Heilsgewissheit gegeben. In ihr konnte ein Mensch für seinesgleichen sterben. Im Vertrauen auf die Einheit von Mensch und Welt hat er zu einer die Grenzen von Völkern und Sprachen überschreitenden Mobilisierung des menschlichen Glaubens an die Menschheit – und über sie – dann auch zu Gott geführt.
Der initiale Impuls der neuen Religion liegt in der Neubestimmung des Verhältnisses des Menschen zu seinesgleichen. Ausschlaggebend ist der Primat der Mitmenschlichkeit in der Erwartung einer persönlichen Beziehung zu seinem nicht einfach nur für „alles“, sondern vornehmlich immer „für den Menschen“ zuständigen Gott, den jeder Mensch mit „Du“ ansprechen kann. Diese Personalisierung Gottes wird dadurch gesteigert, dass er als Vater eines Menschensohns angesehen werden kann, zumal der Gott in dieser Beziehung seine absolute Vormachtstellung nicht verliert, wohl aber, in unfassbarer und umso beglückender Paradoxie, den Menschen nicht nur überhaupt, sondern auch persönlich nahekommt.
Das Beispiel eines für seinesgleichen sterbenden Individuums, geht mit einer radikalen Individualisierung des einzelnen Menschen einher. Sie sieht von allen sozialen und politischen Besonderheiten ab, achtet nicht auf die vorgängige Mitgift und Bildung und ist gleichgültig gegenüber dem die Kulturgeschichte der Menschheit dominierenden Unterschied zwischen den Geschlechtern, zwischen reichen und armen Menschen sowie zwischen Mächtigen und Schwachen.
Von der strikten Prämisse der weltlichen Gleichheit rückt die dem christlichen Glauben dienende Kirche später zwar mit Blick auf die Stellung ihrer Priester wieder ab; und hier dominieren dann doch wieder Männer, die sich schriftkundig machen und als Leiter ihrer Gemeinden über größeren Einfluss verfügen.
Aber da die Lehre immer wieder auf das Beispiel zurückgeht, das der Gründer in seinem Leben und Leiden gegeben hat, bleibt das Kernstück der christlichen Botschaft durchgängig präsent: Es ist der einzelne Mensch, dem, auch wenn er nicht zur Gemeinschaft der Gläubigen gehört, geholfen werden muss. Das wird im Gebot der Hilfeleistung deutlich, für das sowohl das Beispiel des barmherzigen Samariters steht wie auch die Erzählung einer über alle politischen und sozialen Schranken hinwegsehenden Heilung eines Knechts des Hauptmanns der römischen Besatzungsmacht. Zudem macht die christliche Botschaft, wie bereits erwähnt, keinen Unterschied mehr zwischen Frauen und Männern – und auch die Kinder sind ihr ausdrücklich willkommen. Wem an der Humanität liegt, der muss auch das für bemerkenswert halten.
Hinzu kommt, dass es gegenüber denen, die das Wort, aus welchen Gründen auch immer, nicht erreicht, weder Zwang noch Gewalt geben darf. Wenn jemand nicht durch eigene Einsicht zum Christen wird, dann muss man ihm seinen abweichenden Willen und Glauben lassen. Wie immer die nachfolgende Praxis der christlichen Kirchen ihren Ursprungsimpuls auch verkannt oder missachtet haben: In seinem Ursprung ist das Christentum auf die strikte Achtung vor der Existenz und dem Willen des einzelnen Menschen, auf die Botschaft einer über alle biologischen, sozialen und politischen Unterschiede der Menschen erhabenen theologischen Bedeutung der Einzelnen und damit auf einen metaphysischen Vorrang der Individualität gegründet.
Wie weit der für seine Botschaft sterbende Jesus dabei geht, lässt sich am Beispiel seines Anspruchs auf eine entschiedene Lösung von den Fesseln der Tradition kenntlich machen: In Lukas 9, 60, lesen wir von einem angehenden Jünger, der, bevor er Jesus folgen will, einer nicht nur bei den Juden als vorrangig geltenden Sohnespflicht nachkommen möchte. Der Jünger spricht: „Herr, erlaube mir, dass ich“ [bevor ich dir nachfolge] „hingehe und meinen Vater begrabe.“ Aber Jesus spricht zu ihm: „Lass die Toten ihre Toten begraben; gehe du aber hin und verkünde das Reich Gottes!“
Diese auf schroffe Weise inhuman wirkende Aussage kann einem den Atem verschlagen; aber sie scheint, wie auch in Matthäus 8, 22 tatsächlich in diesem Sinn gesprochen worden zu sein. Sie bringt die Gleichgültigkeit gegenüber allen äußeren Konventionen zum Ausdruck – unabhängig von der alten Religion, die Jesus für unzulänglich hält. Aber er hätte dennoch den Wunsch eines Sohnes achten können, bei der Bestattung seines Vaters anwesend zu sein, ganz gleich nach welchen Gepflogenheiten das geschieht. Dass darin auch ein persönlich vorrangiges Bedürfnis eines Menschen liegen kann, scheint ohne Belang zu sein. Das überrascht, weil die Antwort Jesu doch zeigt, dass er die Menschen lehren will, ihr persönliches Heil als vorrangig anzusehen. Denn seine frohe Botschaft legt den Menschen nahe, ihr eigenes Leben und damit auch die Stimme ihres eigenen Herzens wichtig zu nehmen.
Tatsächlich lässt Jesus, wie es scheint, den Jünger ziehen, damit der seine Sohnespflicht erfüllen kann, und nimmt ihn anschließend in den Kreis seiner Anhänger auf. Hinzu kommt, dass Jesus wie kein anderer Religionsgründer vor oder nach ihm Nächstenliebe predigt, für die man ja auch durch die Anteilnahme nach dem Tod eines Nächsten ein Zeichen setzen kann. Hier kündigt sich ein Personalismus reinsten Gewissens an. Und tatsächlich ist nur von ihm eine Hingabe an das Göttliche zu erwarten, mit der die Menschheit der eigenen Person nicht aufgegeben, sondern bekräftigt wird. Hier schließt der christliche Glauben nahtlos an den Humanismus Ciceros an, der die Würde einer sich selbst treu bleibenden Person zu wahren sucht.
IV.
Man muss sich nur den in vielen Episoden überlieferten Lebensweg dieses Jesus von Nazareth ins Bewusstsein rufen, um auch ohne aufwändige Deutung und ohne religiöse Voreingenommenheit erkennen zu können, wie entschieden die christliche Lehre von den Äußerlichkeiten des sozialen Lebens absieht. Der Überbringer der existenziellen Heilsbotschaft kommt unter erbärmlichen Verhältnissen in einem Stall in der Gesellschaft von Ochs und Esel zur Welt, und die ersten Besucher sind Hirten von den umliegenden Feldern. Ob er, noch „in den Windeln“ in einer Futterkrippe liegend, tatsächlich Besuch von drei Weisen, gar von Königen aus einer der reichsten Gegenden des Orients erhält und mit Kostbarkeiten beschenkt wird, können wir getrost als Hinzufügung späterer Berichterstatter ansehen; hier dürfte der so verständliche, wie ahnungslose Wunsch am Werk gewesen sein, den armselig zur Welt gekommenen Gottessohn wenigstens durch weltliche Reichtümer aufzuwerten.
Doch wer solche Ergänzungen für nötig erachtet, dürfte die Pointe der Weihnachtsgeschichte verfehlen, die von Verfolgung, Flucht und realer Armseligkeit erzählt, damit jeder erkennen kann, wie unerhört der Lebensweg dieses allein auf sein Wort und seine Taten konzentrierten Menschen ist, der dann als Wanderprediger, Autodidakt und Rabbi, gar als verspotteter Gottessohn, der allen das Heil und die Erlösung verheißt, aber vollkommen erniedrigt, verhöhnt und von einem brutalen Wachpersonal schmachvoll zu Tode gequält, sein kurzes Lebens endet.
Wenn man in der Geschichte des Denkens nach Parallelen zu dieser Biographie des Jesus sucht, kann man sich an die niedrige Geburt und den im Stand des Steinmetzen nicht sonderlich geschätzten Sokrates erinnert fühlen, vielleicht auch an den einen oder anderen Sklaven, der zum geschätzten Komödiendichter, zum bekannten Philosophen oder zum Revolutionär aufsteigt. Aber diese Beispiele, so erstaunlich sie sind, bleiben unvergleichlich, weil Jesus ohne äußeren Zwang die Nähe zu den Hilflosen, Kranken und Kriminellen sucht, um auch aus deren Sicht von dem sprechen zu können, was immer auch zum Menschlichen gehört.
Dieser Jesus heilt Aussätzige, legt Wert auf die Verbindung zu den geächteten Zöllnern und lässt im heilsgeschichtlichen Versprechen seiner Botschaft keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, Religionen und Nationen zu. Als Menschen sind alle gleich – und vor Gott sind sie allesamt mit ihrem Verlangen nach Erlösung gerechtfertigt – wann und wie immer sie in ihrem allemal kindlichen Glauben zu ihm gefunden haben.
Hinzu kommt, dass die Texte des Neuen Testaments ohne politische Ambitionen zu sein scheinen. Der Menschensohn ist weit davon entfernt, ein soziales Programm zu verkünden oder auch nur die Befreiung von der römischen Fremdherrschaft zu fordern. Er ist als das Gegenteil eines Aufrührers anzusehen. Wer ihn aus postrevolutionärem Sensationsbedürfnis nachträglich zu politisieren sucht, hat das eigentlich Umstürzende dieses Zeugen einer menschheitlichen Botschaft nicht verstanden.
Gewiss: Der Umgang, den er mit den Gegnern der Juden pflegt, und seine praktizierte Toleranz gegenüber seinen jüdischen Verfolgern, sind bereits in seiner Zeit von eminenter politischer Bedeutung. Auch die hochsymbolische Tatsache, dass schon kurz nach seiner Geburt in jenem Stall, in dem seine Eltern, vor allem seine hochschwangere Mutter, Zuflucht gefunden haben, die drei sternkundigen Sendboten aus dem Osten mit kostbaren Geschenken ihre Aufwartung machen, hat einen schwerlich zu übersehenden politischen Nebensinn: Er weist, wie auch die Missionserwartung des Christentums, nicht nur über die Grenzen Judäas, sondern auch weit über die des Römischen Reiches hinaus. Sie ist auf diese Weise ausdrücklich auf die Menschheit als Ganze und damit auf den ganzen Erdkreis gerichtet.
V.
Auch die Haltung der frühen Christen ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit: Inmitten einer Unzahl anderer politischer und religiöser Lebensformen scheint man keine Absicht zu haben, andere zu einer Änderung zu bewegen und schon gar nicht, sie dazu zu zwingen! Es genügt, wie Paulus es vorführt, vom jeweils eigenen Verhältnis zu Gott Zeugnis abzulegen – und darin anderen ein Beispiel zu geben. Mit Recht wird diese apolitisch erscheinende Haltung als Toleranz bezeichnet. Sie offenbart ein letztlich auch politisch überlegenes Bekenntnis zur Gesamtheit aller Menschen.
Das christliche Friedensgebot, wie es in der Bergpredigt verkündet wird, lässt die überkommene politische Praxis, wie einen Atavismus erscheinen. Hätte das frühe Christentum eine „politische“ Lehre, könnte auch sie nur auf Freiheit und rechtliche Gleichheit gegründet sein; sie hätte die personale Würde des Einzelnen zu achten und müsste unter Berufung auf den göttlichen Willen, die Menschlichkeit im Umgang mit jedem einzelnen Menschen wahren. Es kann nicht wundern, dass gelehrte Römer sich durch die christliche Botschaft an die Lehre Ciceros erinnert fühlten. Einigen von ihnen, die Ciceros De natura deorum kannten, erschien es selbstverständlich, dass die christliche Botschaft unter dem Einfluss dieses Buches entstanden war.
Man könnte versucht sein, die Bergpredigt als die ethische Leitlinie eines politischen Programms zu deuten, das sich nur in der Einhaltung humanitärer Grundsätze realisieren ließe. Doch das würde über das hinausgehen, was in der christlichen Heilsbotschaft verkündet wird. Und es würde der Trennung zwischen religiöser Lebensführung und politischem Handeln widersprechen. Das eine schließt das andere zwar nicht aus; doch in der christlichen Lehre besteht kein Ableitungsverhältnis zwischen Religion und einer daraus folgenden Politik.
Hier bietet die christliche Botschaft großen Spielraum, weil sie den Individuen die denkbar größte Freiheit lässt. Jesus beschränkt sich auf die Neubestimmung der Beziehung des Menschen zu seinem Gott. In der zwischenmenschlichen Konsequenz bleibt die Nachfolge Jesu auf die Verpflichtung zur Nächstenliebe beschränkt. Man könnte sie mit der römischen concordia vergleichen, die jedoch in ihrem politischen Kern auf das Bewusstsein des einmütigen Widerstands gegen Feinde gerichtet ist.
Allerdings ist die concordia bereits in Ciceros Anspruch auf Humanität und menschliche Würde von dieser Ursprungskondition des politischen Handelns freigesetzt. Und so könnte man die Nächstenliebe als eine, wenn nicht zwingende, so doch vieles erleichternde Vorbedingung des Menschenrechts und somit als eine günstige Bedingung auf dem Weg zur Rehabilitierung der Demokratie ansehen. Nur um deutlich zu machen, dass diese Deutung nicht aus der Luft gegriffen ist, berufe ich mich auf einen in diesem Punkt unverdächtigen Zeugen: auf Friedrich Nietzsche. Der hielt die Demokratie für ein „verbessertes und auf die Spitze getriebenes Christentum“.
VI.
Wir sind heute nicht mehr in der Notlage des Paulus, der tatsächlich nur seinen Glauben hatte, um sich auf ihn zu berufen, wenn er auch andere davon zu überzeugen suchte, die Nachfolge Christi zu antreten. Wir haben heute das weltgeschichtliche Faktum einer zweitausendjährigen Wirkungsgeschichte, die großartige menschliche Zeugnisse, eine vielfältige kulturelle Produktivität, uns tief berührende künstlerische Leistungen und nicht zu vergessen, eine theologische Tradition hervorgebracht hat, die uns viel zu denken gibt, aber letztlich nur das Eine zu glauben lehren kann.
Nämlich dass der Mensch an sich selbst zu erfahren hat, wie unvollständig er in seiner (nur ihm selbst) so eminent erscheinenden Bedeutung ist, wenn er nur sich selbst als Maß dieser Bedeutung gelten lässt. Das aber scheint sein Schicksal zu sein, weil er sich letztlich davon überzeugen kann, dass alles, was er außer sich zum Maß erheben kann: die Natur, die Gesellschaft, die Geschichte, die Kunst oder das Wissen letztlich über seinen Horizont und seine Kräfte geht. Folglich scheint er letztlich allein auf sich und seinesgleichen verwiesen zu sein. So kann er unter dem Begriff der Menschheit das Insgesamt der Eigenschaften und Leistungen verstehen, durch die er sich als Einzelner auszeichnen kann.
In dieser Lage ist es nur ein Gott, der ihm gegenwärtig ist, der ihn aus dieser Selbst-Isolation befreien kann. Darin liegt die Erlösung aus seiner Befangenheit in sich selbst. Und dies, nach christlicher Lehre, durch einen Akt der Liebe!
Auch das ist unerhört – und doch zutiefst menschlich in der Botschaft Christi: Ein Gott, der ihn liebt. Das kann man nicht begreifen. Doch man muss es auch nicht. Denn in der Liebe liegt ein Sinn, der sich von selbst erfüllt und sich darin, vom Liebenden wie vom Geliebten, immer schon versteht.
In diesem Zirkel, der das Verständnis des Ganzen aus einem Ganzen gewinnt, das jeder auch an sich selbst sein muss, wenn er als einzelner Mensch im Zusammenwirken mit seinesgleichen etwas Eigenes sein, tun und beitragen will. Als die Einheit, die der Mensch an sich selber hat und erfährt, muss er sich immer auch als Teil einer ihn tragenden, fördernden, herausfordernden und lehrenden Menschheit verstehen. Und im Bewusstsein dieser ihn ausmachenden und tragenden Einheit, die ihm tatsächlich zugetan sein muss, solange er sich in ihr befindet, erfährt er die Liebe eines Ganzen, das ihn ermöglicht – auch dadurch, dass sie ihm selbst in größter Verzweiflung und absoluter Entfernung ein Trost sein kann.
Und das alles nicht vorrangig in Thesen und Lehrsätzen erläutert zu finden, sondern in einem bewegenden Beispiel bis in den Tod vorgelebt zu wissen – darin liegt die Wahrheit des Christentums. Aber auch die Schwierigkeit einer christlichen Theologie, die wenig überzeugend ist, wenn sie nicht auch Teil einer praktisch bemühten Nachfolge Christi ist.
Die Theologie hat uns darüber aufzuklären, warum in der Nachfolge Christi keine Selbstüberschätzung des Menschen liegen muss, sondern eine Bescheidenheit selbst noch in der verheißenen Erlösung. Vielleicht liegt ihre größte Aufgabe darin, nachvollziehbar zu machen, wie ein Mensch sich als Gottessohn bezeichnen kann, und dennoch so enden kann, wie es uns das Schicksal des Jesus von Nazareth lehrt.