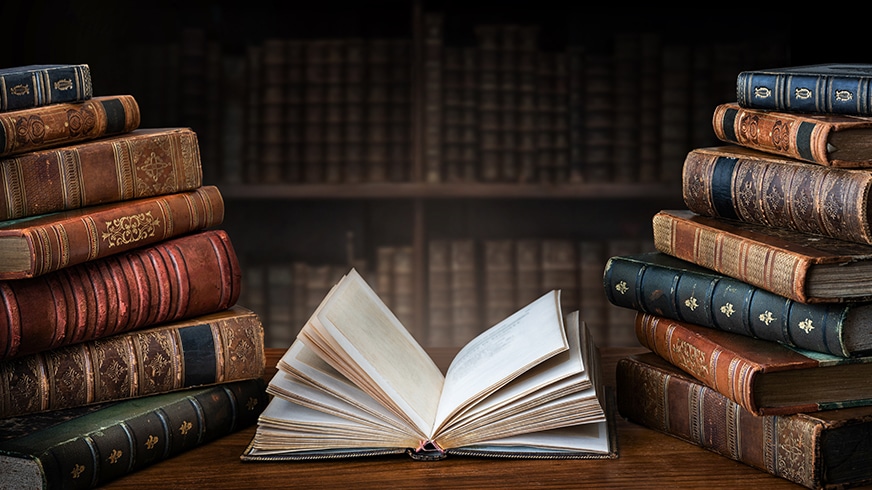Perspektivenwechsel
Gut zwei Jahrzehnte nach der Säkularisations- und Mediatisierungswelle zu Beginn des 19. Jahrhunderts verstarb im Sommer des Jahres 1835 im Herzen des neuen Königreichs Bayern die „Gütlerin“ Marie Elisabetha Bauer, eine geborene Appel. Die oberbayerische Kleinstbäuerin aus dem unweit von Sinning gelegenen Kirchdorf Baiern hinterließ ein bescheidenes materielles Erbe, dazu auch noch fünf minderjährige und unversorgte Kinder. Ihre älteste Tochter Franziska war im April des Todesjahres neun geworden, ihr jüngstes Kind, das man nach dem zweiten Vornamen der Mutter taufte, war noch keine sieben Monate alt. Walburga, Martin und Theresia lagen altersmäßig mit sieben, fünf und drei Jahren dazwischen.
Um die ungewisse Zukunft der fünf Halbwaisen zu sichern, musste nun ein amtlicher Kindsvertrag geschlossen werden. Zu Vormündern ernannte man den Taufpaten der Kinder, den Taglöhner Xaver Leitmeier aus dem nahen Sehensand und den Austrägler und Großvater der Kinder Johann Appel aus Baiern. Das kleine Anwesen, in dem nun der Vater Martin Bauer mit den Kindern hauste, wurde vor Gericht zwar auf 1054 Gulden geschätzt, doch galt es, Schulden in Höhe von 522 fl. abzuzahlen. Das mütterliche Erbe in Höhe von 30 Gulden für jedes Kind war zu sichern. Es musste mit einer vierprozentigen Verzinsung spätestens zur Volljährigkeit ausbezahlt sein. Die Kinder waren „ordentlich und christlich“ zu erziehen, sie genossen freies Wohnrecht und mussten vom Vater bis zum Zeitpunkt, an dem „sie sich ihr Brod selbst verdienen können“, mit „allen Nöthigen“ versorgt werden. Dazu zählten insbesondere Nahrung und Kleidung.
Der genannte Kindsvertrag, den alle Beteiligten mit Unterschrift oder Handzeichen besiegelten, wurde nun aber – und da sind wir mitten im Thema – nicht vor einem der zahlreichen königlichen Landgerichte abgeschlossen. Seit 1802 formierten sich Landgerichte älterer Ordnung in der näheren Umgebung in Neuburg a. d. Donau und Ingolstadt. Das Landgericht Neuburg war jetzt größer geschnitten als zu Zeiten des Fürstentums Pfalz-Neuburg. Im bayerischen Königreich umfasste es immerhin das gesamte Donaumoos mit den älteren Pfleggerichten zu Burgheim und Reichertshofen sowie der Moosgerichtsadministration von Karlskron.
Nein, der „Kindsvertrag“ von 1835 wurde, wie ungezählte andere Regelungen der freiwilligen zivilen Gerichtsbarkeit, in einem Adelsgericht, genauer gesagt an einem Patrimonialgericht zweiter Klasse verhandelt. Die Beteiligten nahm man vor dem freiherrlich von Weveld’schen Patrimonialgericht in Sinning in dessen Amtsjahr 1835/36 in die Pflicht. Die ausführenden Beamten waren zu dieser Zeit der Sinninger Patrimonialrichter Christoph Schnepf(f) und dessen Aktuar Johann Baptist Schauer gewesen. Die örtlichen Kanzleigebühren beliefen sich angesichts des geringen Streitwertes auf wenige Gulden und Kreuzer. Das Gericht stand in Diensten des Sinninger Gutsherrn, kgl. bayerischen Ministerialrats und langjährigen Vorstands der Strafanstalt in der Münchner Vorstadt Au Johann Baptist von Weveld, der im „langen“ und turbulenten 19. Jahrhundert ebenfalls sehr alt wurde. 1871 verstarb er mit 94 Jahren.
Zur Bildung adeliger Herrschaftsgerichte erster Klasse – sie waren den königlichen Landgerichten in Funktion und Kompetenz weitgehend gleichgestellt – kam es im Donaumoos allerdings nicht, da ihre Etablierung von der Größe des Gerichtssitzes abhängig war. Es hätten mindestens 300 Familien vor Ort wohnen müssen. Diese Regelung benachteiligte gerade den bayerischen Landadel, der sich wie unter Wilhelm Adam von Wevelt(d) (1674-1734) im Jahre 1721 zum Kauf oder zum Ausbau repräsentativer, aber entlegener oder, genauer gesagt, auf die territoriale Polyzentrie im Alten Reich abgestimmter Schlösser entschloss. Sinning und sein weitläufiges Schlossareal blieben in der Region kein Einzelfall; Orts- bzw. Patrimonialgerichte in Adelshand bestanden hier längstens noch bis zur Revolution von 1848 in Giglberg-Feldmühle, Karlshuld, Rohrenfels, Straß, Stepperg und Seiboldsdorf.
Ihre Sprengel wurden gegenüber den Landgerichten teilweise neu vermessen. Ihre Kompetenz wurde respektiert, ja man bezeichnete diese Gerichte selbst in staatsbayerischen Akten des 19. Jahrhunderts mitunter noch als Hofmarken. Überall dort wurden regelmäßig Gerichtssitzungen abgehalten – die Serien der von der Forschung bis heute kaum ausgewerteten Briefs-Protokolle and Polizey-Verhörs Protokolle zeigen dies eindrucksvoll an – und man regelte den alltäglichen Bedarf der Guts-, Kirchen-, Schul-, Forst-, Rechnungs- und Policeyaufsicht. Der Fall Marie Elisabetha Bauer steht exemplarisch für die Erkenntnis, dass sich die gesellschaftliche Infrastruktur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch stark auf die süddeutsche Adelslandschaft bezog.
Adelsherrschaften blieben damit, zumindest regional, trotz der revolutionären Veränderungen im napoleonischen Europa weiterhin beständig und wirkmächtig. Adelsforschung hat auch für die Neuzeit wieder Konjunktur. Sie etabliert sich neuerdings verstärkt als ein integrativer Bestandteil einer Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Fragen, wie es nach der Mediatisierung mit dem kulturellen, sozialen und symbolischen Kapital des bayerischen Adels stand, gewinnen an Bedeutung. Die veränderte Sicht eines aristokratischen „Obenbleibens“, trotz der schmerzlichen Souveränitätsverluste zu Beginn der Epoche und weiterer Herrschaftseinschränkungen zur Mitte des 19. Jahrhunderts, gewährt uns die Möglichkeit, neue Fragestellungen an eine alterwürdige Schicht heranzutragen. Nicht Niedergang und Dekadenz, sondern Standessicherung, bisweilen sogar Aufstieg und Verantwortungsbewusstsein sollen in meinem Beitrag diskutiert werden.
Welcher Stellenwert kam den Landadeligen als neuen wie alten Standesherren im Fortschritt staatlicher Integration zu? Welchen Anteil hatte ihre Bürokratie (Domänen- und Rentämter) und Justiz (Patrimonialgerichte) daran? Welche Rolle spielten althergebrachte Lebenswelten und patriarchalisches Regieren? Wie fiel die Identifizierung der alten Adelsfamilien und der neuen Säkularisationsgewinner mit Region und Land aus? Welchen Spielraum ließ das Gestaltungsmonopol der neuen süddeutschen Staaten überhaupt noch für Machtreminiszenzen aus dem Ancien Régime zu? Einige dieser Fragen wollen wir primär an süddeutschen Beispielen und an ausgewählten Adelsarchiven in Schwaben, Franken und Altbayern, inkl. der historischen Pfalz-Neuburg, aufgreifen.
Für die mediatisierten Adelshäuser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und die Standesherren des neuen bayerischen Königreiches war der Anpassungsprozess nach 1806 auch, aber nicht nur eine Frage des Generationenwechsels. Sehr viel wahrscheinlicher war die angekündigte Staatsintegration ein längerer historischer Prozess als vielfach angenommen. Mitunter war die longue durée integrativer Vorgänge eine Folge hergebrachter Kontinuitäten in den Herrschafts- und Patrimonialgerichten bis zum Grundlastenablösungsgesetz vom 4. Juni des Unruhejahres 1848 und einer nicht nur in der Oberschicht feststellbaren dynastischen Orientierung bis zur Novemberrevolution am Ende des Ersten Weltkriegs.
Gerade im heutigen Bayern, wo der Reichsadel in weltlichen wie geistlichen Territorien über Jahrhunderte Schlüsselstellungen einnahm, bot die neue und zugleich althergebrachte gutsherrliche Gerichtsbarkeit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Ventil für aufgestaute Frustrationen. Letztere waren Resultat der Mediatisierung gewesen, die zwar noch keinen Vermögensverlust nach sich zog, die aber dem Reichsadel den Regierungsstab und die kommunikationsgeschichtlich wichtigen Korporationsrechte auf den Reichs- und Kreistagen aus der Hand nahm. Als Folge führte der Souveränitätsverlust auch zu einer Minderung öffentlicher Aufgaben, die wie im Falle des Übergangs der Grafschaft Pappenheim an Bayern zu einem Rückgang der gräflichen Kammereinnahmen um ein Drittel führten. Hinzu kamen aber die für die Aristokratie in Bayern im Vergleich zu Württemberg und Baden günstigen politisch-gesellschaftlichen Optionen, die auch in der Verfassung von 1818 festgeschrieben wurden. Sie führten in Folge zu zahlreichen Grenzüberschreitungen und weitreichenden Familienbeziehungen über die sich 1806-1810 verhärtenden Trennlinien zwischen den neugeschaffenen Königreichen Bayern und Württemberg und dem Großherzogtum Baden.
Aus der adelsfreundlichen Politik des bayerischen Königshauses und der Ministerien leitete so mancher Standesherr nach dem traumatischen Souveränitätsverlust zu Beginn des Jahrhunderts nochmals landeshoheitliche Befugnisse ab, um wieder „im eigenen Namen [zu] regieren“. Allein in Unterfranken gab es nach 1817 noch zehn adelige Herrschaftsgerichte der I. Klasse, die den 46 bayerischen Landgerichten gleichgestellt waren, und drei weitere Herrschaftsgerichte II. Klasse mit abgestuften strafrechtlichen Kompetenzen. Und die in den Kreisen als Kontrollinstanzen eingerichteten königlichen Appellationsgerichte konnten ihre Aufsichtsrechte in der Praxis nur teilweise oder gar nicht durchsetzen.
Patriarchalische Herrschaftsformen blieben trotz nicht unerheblicher Untertanenkonflikte, unterschiedlicher Amtsvergehen und den ständig wiederkehrenden Vorwürfen überhöhter Gebühren- und Steuerbelastung unter der bayerischen Krone fortbestehen. Die Steuervorwürfe wurden einerseits durch „Querulanten“ aus den Patrimonialgerichten selbst vorgetragen, andererseits beteiligten sich aber auch Landgerichte und Rentämter an dieser Auseinandersetzung. Der Anspruch des staatlichen Steuermonopols ließ 1828 die Adelsherrschaft in Rügland gegenüber der Regierung im fränkischen Rezatkreis in die Offensive treten: „Daher hat das k. landgericht Ansbach die freiherrn von Crailsheim in der erhebung jener consens-taxen nicht zu stören.“
Adelsgerichte sorgten für ein Stück Kontinuität zwischen dem Alten Reich und dem sich ankündigenden Einheitsstaat. Sie verbanden den Absolutismus barocker Provenienz mit einem neuen rationalen Staatsabsolutismus. Freilich musste parallel dazu der Einfluss standesherrlicher Domänenkanzleien nach und nach auf private Geschäfte zurückgedrängt werden. Das konnte zu Konflikten zwischen dem Gerichtspersonal und dem Standesadel führen. In der Adelsherrschaft Rügland, die 1584 an die Herren von Crailsheim fiel und mit der Mediatisierung der Reichsritterschaft bayerisch wurde, verwarnte man 1811 den Amtmann Hussel zu Hornberg wegen „Anzüglichkeiten“ gegenüber dem Familienrat.
Die von Crailsheim’sche Güterverwaltung hatte sich bis 1830 noch kräftig in die Amts- und Justizführung ihrer Patrimonialgerichte eingemischt, prüfte Ein- und Auslaufjournale, kontrollierte Rechnungen, blickte in die Depositenkasse und duldete keine Eigenmächtigkeiten. Für die regelmäßig angesetzten Amts- und Gerichtsrecherchen fertigte man Kontrolllisten, die zum Stand der Bearbeitung, der Korrektur von Rechnungsvorbehalten und zu den Gründen allfälliger Nachlässigkeiten präzise Auskunft zu geben hatten. Für ihr Amt Neuhaus ließen die Freiherren von Crailsheim 1832 ein Gutachten erstellen, das ein seit mehreren Jahren erkennbares Bestreben der Regierung belegte, den Inhabern gutsherrlicher Gerichte die Erhaltung ihrer Rechte zu erschweren. Es wäre dies der Versuch, die Adelsrechte oft mit dem größten Unrecht einzuziehen. In den bayerischen Land- und Appellationsgerichten vertrat man solche Projekte des „an sich reißens“ nur deshalb, „weil man auf dieses dem adel noch zustehende vorrecht neidisch ist“.
Auch Franz Erwein Graf von Schönborn-Wiesentheid bezog 1819 in dieser Situation seine Position. Er erklärte gegenüber der Regierung im Untermainkreis: „Da mir gute Polizeyverwaltung in das bürgerliche Leben so sehr eingreifend ist, zur Zeit der vormaligen Reichsunmittelbarkeit von meiner gräflichen Familie notorisch auf meinen Besitzungen immer die besten Polizeyanstalten mit bedeutendem Geldaufwande sind getroffen und gehandhabet worden, so würde es mir sehr schmerzlich sein, daß dadurch, daß ich blos allein meinen Gerichtsbeamten, deren Tendenz als Staatsdiener auf eine völlige Unabhängigkeit von mir und meiner bevollmächtigten Domanialkanzlei gerichtet ist, das ganze polizeyliche administrative Fach ohne irgend einer Aufsicht von meiner Seite überlassen müßte, dieses müßte mich zugleich veranlassen, zum Wohle meiner Unterthanen, die mir ganz entfremdet würden, und lediglich von meinen Gerichtsbeamten abhängig wären, jenes nicht mehr zu thun, was meine Vorfahren taten.“
Ähnliche Überlegungen trieben im Jahr der französischen Julirevolution Hans Freiherrn von Aufseß zu einer Verwaltungsreform, die den Wirkungskreis seiner Rentenverwaltung stärkte. Er sprach sich aus für die Lösung gutsherrlicher Kompetenzen aus der Zuständigkeit der Patrimonialrichter. Bayerische Adelsdomänen sollten ausschließlich der ansässigen Herrschaft übertragen werden. Ihre Rentenverwalter wären nur dann wieder veritable „Privatdiener“ der Familien. Und sie wären „beliebig zu entfernen“, wenn sie „nicht ganz im Sinne der Gutsherrschaft“ wirkten. Nur so hielte man die „entgegengesetzten Geschäfte“ überschaubar und die „Eintreibung der Gutrenten und die strenge Ordnung der Gutsadministration unendlich“ genauer. Nur so wäre die „Geschäftsführung des Patrimonialgerichts besser besorgt“.
Herrschafts-, Orts- und Patrimonialgerichte
Trotz des Souveränitätsverlustes arrangierte sich der Adel mit Staat, Politik und Gesellschaft nach Napoleon. Die Bundesakte vom 8. Juni 1815 hatte unterschiedliche Entwicklungen in Baden, Württemberg und Bayern, wo man schon 1812 drei Klassen von Adelsgerichten spezifizierte, einigermaßen nivelliert. Ausdrücklich legte man dem Artikel XIV der Bundesakte, der die Adelsprivilegien regelte, subsidiär die bayerische Deklaration vom 19. März 1807 zugrunde. Dort waren die Gestaltungsmöglichkeiten des neuen bayerischen Adels umschrieben und das Recht zu Familienverträgen bestätigt worden. Nach 1815 verblieben beim mediatisierten Adel u.a. sein privilegierter Gerichtsstand, die patrimoniale Gerichtsbarkeit inklusive aller Zuständigkeiten im Jagd- und Forstwesen und die althergebrachte Gutsherrschaft mit Ökonomie und alten wie neuen Policeyrechten.
Zu den Standesrechten zählten ferner die Kirchenpatronate, die noch an die in der Reformationszeit gewonnene Kirchenhoheit erinnerten und die bisweilen abrupten Konfessionswechseln ausgesetzt waren. So verfügten die Fürsten zu Leiningen 1803 in Amorbach, die säkularisierte Abteikirche der Benediktiner zur neuen protestantischen Hofkirche zu erheben. Im Odenwald ließ man dann den Glanz des nach der französischen Revolution untergegangenen Dürkheimer Hofes wiederaufleben. Gesichert blieb 1815 auch die Autonomie der Adelsfamilien in Haus- und Erbschaftsangelegenheiten inklusive aller Fideikommisse. Die genannten Policeyrechte in Adelshand gaben Freiraum für regional durchaus unterschiedliche Entwicklungen.
Sie reichten im ökonomischen Bereich von der Industrie-, Ziegelei-, Mühlen-, Brauerei-, Handwerks-, Handels-, Agrar-, Vieh-, Gewässer- und Waldaufsicht über die Lizenzvergabe für Maße und Gewichte. Vieles zählte dabei zu den klassischen Aufgaben adeliger Wirtschaftspolitik, über die man in rationaler Rechnungslegung meist vierteljährlich, zumindest aber ganzjährlich Rechenschaft ablegte. Diese Rechnungsserien sind heute wie die Hauptrechnungen des „freyherrlich von Weveldischen Brauhauses Sinningen“ meist nur noch in dezimierter Auswahl überliefert. Vieles hatte aber auch einen Bezug zur regionalen Boden- und Gewerbebeschaffenheit, wie sie Pachtverträge für das Einsammeln von Hausasche für die Felddüngung oder Abrechnungen über einen im Akkord betriebenen Torfstich dokumentieren. Torfvorkommen waren in den Patrimonialgerichten des mittleren Iller-, Mindel- und Wertachtales verbreitet und sie spielten als Energieträger im 19. Jahrhundert noch eine beachtliche Rolle.
Die Verantwortlichen in den Adelsgerichten knüpften für ihre wichtigen, ökonomischen Interessen dienende Arbeit vor 1848 meist an eine lange Verwaltungs- und Gerichtstradition aus der frühen Neuzeit an. Und vieles war auch im „langen“ 19. Jahrhundert von Dauer. Noch 1905 musste die altfränkische Gemeinde Morstein vor der Crailsheimischen Domänenverwaltung nachsuchen, um einige der damals sehr modisch gewordenen Pappelbäume pflanzen zu können.
Patrimonial- und Herrschaftsgerichte standen mit oder ohne Dynastiewechsel in den Zäsurjahren um 1800 in einer Tradition, wie sie sich last but not least auch in homogen gewachsenen, seriellen Überlieferungen niederschlug. In der Adelsherrschaft Harthausen bei Gü knüpften die Amts-, Gerichts- und Protokollbücher des 19. Jahrhunderts inklusive einer komplexen Rechnungsführung unmittelbar an die Strukturen des Ancien Régime an. Die 88 Bände der Hauptrechnungen aus dieser schwäbischen Herrschaft liefen kontinuierlich von 1758 bis 1876, die elf Bände der Rechnungsmanuale von 1781 bis 1845, die 38 Fruchtrechnungen von 1778 bis 1843 und die 43 gebundenen Herbstrechnungen mit den Gültabgaben der Untertanen zum Erntejahr von 1750 bis 1824. Herrschaftliche Gültverzeichnisse gibt es für den Zeitraum zwischen 1528 und der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Im fränkischen Kunreuth, dessen Wasserschloss Sitz eines Kastenamts der Grafen und Freiherren von und zu Egloffstein war, zeichnete sich nicht nur die gutsherrliche Rechnungsführung durch lange Kontinuitäten aus. Das Lehenbuch der Egloffstein führte man von 1698 bis 1820, das Kunreuther Mannlehenbuch von 1655 bis 1803 und ein Hypothekenbuch zu den Egloffsteinischen Gütern behielt zwischen 1766 und 1821 seine Gültigkeit.
Auch der unmittelbare Wirkungsbereich der herrschaftlichen Patrimonialgerichte war von einer verblüffenden Stabilität der Registraturen gekennzeichnet. Unveränderte Serien an Handwerkslehrbriefen und gerichtlichen Zeugnissen in Handwerkssachen erstreckten sich von 1775 bis 1848, einzelne Gemarkungsbücher für gutsherrliche Orte von Affalterthal bis Wolfsberg reichten von 1722 bis 1812 und in den Steuerbüchern des Vormärzes konnte man gelegentlich bis ins 17. Jahrhundert zurückblättern. In Einzelbereichen wie der Forstwirtschaft oder dem Fischereiwesen ergaben sich privilegiengesteuerte Kontinuitäten vom frühen 16. bis weit ins 20. Jahrhundert. So verwies man unter den Freiherren von Crailsheim im Amt Sommersdorf-Thann noch zur Zeit der Patrimonialrichter und der nachfolgenden Rentenverwalter auf Aktenvorgänge aus den Jahren der Reformation.
Unter all diesen Vorzugsrechten kam den Herrschafts- und Patrimonialgerichten sicher besondere Bedeutung zu. Im Königreich Bayern unterstanden im Jahre 1817 noch immerhin fast 16 Prozent der rechtsrheinischen Bevölkerung einem dieser Patrimonialgerichte. Dort lag im Unterschied zum Militär- und Hofdienst der Gestaltungsrahmen primär nicht beim Souverän, sondern beim Landadel. Aus ihnen resultierten insbesondere bis 1848/49 die engen, öffentlichkeitswirksamen und rechtlich abgesicherten Verbindungen der Mediatisierten sowie ihrer Diener- und Beamtenschaft zu einem Großteil der zunächst noch grunduntertänigen Bevölkerung. Dort konnte adeliger Führungsstil, patrimonialer wie patriarchalischer Herrschaftsanspruch in Koordination, bisweilen auch in Konkurrenz zu den staatlichen Landgerichten umgesetzt werden.
Patrimonialgerichte hatten einen oft zu gering geschätzten Anteil an der Modernisierung des Landes. Dieser schlug sich infrastrukturell im Vermessungswesen, in der Flur-, Haus- und Gewerbeaufnahme oder im Wasser- und Wegeausbau nieder. Die Staatsplanung des frühen 19. Jahrhunderts ruhte auf einem unglaublichen Daten- und Regelwerk. Und die Grundlagenarbeit lastete dabei sicher nicht nur auf den neu eingerichteten staatlichen Steuerbemessungskommissionen, Katasterbüros, Rentämtern und Landgerichten, sondern auch auf zahlreichen Gerichten und Ämtern in Adelshand. Statistik, Grundablösung, Landesvermessung, Berg-, Kanal- und Straßenbauten oder die Katasteraufnahme waren in Patrimonialgerichten keine Fremdwörter. Das Bemühen um die Vereinheitlichung in den Gerichts- und Schlosskanzleien war ebenfalls erkennbar, dennoch wiesen die Steuer- und Gebührenbücher in den einzelnen von Crailsheimischen Gerichten in den 1820er und 1830er Jahren noch ganz unterschiedliche Titelgruppen und Tabellenschemata aus.
Bei ihrer Bedeutung für die Landesentwicklung mussten die Richter nicht nur ausreichend qualifiziert, sondern auch hinreichend besoldet sein. Innerhalb gutsherrlicher Haushaltsführung fielen deshalb erhebliche Kosten an. Meist überstieg das richterliche Jahresgehalt auch die gesetzlich vorgeschrieben 600 Gulden. Für das von Egloffstein’sche Patrimonialgericht Plankenfels sah ein Dienstvertrag im Jahr 1830 um ein Drittel höhere Bezüge vor. Der Richter bezog die üblichen 600 Gulden. als fixen Standesgehalt und 200 Gulden als Funktionsgehalt. Die zusätzlichen Bezüge fielen „hauptsächlich um deßwillen an, weil er für Wohnung und Holz in dem Orte Sachsendorf selbst sorgen muß, während sonst der Beamte zu Planckenfels Wohnung und Holz freÿ hatte.“ Hinzu kamen Kosten für den Gerichtsschreiber, da der „beÿgegebene Scribent Münch“ ebenfalls weiterhin aus der Gutskasse alimentiert wurde.
Nur fünfzehn Jahre später wies das Kastenamt Kunreuth bereits für Patrimonialrichter Geiger, der allerdings auch als Kastner fungierte, 946 Gulden Jahresbezüge aus. Hinzukamen die gerade in Adelslandschaften üblichen Naturalbezüge, darunter auch 22 Gulden in bar, weil für Geiger „bis Petri Cathedra 1845/46 nicht alles Besoldungsholz gehauen und in natura abgegeben“ wurde.
Überhaupt führten die Herrschaftswechsel zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht automatisch zu einer Verschlechterung der Dienstverhältnisse. Die Grafen von Pappenheim besoldeten trotz des genannten Einnahmenrückgangs nach der Mediatisierung ihre Beamtenschaft zunächst im vollen Umfang weiter. Dort standen 1815/16 noch vierzig Personen auf der Gehaltsliste des Adelshauses. Ganz oben in der Liste fanden sich der Kammerdirektor mit einem Jahresverdienst von 1100 Gulden, gefolgt vom Gerichtsaktuar, der dank diverser Nebentätigkeiten immerhin auf über 900 Gulden kam, vom Gerichtsassessor mit 600 und vom Domänenrat mit 500 Gulden. Das Mediat-, Herrschafts- und spätere Patrimonialgericht zehrte demnach erheblich an den Ressourcen des Hauses Pappenheim.
Das Verhältnis zwischen Land- und Patrimonialgerichten war nicht spannungsfrei. Erstere nutzten dann auch Unregelmäßigkeiten und Unerfahrenheit in der patrimonialen Gerichtspraxis, um über die vorgesetzten Kreisregierungen staatliche Aufsichtsrechte im Adelsterritorium geltend zu machen. Als in den 1820er Jahren in mehreren oberfränkischen patrimonialen Gerichten Klagen wegen hoher Gebührensätze geführt wurden, wandten sich Untertanen auch aus Aufseß, Burggrub und Plankenfels an diese in ihren Augen „höchste Behörde“. Sie appellierten an die Regierung des Obermainkreises. Und die Gutsherrschaften mussten sich entsprechend rechtfertigen.
Patrimonialgerichte bildeten, formal gesehen, eine für den modernen Zentralstaat sperrige herrschaftliche Zwischenebene im langen Institutionsgang zwischen Souverän und Untertan. Und so kam es, dass für die in der Fläche vorherrschenden, annähernd auch gleich groß geschnittenen neuen bayerischen Landgerichte von der Bürokratie enge Standards in Ausstattung, Größe und Organisation ausgelegt wurden. Diese benachteiligten die weit weniger deutlich arrondierten Adelsgerichte, wo nachbarschaftliche Kooperationen, familienübergreifende Interessen und die Homogenisierung der oft künstlich getrennten Bereiche Gut und Gericht viel stärker gefragt waren als planerische Einheitlichkeit.
1806 gab es beispielsweise bei der Bildung des Gerichts Edelstetten deswegen Probleme. König Max I. wies 1808 persönlich den dort seit der Säkularisation des adeligen Damenstifts begüterten Fürsten Esterházy von Galántha zurecht: „Da aber die Vorschrift unsers organischen Edicts in Betref der Gerichtsverfassung vom 24. Julÿ laufenden Jahres im 8. §, wornach dergleichen Untergerichte gleiche Verfassung wie Unsere Landgerichte annehmen, folglich nebst dem richter noch mit wenigstens zween der Rechte kundigen und geprüften beisitzern bestellt seÿn sollen, auf die zugleich gesetzlich vorgeschriebene Justizverwaltung berechnet ist, auch die Unserer Souverainität unterworfenen Fürsten und Grafen bei der Versicherung ihres Rechts der Gerichtsbarkeit von den in Unserm Reiche gesetzlichen Sermon der Justitzverwaltung nicht ausgenommen würden, so können wir dem Gesuche des benannten Fürsten nicht statt geben.“ Als Alternativen boten sich die Rückstufung zu einem Patrimonialgericht oder die Kompetenzabtretung an das benachbarte Landgericht an.
Motive für die in Aussicht gestellte Trennung der Gerichts- und Gutsgeschäfte lagen vor allem in der Entfremdung zwischen Adelsherrschaft und Patrimonialrichtern, wenn letztere zunehmend in den Wirkungskreis der Kreisregierungen und Appellationsgerichte eingebunden wurden. Benachteiligungen stellten sich für die Gutsherrschaften auch ein, wenn Familien- und Gerichtssitz räumlich getrennt wurden. Wegen der Standortfrage des Gerichts kam es da und dort zu einem längeren Schriftwechsel mit den Regierungen.
Die ehemals reichritterschaftliche von Riedheim’sche Gutsverwaltung zu Harthausen bei Günzburg fand sich beispielsweise nicht mit der Verlegung des Gerichtssitzes in das frühere Pflegamt Rettenbach ab. Es „ist die Gerichtsbarkeit eigentlich ein Apertinents der Herrschaft Harthausen, es führt auch das Patrimonial Gericht daher seinen Namen, und heißt […] Gericht Harthausen und nicht Rettenbach. Es besteht auch in Harthausen für den Gutsherren zur Wohnung ein grosses weit umfaßendes Schloß und bedarf wohl keines Beweises, daß es für den […] Gutsherrn in administrativer Hinsicht wegen […] nothwendiger Rücksprache mit dem Beamten wohl wünschenswerth erscheint, denselben an dem nämlichen Wohnorte situirt zu wissen.“
Und 1819 musste auch der Hauptsitz der von Freyberg’schen Patrimonialgerichte I. Klasse vom Stammsitz der Familie auf Haldenwang in das größere Unterknöringen bei Burgau verlegt werden, während im Haldenwanger Rentamt und in Waldkirch unter Franz Ignaz Freiherr von Freyberg nur noch Außenstellen verblieben. Grund für die Provinzialisierung ehemaliger Herrschaftszentren war die bayerische Forderung von 1808/09 nach mindestens 50 Anwesen in allen neuen Gerichtssitzen gewesen. Jetzt wurde so manche traditionsreiche Siedlungsstruktur auf den Kopf gestellt. Alte Oberämter wurden zu Außenstellen und ehemalige Unter- oder Landämter zu patrimonialen Gerichtszentren.
Verkehrte Welten konnten auch dann entstehen, wenn sich Patrimonialgerichte allzu sehr an die Personalstrukturen der Landgerichte banden. Patriarchalisches Gestalten wurde dann zur Utopie. Hier half in den kleinräumigen Landschaften Neubayerns auch der Grundsatz nicht, dass kein Untertan über vier Wegstunden vom Gerichtssitz entfernt wohnen dürfe. Im oberfränkischen Mühlhausen schlug im Herbst 1832 die Adelsherrschaft für ihr Patrimonialgericht II. Klasse der Kreisregierung den am Landgericht zu Höchstadt tätigen Richter Candidus Geiger vor. Dieser erklärte „fuer den Fall der höchsten Bestaettigung dieser Praesentation“ weiterhin „beÿ dem königlichen Land Gericht Hoechstadt in Praxis zu treten, an diesem letzteren Orte meine Wohnung zu nehmen und an zweÿ zu Mühlhausen allwoechentlich abzuhaltenden Gerichtstagen das Patrimonial-Gericht zu verwalten“. Der patrimoniale Gerichtssitz wurde so peripher und Geigers Absicht war gesetzeskonform.
Als Folge dieser oftmals nur als Provisorien eingerichteten Verbindungen zwischen Landadel und Regierungsstellen kann es nicht verwundern, dass der neue Zentralstaat Informationen über die Adelsgerichte sammelte. Interna zur Lebens- und Amtsführung patrimonialer Fürstendiener ließen sich jedenfalls zuhauf in bayerischen Institutionen abrufen. Auch Friedrich Graf von Thürheim (1763-1832) ließ in Bayreuth als Generalkommissär des Mainkreises für das zuständige Appellationsgericht 1812/13 systematische Bestandstabellen zu allen Patrimonialgerichten anlegen. Neben dem Gericht und den Gerichtshalter speicherte man dort auch Informationen über den „Character“ der adeligen Jurisdiktionsberechtigten und zu Personalien wie Qualifikationen der jeweiligen Patrimonialrichter.
So erfahren wir aus bayerischen Akten beispielsweise über das Adelsgericht Buttenheim – es lag im Landgericht Bamberg I – und über den damaligen Richter Johann Carl Wilhelm Rösling: Er war 28 Jahre alt und verheiratet, hatte zwei Kinder und besaß die „erforderliche Gewandheit, ist sehr thätig und vorzüglich in Rechnungssachen“. Insgesamt war er auch nach Meinung staatlicher Stellen „sehr brauchbar“. Und über den bereits seit 1771 in den Adelsgerichten Hagenbach und Wolkenstein der Landgerichte Ebermannstadt und Pottenstein tätigen Johann Georg Arnold lesen wir, dass er bereits 79 Jahre alt war, sechs Kinder hatte und „bei seiner so langjährigen Praxis stets mit Ordnung und Pünktlichkeit u. Thätigkeit den ihm angewiesenen, übrigens beschränkten Wirkungskreis versehen“ hatte.
Sicher notierte man auch Negatives. So musste das Adelsgericht zu Sassanfahrt 1807 den Grafen von Soden wegen Missbrauchs für zwölf Jahre entzogen und dem Landgericht Bamberg II. „zur Administration übertragen“ werden. Auch bayerische Quellen bestätigten, dass den Adelsgerichten des 19. Jahrhunderts im Alltag der Region noch eine wichtige Stellung zukam. Und die Instanzenzüge zu vorgesetzten Appellationsbehörden waren trotz staatlicher Datenfülle keine Alltäglichkeit, ebenso wie man im Alten Reich die niedergerichtlichen Privilegien, die jurisdictio bassa, gegenüber den fiskalisch meist weniger interessanten landesherrlichen Malefiz-, Fraisch- oder Blutgerichtsbarkeiten in Süddeutschland auszubauen wusste.
Das Land im Spiegel der Gerichtsprotokolle
Die Konturen des Königreichs Bayern wären für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts trotz der staatlichen Bemühungen um eine landesweite Deskription, Statistik und Topographie ohne die Überlieferung der zahlreichen Adelsarchive wesentlich unschärfer geblieben. Am Beispiel der Briefprotokolle aus dem Sinninger Guts- und Hofmarksarchiv wollen wir dies exemplarisch verdeutlichen. 1818 kam es vor dem von Weveld`schen Ortsgericht zum Besitzerwechsel in einer kleineren Landwirtschaft. Der Söldner Matthias Mair und dessen Ehefrau Elisabeth, vor Gericht vertreten durch ihren Bruder, übergeben ihr Anwesen in Sinning für 1500 Gulden an ihren Sohn, den Söldner und Forstbaumeister Johann Mair. Ein zweiter Vertrag in Höhe von 900 Gulden für den Webersöldner Sebastian Krell, dessen Ehefrau und seine ledige Tochter Viktoria ergänzt die Daten. Die Details dieser und anderer Erb- und Übergabeverträge, die in der Kanzlei eines Adelsgerichts sorgsam recherchiert wurden, bilden ein Portal zum Kulturleben vor Ort. Es ist die Zeit der bayerischen Verfassungsgesetzgebung, in der nicht wenige Landleute noch immer des Lesens und Schreibens unkundig sind. Sie akzeptieren Rechtshandlungen statt mit Unterschrift mit ihrem Handzeichen.
Aus kleineren Gütern konnte man im Donaumoos den familiären Lebensunterhalt nicht bestreiten. So stoßen wir in Übergabeverträgen auf eine verbreitete Hausweberei und auf ländliches Handwerk, das in fast allen Sölden betrieben wurde. Handwerksgeräte, Wagnerwerkstätten und Webstühle sind im Inventar sorgsam registriert. Die Bonität der regionalen Böden war nicht optimal. Jedenfalls sind die vielen Tagwerke an Mooswiesen meist steuer- und zehentfrei geblieben, um Anreize zur Bodenkultivierung zu schaffen. Aus den Frucht- und Ackerflächen erwirtschaftete man um Neuburg a. d. Donau hauptsächlich Kartoffeln, Kraut, Gerste und örtlich auch Weizen – Bodenfrüchte, die man in den Ratenzahlungen regelmäßig wiederfindet. Öl aus den Leineflächen kam hinzu.
Aufschlussreich sind frühe Hinweise auf agrarische Sonderkulturen wie den regionalen Spargelbau. So musste der neue Bewirtschafter in der Sölde Matthias Mairs zu Sinning seit 1818 „die hälfte von den spargeln“ abgeben, „ferner ißt und wohnt der übernehmende vater und die mutter bey dem sohn und dessen eheweib“. Obstanbau ist nachgewiesen, „den vierten theil“ der jährlichen Apfel- und Birnenernte musste man an den Weber Krell abtreten. Schweine-, Gänse- und Hühnerhaltung waren weit verbreitet.
An Schlachttagen mussten die Gutserben ihren austragenden Eltern je 25 Pfund Schweinefleisch, Schweineschmalz, vier Bratwürste, zwei Leberwürste und eine Blutwurst liefern. Dazu kamen an Weihnachten „100 eier u. eben soviel krautsköpfe“, ein Schaff Rübenkraut, „1/2 mezen leinsamen, 3 ₤ oel, 1 schafl erdäpfel“, außerdem „wochentlich 3 maas milch“. An Kirchweih und an Weihnachten waren den Verkäufern und Gläubigern zusätzlich mindestens ein Laib Weißbrot und 100 Eier zu reichen. Auch Küchengerätschaften wie eiserne Pfannen und Bratschüsseln fanden Eingang in amtliche Verfügungen. In den Protokollen des von Weveld’schen Gerichts wurden schließlich auch Ochsen als teure Zug- und Pflugtiere und Kühe als regionale Milch- und Fleischlieferanten aufgelistet. Ochsen waren allerdings unter Söldenbauern im Donaumoos ziemlich selten.
Results
Insgesamt ließ sich feststellen, dass der Blick auf bayerische Adelsherrschaften keineswegs nur überkommene und modernitätshemmende Lebenswelten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts freilegte. Für die Funktionalität dieser für die Integration zunächst etwas sperrigen politischen Ebene waren zugleich das Engagement und die Kompetenz der Fürstendiener und der zahlreichen patrimonialen Amts- und Gerichtspersonen ausschlaggebend. Sie waren Entscheidungs- und Identifikationsträger vor Ort. Trotz struktureller Nachteile hatten sie maßgeblichen Anteil an der Landesentwicklung. Sie und ihre Familien waren keine Repräsentanten einer „verlorenen“ Welt, sondern sie qualifizierten sich für künftige Aufgaben. Das jüngst konstatierte „Oben bleiben“ des Adels in der Moderne basierte auch und nicht zuletzt auf der beschriebenen Lebensleistung von ungezählten Gerichts- und Fürstendienern im „langen“ 19. Jahrhundert.