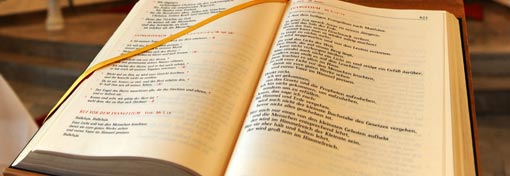Die Bibel wird als ein Buch bzw. als das Buch wahrgenommen. Es ist das große dicke Buch, aus dem man alte, ehrwürdige Geschichten vorliest. Wer Buch sagt, sagt auch Schrift. Unterschlagen wird oft, dass der fixierte, in dieser Rücksicht tote Text, ursprünglich lebendiges gesprochenes Wort war bzw. selbst aus der mündlich geprägten Kultur und tradierten Erzählungen hervorgegangen ist. Nicht nur ein Kind könnte heute mit Recht fragen: „Wie hat denn Mose gesprochen?“ „Wie haben Jesaja und Jeremia gesprochen?“ „Wie hat Jesus gesprochen?“ „Gesprochen“ meint hier lebendiges Wort, das erklingt und gehört wird, bevor es niedergeschrieben wird. Die Wiederentdeckung der Mündlichkeit (Oralität) ist damit notwendige Aufklärung über eine einseitige und in die Sackgasse geratene Schrift- und Textfixierung.
Martin Hengel, der bekannte Tübinger Neutestamentler, notierte 2008, ein Jahr vor seinem Tod: „Je länger ich an diesen Themen – (Entstehungsgeschichte der Evangelien) arbeite – desto größer werden meine Zweifel an der klassischen ‚Zwei-Quellen-Hypothese‘ (…). Ein rein literarisches Abhängigkeitsmodell kann die synoptische Frage nicht beantworten. Tatsächlich stehen die Evangelisten noch in einem mündlichen Traditionsstrom“. Diese Frage nach der Bibel vor der Bibel, d. h. nach der Mündlichkeit vor und neben der schriftlichen Fixierung, nach dem gesprochenen Wort vor und neben dem geschriebenen Wort, hat Marcel Jousse (1886-1961) – theoretisch wie praktisch – sein Leben lang beschäftigt.
Der Ansatz von Jousse ist m. E. in zweifacher Hinsicht innovativ und für unsere Zeit relevant:
Erstens insofern Marcel Jousse innerhalb der wissenschaftlichen Fachwelt, etwa in der biblischen Exegese oder in der modernen Sprachtheorie und Medienwissenschaft, althergebrachte Denkmuster aufbricht und hinterfragen lässt, so dass mit ihm neue Wege der Forschung initiiert werden.
Zweitens so wie Luther „dem Volk aufs Maul schaute“, so schaute Jousse auf verschiedene Kulturen, in denen Schrift eine untergeordnete bzw. gar keine Rolle spielte. Daher ist auch das Denken von Jousse stets erfahrungsgebunden und zielt auf eine praktische Anwendung.
Marcel Jousse ist bis heute einer größeren Öffentlichkeit in Deutschland nicht bekannt. Auch sein Werk wartet auf einen Übersetzer für den deutschsprachigen Raum. Romano Guardinis Frage: Was bedeutet das Körperliche für uns – als Mittel geistiger Aufnahme und geistiger Aussprache, als Eindrucks- und Ausdrucksmittels? – ist heute auch unsere Frage.
Die Interessen und Themen des Denkens von Marcel Jousse sind vielfältig. Im Zentrum steht die Bemühung um eine Wissenschaft, eine Sprachanthropologie, die vom lebendigen Menschen und nicht von toten Überbleibseln (Schrifterzeugnissen) ausgeht. In der Fachwelt finden wir seit Anfang der zwanziger Jahre in Deutschland stetige Hinweise auf das Werk von Marcel Jousse, insbesondere in der Exegese, den Literatur- und Theaterwissenschaften und in der philosophischen Anthropologie. Der Sprachwissenschaftler Harald Haferland etwa würdigte Jousse’s Arbeiten zum Oralstil. Er schreibt: „Anders als in Deutschland ist die Funktion des Rhythmus, Sprache mnemonisch zu kodieren, in Frankreich beachtet worden und Marcel Jousse hat bereits vor Jahrzehnten eine Vielzahl von Arbeiten und Belegen zusammengetragen, die sie herausstellen.“ Nach biografischen Notizen zu Jousse erfolgt in meinem Vortrag die Vorstellung des Hauptwerkes von Jousse, des „Style oral“ von 1925. Anschließend geht der Blick auf die von Jousse mit Erfolg wiederbelebte Praxis des Bibelrezitatives.
Über sein Leben pflegte Marcel Jousse zu sagen: „Die Geschichte meines Lebens ist die Geschichte meines Werkes und die Geschichte meines Werkes ist die Geschichte meines Lebens“, so lohnt es sich, erst einmal auf die Herkunft von Marcel Jousse zu schauen.
Marcel Jousse: Persönlichkeit und Werk
Marcel Jousse wurde am 28. Juli 1886 in La petite Lardière in der Nähe von Beaumont-sur-Sarthe geboren. Die kleine Stadt liegt ca. 25 Kilometer von Le Mans und Alençon entfernt, nicht weit von Lisieux in der Normandie. In dieser Region wurde zu Beginn des vorigen Jahrhunderts Flachs – der zu Leinen verarbeitet wird – angebaut. Die Mutter von Marcel Jousse war alleinerziehend und half bei der Flachsernte. Es ist eine harte Arbeit, die die Hände stark beansprucht und wund macht. Honorine Carel, so ihr Mädchenname, trennte sich von ihrem Mann, der überaus geizig war. Ihr erster Sohn starb im Alter von nur 12 Jahren, weil er vom Vater zu harter Feldarbeit gezwungen wurde. Die Mutter bewahrte ihren jüngeren Sohn vor einem ähnlichen Schicksal, indem sie mit ihm in einer Nacht- und Nebelaktion den Familienhof verließ und in der kleinen Stadt Beaumont-sur-Sarthe eine Zufluchtsstätte fand. Mit Näh- und sonstigen Gelegenheitsarbeiten kam sie für die Erziehung ihres zweiten Sohns allein auf. Der Pfarrvikar vom Beaumont erkannte die Begabung des jungen Marcel und gab ihm Privatunterricht. Im Pfarrhaus lernte er neben Latein auch Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Die Fragen, die dem Jungen damals keine Ruhe ließen, waren: „Wie hat denn Jesus zu seinen Jüngern gesprochen? In welcher Sprache? Auf welche Art und Weise?“ Diesen Fragen sollte er in seinem späteren Studium auf den Grund gehen.
Das einfache Bauernmilieu, in dem Jousse aufgewachsen ist, war im Wesentlichen durch eine mündliche Kultur geprägt. Zuhause sprach man Dialekt (Sarthois). In seinen Erinnerungen bekannte der spätere Priester und Jesuit: „Alles, was ich weiß, verdanke ich meiner Mutter“. Warum? Weil diese Frau, die kaum lesen und schreiben konnte – sie war nur drei Winter in die Schule gegangen –, etwas konnte, was keiner von uns heute mehr kann: Sie kannte die Sonntags- und Festevangelien in ihrem Dialekt auswendig. Sie sang sie nach einer einfachen rhythmischen Melodie, in einer Art Singsang, und wiegte dabei das Kind in ihren Armen. So hatte sie es selbst von ihrer Großmutter gelernt.
Die ersten Schuljahre
Mit Beginn der Schule wurde Marcel Jousse der starke Kontrast zwischen der Lebendigkeit des Lebens und Lernens bei der Mutter und der Mangel an Bewegung im engen Klassenraum bewusst. Lesen- und Schreibenlernen gehen mit der Unbeweglichkeit des Sitzens einher, während in einer mündlichen Tradition Rhythmus, Bewegung und Leben auch beim Lernen dazu gehören. So schrieb Jousse später: „Kaum vermag das Kind seine ersten Sätze verständlich zu artikulieren, da verdammt man es schon zur Zwangsarbeit des Lesens (…). Seine Finger, dazu bestimmt, alles zu betasten, alles ab- und wieder aufzubauen, umklammern krampfhaft den Federhalter, um Wörter zu kritzeln, deren Orthographie häufig nicht einmal der klangvollen Artikulation entspricht, die sich auf seinen lebendigen Lippen vollzieht. Sein ganzer Körper, dieser spielerische und spontane Imitator aller Gesten und Handlungen seiner Umwelt, wird auf der Schulbank ohne Verzug zu der hieratischen Haltung eines kleinen ägyptischen Pharaos verurteilt, der vor seinem Haus der Ewigkeit sitzt, die Hände auf den Knien.“
Diese Zeilen lassen die Bitterkeit in den Erinnerungen an erste Schulerfahrungen spüren und führen die evidente Einseitigkeit einer rein an der Schrift orientierten Wissensvermittlung vor Augen. War Jousse deshalb ein schlechter Schüler? Keineswegs! Auffallend waren seine außerordentliche Fähigkeit, lateinische und griechische Verse zu schreiben, und sein ausgezeichnetes Gedächtnis. Seine Schulkameraden nannten ihn achtungsvoll „Virgil“. Nach dem Abitur am humanistischen Gymnasium trat Marcel Jousse ins örtliche bischöfliche Priesterseminar ein. Das Theologiestudium wurde durch den Militärdienst (1907-1908) unterbrochen. Marcel Jousse diente in der Artillerie und lernte reiten. Nach dem Militärdienst setzte er sein Studium fort und wurde 1912 zum Priester für das Bistum Sées geweiht. Mit 27 Jahren bat Marcel Jousse um Aufnahme bei den Jesuiten. Jousse folgte auf dem Juvenat auf der britischen Kanalinsel Jersey seinem berühmten Ordensbruder, dem Paläontologen Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Denn damals durfte der Jesuitenorden in Frankreich keine Ausbildungsstätten führen.
Im großen Krieg
Das Feld, auf dem Jousse wie hunderttausende anderer Männer tiefgreifende Erfahrungen machen sollte, war der Erste Weltkrieg mit seinen furchtbaren Materialschlachten, in dem das alte Europa endgültig unterging. Er erlebt und überlebt die Hölle von Verdun. Verwundet und halb taub wurde er für seine Tapferkeit mit militärischen Ehren ausgezeichnet. Bei all dem Furchtbaren geschah etwas Gutes. Jousse wurde im letzten Kriegsjahr als Militärausbilder in die USA versetzt. In Kalifornien kam er in Kontakt mit einheimischen Indianerstämmen. Hier bot sich die einzigartige Gelegenheit, deren ganzheitliche und rhythmisch geprägte Gebärdensprache zu studieren. Jahre später kam der Indianerhäuptling Oskomon auf Einladung von Jousse nach Paris. Von den Indianern lernte Jousse, dass Gesten viel genauer sein können als Worte. So kann man z. B. die besondere Art des Fliegens eines Vogels konkreter durch eine Gebärde als durch ein Wort, das allgemein bleibt, wiedergeben. 1919 kehrte Jousse nach Europa zurück und absolvierte das Scholastikat. Ein Jahr später legte er seine ewigen Gelübde ab. Die Zugehörigkeit zur Kirche und zum Jesuitenorden blieb für alle sichtbar. Auch an der laizistischen Sorbonne trug Jousse die Soutane der katholischen Priester.
Student und Hochschullehrer in Paris
Ab 1922 wurde Jousse von seinen Oberen weitgehend fürs Studium freigestellt, so dass er in Paris Psychologie, Linguistik, Phonetik, Ethnologie und Anthropologie studieren konnte. Zu seinen Professoren zählten hervorragende Gelehrte: Pierre Janet (1859-1947), Gründer der französischen Gesellschaft für Psychologie, Abbé Jean-Pierre Rousselot (1846-1924), Gründervater der Phonetik, und der Soziologe Marcel Mauss (1872-1950), Verfasser des berühmten Essays über die Gabe (1923-24), aber auch über die Köpertechniken. Jousse stand in Austausch mit vielen Persönlichkeiten, insbesondere mit Medizinern und Psychologen der damaligen Zeit. Der Dekan der Sorbonne, Henri Delacroix (1873-1937), und der Dekan der evangelischen theologischen Fakultät in Paris, Maurice Goguel (1880-1955), ermöglichten ihm eine regelmäßige Lehrtätigkeit, jeweils an der Sorbonne und an der École pratique des Hautes Études.
Es ist die Zeit, in der Soziologie und Psychologie sich endgültig von der Philosophie emanzipieren und zu selbstständigen, empirischen, nicht mehr an der Metaphysik orientierten Wissenschaften werden. In der zeitgenössischen Philosophie erfolgen entscheidende Umbrüche. So gibt es nicht nur eine Neubesinnung auf Kant, die phänomenologische Bewegung mit Husserl (Logische Untersuchungen 1900/1901) und die unaufhaltsamen positivistischen Philosophien, sei es in materialistischer oder logischer Gestalt, ringen miteinander. In Mode ist auch die Lebensphilosophie im Zuge einer unmittelbaren Rezeption Nietzsches und der Willensmetaphysik Schopenhauers. Sie bestimmt weitgehend die philosophische und literarische Geisteswelt. Das Verhältnis von Jousse zur Philosophie ist von Spannungen geprägt. Am Collège de France war er mit Edouard Le Roy (Schüler und späterer Nachfolger von Henri Bergson) befreundet. Bergson bleibt der am meisten zitierte Philosoph im Werk von Jousse. In seinen Vorlesungen verweist Jousse sehr oft auf Bergson, ohne mit ihm in allem übereinzustimmen. Die Kontroverse, die in Frankreich entstand, als die ersten drei Werke Bergsons vom Heiligen Offizium 1914 auf den Index gesetzt wurden, spielt für Jousse gleichwohl keine Rolle.
In Folge der anhaltenden Modernismuskrise, die zur Verurteilung des Theologen Alfred Loisy (1857-1940) führte, betonte Jousse stets, dass er als „Anthropologist“ und nicht als „Theologist“ sprechen wollte. (Das Suffix „-ist“ ist ironisch gemeint und ermöglichte es Jousse, sich von der traditionellen Anthropologie zu distanzieren).
Die Vorträge, die Jousse 1927 am Päpstlichen Institut für Bibelwissenschaft in Rom gehalten hat, spielen eine entscheidende Rolle in seinem Leben. Er begegnete damals nicht nur Papst Pius XI. bei einer Privataudienz, sondern auch einer Reihe deutscher Exegeten, mit denen er Fachfragen diskutieren konnte. Augustin Bea, der später zum Kardinal erhoben wurde, war einer von ihnen. Weitere Personen sind Leopold Fonck und Paul Gächter, beides Jesuiten. Italienische Zeitungen berichteten von seinem neuen Ansatz. Unter den französischen Exegeten muss man vor allem die Rolle des Jesuiten Léonce de Grandmaison (1868-1927) für Jousse unterstreichen. Er schrieb eine ausführliche Rezension zum style oral. In seiner posthum erschienenen Monographie Jesus-Christ (1928) hat er die Neuheit der Recherchen von Jousse unterstrichen und für die eigene exegetische Arbeit fruchtbar gemacht.
Marcel Jousse‘s erstes Werk
Der style oral
1925 erschien das erste Hauptwerk: Style oral rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-moteurs beim Verlag Beauchesne in Paris. Dieses Buch machte Jousse in der Fachwelt schlagartig bekannt. Dieses erste Buch, das die Doktorarbeit von Jousse hätte werden sollen, besteht aus einer Aneinanderreihung von Zitaten. Jousse sagt, dass er 5000 Bücher gelesen hat. Daraus hat er 500 ausgewählt, und schließlich aus mehr als 200 Büchern passende Sätze nach einem logischen Plan, der seiner Sicht nach den engen Zusammenhang zwischen Anthropologie und Linguistik dokumentiert, geordnet. Er fügte dazu eine einheitliche Terminologie ein, so dass es beim bloßen Zuhören nicht möglich war, die verschiedenen Quellen voneinander zu unterscheiden. Im geschriebenen Text sind sie sorgfältig dokumentiert. Dieses Vorgehen war offenbar eine strategische Entscheidung. Jousse hoffte, dass diese originelle Arbeit von der Fachwelt so besser angenommen werde.
Worum geht es in diesem Werk? Um den Prozess der Weitergabe und Bewahrung in einer Kultur der Mündlichkeit als Gegensatz zur Literalität als die Fähigkeit, zu lesen und schreiben. Den Begriff des „style oral“ hat Jousse geprägt. Es handelt sich hier um einen Theorie-Begriff. Er meint etwas anderes als mündliche Rede oder Unterhaltung. Der „style oral“ ist ein geformter Sprachstil, der bestimmte Merkmale (Rhythmus, Bilateralismus, Formulismus, Globalismus) aufweist, die sich in allen mündlichen Kulturen wiederfinden. Es handelt sich sowohl um eine anthropologische als auch um eine soziale Notwendigkeit. Denn „eine präliterale Gesellschaft kann nur bestehen, wenn ihre Genealogien, Gesetze, Gebete und Zaubersprüche in zuverlässiger Form von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden“, so Heinz Schlaffer. Das Erstlingswerk von Jousse bietet etwas wie eine Gesamtübersicht über die „psycho-physiologische Methode“ von Jousse, der nun zum „Vater“ einer neuen Wissenschaft wird, der Anthropo-linguistik, die auf der strengen Beobachtung von Fakten beruht und, so der Autor, jede metaphysische und kritische Schlussfolgerung ausschließt.
Bemerkenswert ist, dass der „style oral“ von einer Reihe zeitgenössischer deutscher Exegeten, zunächst von Katholiken (L. Fonck, P. Gächter, A. Bea), später aber auch von evangelischen Theologen (R. Riesner, G. Bader) mit Anerkennung aufgenommen wurde. In einem Fach, in der die Paradigmenwechsel nicht selten sind, ist diese Konstante beachtenswert. Was kann uns die Forschung von Marcel Jousse zur mündlichen Kultur an neuen Erkenntnissen bringen? Zunächst eine Beobachtung: Da wir in einer ausgesprochenen Schriftkultur leben – oder vielleicht bereits einer postschriftlichen Kultur, wenn man die Rolle von Icons, Piktogrammen und Smileys bedenkt –, ist es kaum möglich, uns die Bedingungen und Gesetze einer mündlichen Kultur vor Augen zu führen. Walter Ong beschreibt es in seinem maßgeblichen Werk Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes so: „Die Vorstellung von oraler Tradition oder vom Erbe oraler Darbietungen, Genres und Stile als orale Literatur gleicht der Vorstellung von Pferden als Autos ohne Räder. Am Ende einer solchen Beschreibung kommt nur etwas Lächerliches zustande. … Man kann nicht ohne schwere und lähmende Verzerrung ein primäres Phänomen beschreiben, indem man mit einem späteren sekundären Phänomen beginnt und die Unterschiede unter den Tisch fallen lässt.“ Dies hat mit der in einer von der Schrift geprägten bzw. dominierten Kultur wachsenden Trennung zwischen Sprache und Leiblichkeit zu tun.
In der Tat betrachtet Jousse den Menschen als eine Einheit, als ein unzertrennliches Leib-Seele-Kompositum und wird nie müde, einen Satz seines Lehrers Pierre Janet zu wiederholen: „Der Mensch denkt mit seinem ganzen Leib“. Der Mensch nimmt alles auf mimetische Weise auf und drückt es auch mit seinem ganzen Leib aus. Damit werden natürlich Zusammenhänge und Problemstellungen berührt, die man von Aristoteles bis René Girard oder Hans Plessner aufweisen könnte.
Wenn Jousse den Menschen betrachtet, hebt er zunächst seine bilaterale Struktur hervor. Der Mensch ist – im Bild gesprochen – ein Wesen mit zwei Flügeln, er gleicht einer Doppeltür. Diese Bilateralität prägt sein Denken und seinen sprachlichen Ausdruck. Jousse spricht aber auch von einer dreifachen Orientierung des Körpers im Raum: oben/unten; rechts/links; vorne/hinten. Dies ermöglicht dem Menschen das Schaukeln, das Wiegen oder das Balancieren von einem Fuß auf den anderen. So kann der Mensch aber auch Gewichte gleichmäßig verteilen und leichter tragen.
Hinzu kommt, dass Rhythmus immer mit Energie zu tun hat. Diese Kombination aus gespeicherter Energie und rhythmischer Auf- und Entladung kommt in der traditionellen Rezitation von mündlich geformter Sprache zum Vorschein und wird zur wichtigsten Stütze für das Gedächtnis. Die Bewegung des Oberkörpers von oben nach unten beim Beten und Lernen der frommen Juden hat keinen anderen Grund. So zeigt Jousse, wie der Linguist Antoine Meillet es formulierte, dass „das Balancieren des Satzes ein natürliches, notwendiges Faktum ist“, ein Faktum, dass in der Grundstruktur des Leibes verankert ist. Es handelt sich nicht um ein ästhetisches, sondern um ein psycho-physiologisches, mnemotechnisches und dann auch pädagogisches Gesetz.
Ein mündlich komponierter und geformter Text wird durch Einverleibung ganzheitlich memorisiert und ganzheitlich weitergegeben. Eine Trennung zwischen Wiegeschritt, Text und Melodie gibt es nicht. So erklärt sich die Überschrift des Werkes von Jousse Der rhythmische und mnemotechnische Oralstil bei den Verbo-motoren. Um dies zu verstehen, muss man hinter eine Praxis zurückgehen, die in unserer abendländischen Kulturgeschichte im Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit beginnt und bis in unsere Tage anhält. In der antikisierenden Renaissance und vor allem im letzten Jahrhundert mit seiner obsessiven Philologie trieb man den Hellenismus auf die Spitze. Das Evangelium war nun weniger als zuvor die mündliche Botschaft.
Es wurde zu einem Buch wie alle anderen (oder fast), aus dem man bestenfalls laut vorliest. In den Texten, die man nicht mehr auswendig konnte, sondern die nur noch gedruckt wurden, kamen all die verborgenen Elemente mündlicher Tradition nicht mehr zur Geltung. Man sah nur noch den griechischen Text und man übersetzte ihn, als wäre es Platon. Niemand kümmerte sich um die aramäisch-targumische Formgebundenheit, die in diesen Texten lebt. Die Leibgebundenheit der Sprache war vergessen und trat in den Hintergrund.
Auf der Folie seiner anthropologischen und ethnologischen Studien und mit seiner Kenntnis der alten Sprachen betrachtete Jousse die Texte der Evangelien neu und in veränderter Perspektive. So entdeckte er im griechischen Text einen ähnlichen Satzaufbau, wie Robert Lowth (1710-1787) ihn für die hebräische Poesie festgestellt hatte und für den dieser die Bezeichnung „Parallelismus membrorum“ erfand. Das Phänomen bezeichnet, dass ein Vers (meistens) aus zwei Vershälften bzw. -zeilen besteht, die in der einen oder anderen Weise aufeinander abgestimmt oder eben zueinander „parallel“ sind. Der Ursprung und das Warum dieser stilistischen Form werden von Lowth nicht erklärt.
Jousse führte eine ausgleichende Typographie ein, etwa wie wir sie in den neuen Lektionaren wiederfinden. Noch besser ist es natürlich, wenn diese Struktur bereits bei der Übersetzung berücksichtigt wird. Eine wichtige Dimension des Textes geht verloren, wenn man nur darauf bedacht ist, einen Inhalt losgelöst von seiner ursprünglichen Form zu vermitteln. Man bleibt beim Text. Jousse ermöglicht mit seiner anthropologischen Sichtweise nun gleichsam den „Sprung“ zurück vom Text zum Menschen, indem er dem Element des sprachlichen und biologischen Rhythmus besondere Aufmerksamkeit schenkt.
Aufgenommen wurden diese Einsichten etwa von Günter Bader in seinen beiden Büchern zu den Psalmen. Er schreibt: „Die Produktion des Wortes ist leiblich, leiblich auch seine Rezeption. Leiblichkeit des Wortes zeigt sich in erster Linie als Oralität“. Nach Jousse wird erst von der Anthropologie her einsichtig, dass stilistische Phänomene sich zunächst bestimmten Gesetzmäßigkeiten des Körpers bzw. des Leibes verdanken und nicht so sehr inneren Regeln und Strukturen einer festgelegten Grammatik und Stilistik, die es nur für eine geschriebene Sprache gibt.
In diesem Zusammenhang ist aber noch ein weiteres Phänomen in Blick zunehmen. Die fundamentale Revolution, die mit der Einführung der Schrift geschah: Die Trennung des Wissenden vom Wissen kennt nämlich eine mündliche Kultur so nicht. So das Forscherpaar Assmann: „Das Wissen wird ausgelagert. Damit befreit es sich zugleich von seiner mnemotechnischen, rhythmischen Formung und den narrativen Formzwängen. Es wird aufteilbar in Spezialgebiete, kann in der Form empirisch fundierter Prosaschriften elaboriert werden“.
Dem entgegen steht das ganze Werk von Marcel Jousse, das wesentlich zur Wiederentdeckung des anthropologischen Reichtums der mündlichen Tradition beigetragen hat. So ein Statement des amerikanischen Oralitätsforscher Werner H. Kelber: „Die Vorstellungen etwa, wie sie vom französischen Sprachwissenschaftler Marcel Jousse erarbeitet worden waren, dass nämlich Oralität niemals in rein verbalen Kontexten existiert, sondern immer auch eine somatische Komponente in sich trägt und dass Sprache und mündliche Performanz in der Bilateralität des Körpers konstituiert sind, sind der gegenwärtigen Mündlichkeitsforschung zwar durchaus bekannt, aber dieses Grundwissen um mündlichen Stil und Diktion hat in der Literaturgeschichtsschreibung kaum Eingang gefunden.“ Der letzte Reflexionsschritt zielt auf die daraus resultierende Praxis.
Die Praxis : Das Bibelrezitativ
Neben seinen Forschungs- und Lehraufgaben arbeitete Jousse an einem besonderen Projekt. 1932 erfolgte die Gründung des Instituts für Rhythmo-Pädagogik. Es sollte dazu dienen, die herausgearbeiteten Zusammenhänge zwischen Rhythmus, Gedächtnis und Text im Oralstil in die Praxis umzusetzen. Seinen Ausdruck „récitatifs rythmo-pédagogiques d’évangile“ kann man einfach mit „Bibelrezitative“ übersetzen. Solche Bibelrezitative entstanden in enger Zusammenarbeit mit der Musiklehrerin Gabrielle Desgrée-du-Lou, die er im Jahr 1922 kennengelernt hatte. Sie sollte die Musik zu seinen Bibelrezitativen komponieren, und zwar anhand der Melodien, die der Bibelwissenschaftler G. Dalman (1855-1941) in Palästina gesammelt und in einer wissenschaftlichen Abhandlung 1901 veröffentlicht hatte. Diese eindrucksvollen und anspruchsvollen Rezitative sind nach den Gesetzen dieses mündlichen Stils komponiert.
Es fällt auf, dass die ersten Vorführungen dieser mündlichen Kompositionen zunächst in einem wissenschaftlichen oder profanen Kontext stattgefunden haben wie im Théâtre des Champs-Élysées oder im Rahmen von Forschungs-Kolloquien. Wir besitzen zwei hochinteressante Berichte über die Vorführungen der Rezitative aus dieser Zeit: einen Bericht aus dem ersten Kongress für experimentelle Psychologie, 1929, und einen zweiten Bericht, der in der jüdischen Zeitschrift „Die Wahrheit“ 1934 erschien. Das ganzheitliche Lernen ist mittlerweile, seit der Reformpädagogik, fester Bestand erzieherischen Handelns. Es entlastet das kognitive Gedächtnis und das Erlernte bleibt länger und leichter verfügbar. Grundsätzlich basiert das Bibelrezitativ auf der Wiederholung des Stoffes, Satz für Satz, Zeile für Zeile, Schrittlänge nach Schrittlänge. Der Vorgang läuft aber nicht bloß mechanisch ab. Der Körper bzw. der Leib des Menschen ist keine Maschine, die mit mathematischer Exaktheit die gleichen Bewegungen ausführt. Ein solches Lernen erweist sich als pädagogisch bewährte Form des Memorisierens von Texten, die zum Grundbestand unserer christlichen Tradition gehören. Als gemeinschaftliches Geschehen generiert es primär Freude und trägt zur Integration des Erlernten bei.
Outlook
Die Rezeption des Werkes von Marcel Jousse steht noch am Anfang. Die posthum erschienene Anthropologie du geste ist bereits in englischer und italienischer Sprache erschienen. In Frankreich haben mehrere große Tagungen anlässlich des fünfzigsten Todestags von Jousse (2011) stattgefunden, z. B., im Centre des Bernardins in Paris und an der Universität von Lyon. Darüber hinaus fand 2014 ein wissenschaftlicher Kongress an der Universität in Bordeaux statt. Jousse lehrt uns einen bewussteren Umgang mit der Sprache als leibliches Phänomen und trifft hier mit der deutschen und französischen Phänomenologie (Husserl, Merleau-Ponty) zusammen. Dieser Aspekt und dieses Verständnis des Leibes als unsere Art und Weise, in der Welt zu sein, und als unser Modus, eine Welt zu haben, verdiente es, noch weiter vertieft zu werden. Eine alte Praxis hat Jousse wiederbelebt, das rhythmische und mnemotechnische fundierte Erlernen von Texten, die uns zwar schriftlich überliefert worden, aber in einer mündlichen Kultur entstanden sind. Diese Praxis als gemeinschaftlicher Vollzug, aber auch die Bewahrung und Weitergabe historisch verankerten Kulturgutes, könnte in verschiedenen Bereichen Eingang finden, z. B. im Religionsunterricht und in der Katechese, aber auch in der Liturgie. „Die mündliche Verkündigung oder Besoretâ – das ist die aramäische Bezeichnung des Evangeliums – bleibt so, was sie zu Beginn auf den Lippen Jesu und seiner Jünger war: eine mündliche, melodiöse Verkündigung, die sich den Jüngern einprägte, um so noch tiefer aufgenommen und verstanden zu werden von jedem Menschen, der in diese Welt kommt“ (M. Jousse).