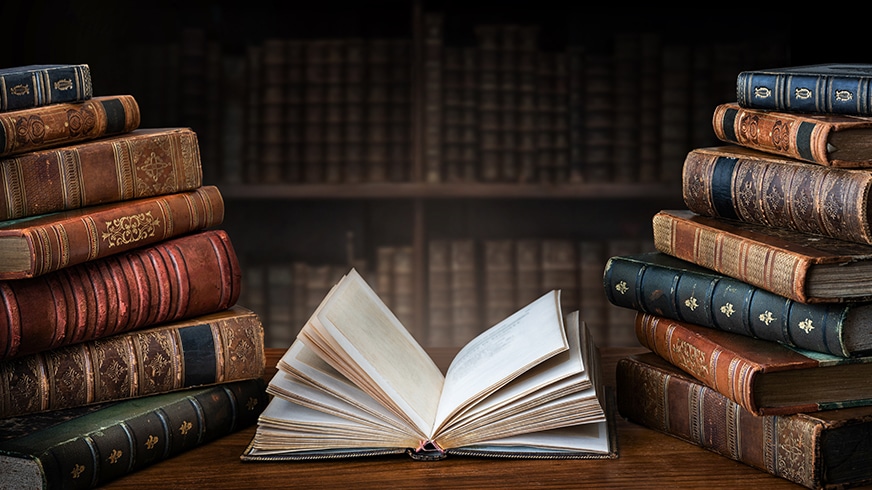I.
„Einzigartiger der Hunnen, König Attila,
Spross seines Vaters Mundzuc,
Herr der tapfersten Stämme,
Der mit nie zuvor gehörter Macht
Alleinherrscher skythischer und germanischer Reiche war,
Der Roms beide Imperien durch die Eroberung seiner Städte in Schrecken versetzte
Und der, statt alles Übrige als Beute zu unterwerfen,
sich durch Bitten erweichen ließ,
einen jährlichen Tribut in Empfang zu nehmen.
Nachdem er das alles durch des Glückes Lauf vollbracht hat,
Starb er nicht an einer Wunde von Feindeshand,
Nicht durch die Hinterlist seiner Angehörigen,
Sondern ohne dass sein Volk Verluste erlitt,
Schmerzlos unter fröhlichen Umständen.
Wer will das für das Ende halten,
Für das er keine Rache zu üben gedenkt?“
Diesen Hymnus sangen hunnische Adlige 453 bei der nächtlichen Totenfeier ihres überraschend verstorbenen Königs Attila. Die lateinische Fassung überliefert der gotische Historiker Jordanes, und man hat mit Recht vermutet, dass sie letztlich auf ein hunnisches Original zurückgeht.
Etwa 80 Jahre zuvor waren erstmals Gruppen von Reiternomaden aus der Steppe nördlich des Schwarzen Meeres über den Don, die Grenze zwischen Europa und Asien, nach Westen vorgestoßen und hatte in mehreren Kämpfen um 375 das Großreich des ostgotisch-greutungischen Königs Ermanarich zerschlagen. Hunnen war der gemeinsame Name, den ihnen unsere griechischen und lateinischen Quellen gaben, ohne dass wir daraus auf eine einheitliche Völkerschaft schließen dürfen. Dank ihrer Kampfkraft, der Schnelligkeit ihrer Pferde und der Reichweit und Durchschlagskraft ihrer Reflexbogen waren sie dem Gegner überlegen. Ihr Erfolg gegen Ermanarich verdankte sich zudem einer größeren Kriegerkoalition, zu der Alanen nördlich des Kaukasus gestoßen waren. Wie locker die Koalition war, zeigte sich, als Nachfolger Ermanarichs mit hunnischen Verbündeten gegen die Alanen vorgingen.
Hunnische und alanische Gruppen waren auch unter den gotischen Scharen, die vor dem Druck der Hunnen über die Donau ins Römische Reich auswichen und 378 bei Adrianopel das Heer des oströmischen Kaisers Valens vernichteten. Traditionell gelten diese Jahre als der Beginn der Völkerwanderung. Bei den zeitgenössischen römischen Historikern Eunapius und Ammianus Marcellinus und bei den Kirchenvätern Ambrosius und Hieronymus spiegelt sich das Entsetzen, das seit 378 die verheerenden Überfälle und Plünderungen einzelner Hunnengruppen südlich der Donau auslösten. 395 und 398 folgten weiträumige Einfälle in Mesopotamien, Syrien und Kleinasien.
Doch Ostrom und Westrom bedienten sich nun auch hunnischer Kontingente als Militärhilfe in innerrömischen Auseinandersetzungen. So bot der weströmische Heermeister Bauto 383 Hunnen gegen den gallischen Usurpator Magnus Maximus auf. Mit ihnen trat Kaiser Theodosius 388 ebenfalls Magnus Maximus in Pannonien entgegen, und 394 besiegte er dank einer gotisch-hunnischen Armee am Frigidus, der Wippach, den Usurpator Eugenius. Theodosiusʼ Heermeister Stilicho umgab sich mit einer hunnischen Leibwache. Auch in der Residenz Ravenna lag eine hunnische Garnison. Stilicho konnte 408 erst gestürzt werden, nachdem seine Hunnen niedergemetzelt worden waren.
Inzwischen waren hunnische Verbände in die ungarische Tiefebene vorgedrungen, wo sie sich die Goten und Gepiden unterwarfen und Uldin eine Führerstellung errang. Seine Herrschaft verteidigte er 401 gegen den gotischen Heermeister Gainas, der sich nach einer gescheiterten Empörung in Konstantinopel mit Stammesgenossen über die Donau zurückzog, aber von Uldin geschlagen wurde. Der sandte seinen Kopf nach Konstantinopel zu Kaiser Arcadius und wurde dafür mit Gold und einem Vertrag belohnt, dem zufolge der Hunnen-Anführer wohl Truppen zu stellen hatte.
Das tat er 406, als der Gote Radagaisus mit einem riesigen Völkerschwarm in Italien einfiel, aber bei Fiesole von Stilicho mit hunnischer Hilfe besiegt wurde. Die Beute und der Sold, den Uldins Hunnen aus Italien mitbrachten, waren ein Mittel, um seine Stellung zu stärken. Vielleicht waren es hunnische Gruppen weiter östlich, die davon nicht profitiert hatten und deswegen Uldin bestimmten, ungeachtet seiner bisherigen Beziehungen zu West- und Ostrom 408 zusammen mit abhängigen germanischen Skiren einen weiträumigen Einfall in Thrakien zu unternehmen. Kaiser Arcadius war gerade gestorben. Nach einer römischen Niederlage verweigerte er Friedensverhandlungen, worauf die Römer zu einem alten Mittel griffen: Sie bestachen seien führenden Gefolgsleute, die ihn verließen. Er musste sich über die Donau zurückziehen, wo sich seine Spur verliert, ein Zeichen, dass von dynastischer Anhänglichkeit noch nicht die Rede sein konnte.
Gegen die Westgoten, die unter König Alarich seit 408 Italien auf der Suche nach einer neuen Heimat beunruhigten, wappnete sich Kaiser Honorius mit 10.000 Hunnen. Darunter könnten vor allem diejenigen gewesen sein, die Uldin davongelaufen waren. Als Athaulf 409 seinem Schwager Alarich zu Hilfe kam, bereiteten ihm 300 Hunnen von Ravenna aus eine herbe Niederlage.
Aus einem Fragment des griechischen Historikers Olympiodor, der um 412 eine Gesandtschaftsreise zu den Hunnen unternahm, begleitet von seinem vielbestaunten und sprachbegabten Papagei, erfahren wir von Königen der Hunnen, einem Oberkönig Charaton und von Streit unter ihnen wegen der Ermordung eines Mannes mit dem lateinischen Namen Donatus. Mit Geschenken an Charaton habe der römische Kaiser den Streit beigelegt. So sorgte er für Ruhe auf beiden Seiten.
Die Diözesen Thrakien und Mösien blieben das bevorzugte Ziel hunnischer Einfälle. Zum Jahr 422 bietet eine lateinische Chronik den dürren Satz: „Die Hunnen haben Thrakien verwüstet.“ In dieser Zeit errang eine Sippe im hunnischen Kerngebiet vielleicht deswegen einen Vorrang, weil sich in ihr vier Brüder ausgezeichnet hatten: Octar, Ruga, Mundzuc und Oëbarsius. Octar und Ruga erscheinen in unseren Quellen als Könige. Während Octar nach Westen vorstieß und am Rhein gegen die Burgunden kämpfte, aber bald darauf starb, könnte Ruga den Einfall in Thrakien angeführt haben. Seinen Abzug erkaufte Kaiser Theodosius II. mit einem jährlichen Tribut von 350 Pfund Gold, das Pfund 72 Goldsolidi.
425 stellte Ruga dem späteren weströmischen Heermeister Aëtius, der mehrere Jahre als Geisel bei den Hunnen gelebt hatte, für eine hohe Bezahlung ein großes Heer zur Verfügung, um den weströmischen Usurpator Johannes in Ravenna gegen eine oströmische Armee zu verteidigen. Die Hunnen kamen aber erst drei Tage nach Johannesʼ Sturz an. Die anschließende Schlacht mit den Oströmern ging unentschieden aus. Ruga wollte nun seine Herrschaft über sämtliche Stämme nördlich der Donau ausdehnen und verlangte 433 von Theodosius, alle Bündnisse mit ihnen aufzugeben und diejenigen auszuliefern, die sich „als römische Alternative“ (Wolfram) unter seinen Schutz begaben, auszuliefern. Doch bevor er seine Kriegsdrohung wahrmachen konnte, starb er um 434, angeblich durch einen Blitzschlag, was in Ostrom als Gottesurteil angesehen wurde.
II.
Seine Neffen Bleda und Attila übernahmen als Könige sofort die Nachfolge. Mit Ostrom schlossen sie bei Margus an der Donau einen Vertrag, der neben Handelsbeziehungen die Auslieferung sämtlicher Hunnen vorsah, die sich auf die römische Seite begeben hatten. Hinter der später stets wiederholten Forderung stand der absolute Herrschaftsanspruch über alle hunnischen Stämme, zugleich aber auch wie schon bei Uldin und Ruga die Auffassung, dass die Römer nördlich der Donau nichts mehr zu suchen hatten. Zwei junge Angehörige der Königssippe, die beim Herrscherwechsel sofort geflohen waren, wurden gefangen genommen und noch auf römischem Boden gekreuzigt. Später wehrten sich hunnische Überläufer heftig gegen eine Auslieferung und begingen lieber Selbstmord. Sie wussten, was ihnen von ihren Königen blühte. In Margus wurde Rugas Jahrestribut verlängert, bei zwei Königen von 350 auf 700 Pfund Gold.
Die Hoffnung, mit diesen Tributen, die billiger als Kriege waren, die Herrschaft der Könige zu stabilisieren und damit die Lage jenseits der Donau zu beruhigen, erfüllte sich nicht. Erfolgreiche Beutezüge waren lukrativer und daher das wirksamste Mittel, das Prestige des Anführers zu erhöhen, die eigene Kriegskoalition zusammenzuhalten und neue Verbündete zu gewinnen. Offensichtlich hatten die Könige nichts dagegen, dass der Heermeister Aëtius in den 30er Jahren des 5. Jahrhunderts hunnische Söldner anwarb. Mit ihnen im Rücken förderte er erst seine Karriere und band dann große Teile des erschütterten Gallien wieder an das weströmische Reich.
436 oder 437 besiegten Hunnen die Burgunden am Rhein, der historische Kern der Nibelungensage. 441 und 442 machten Bleda und Attila mit ihren Verbündeten einen großen Einfall in Thrakien und im Illyricum. Mittlerweile hatten die Hunnen auch gelernt, größere Städte zu erobern. Viminacium (Kostolac), Singidunum (Belgrad), Sirmium (Sremska Mitrovica) und Naissus (Niš) fielen ihnen zum Opfer. Theodosius schickte eine hochrangige Gesandtschaft, die Frieden schloss und ihn reichlich vergoldete.
Wenn in den nächsten Jahren an der Donaufront Ruhe herrschte, so war ein Grund, dass Attila beschloss, sich der Alleinherrschaft zu bemächtigen. 444 oder 445 ermordete er seinen Bruder Bleda, und es gelang ihm, sich auch bei dessen empörten Stammesteilen durchzusetzen.
Jordanes schrieb ihm sogar zu, er wolle Römer und Westgoten unterwerfen, und lieferte an dieser Stelle ein Porträt von ihm, das auf den Augenzeugen Priscus zurückging: „Ein Mann, dazu geboren, die Völker der Welt zu erschüttern, der allen Ländern Furcht einflößte und auf irgendeine Weise alles durch den grausigen Ruf, der von ihm ausging, in Schrecken versetzte. Denn stolz war sein Gang, hierhin und dorthin wandte er seine Augen, so dass seine Herrschaftsgewalt schon durch seine Körperhaltung deutlich wurde. Er liebte Kriege, hielt sich aber persönlich zurück; in seinem Planen war er äußerst entschlossen; von Bittstellern ließ er sich erweichen und war loyal zu denen, die er einmal ausgewählt hatte. Er war von kleiner Gestalt, breiter Brust, ziemlich großem Kopf, engen Augen, spärlichem Bartwuchs, graumeliertem Haar, platter Nase und hässlicher Hautfarbe, womit er die Merkmale seiner Herkunft bewahrte“.
Kein Hunne sollte Bleda vermissen. Daher fiel Attila 447 noch weiträumiger als 441 und 442 in den Balkan ein, drang nach einer siegreichen Schlacht bis zu den Thermopylen in Mittelgriechenland ein und wandte sich dann gegen Konstantinopel, das im Januar des Jahres von einem schweren Erdbeben erschüttert worden war. Die eingestürzten Stadtmauern waren in einer gemeinsamen Anstrengung sofort wieder hochgezogen worden, was die Stadt rettete. Nach einer weiteren Niederlage musste Theodosius erneut um Frieden bitten.
Attilas Diktat war hart: Nachdem die Tribute zuletzt gestockt hatten, waren 6000 Pfund Gold sofort zu bezahlen und der künftige Jahrestribut wurde auf 2100 Pfund Gold erhöht. Auch der Preis für den Loskauf jedes Kriegsgefangenen wurde auf 12 statt 8 Solidi erhöht. Alle Überläufer waren ebenfalls auszuliefern. Kurz darauf verlängerte Attila eine Sicherheitszone von fünf Tagesreisen südlich der Donau, die kein Römer betreten durfte. Da das den Handel erschwerte, gab er diese Forderung aber bald auf.
Attila stand auf dem Höhepunkt seiner Macht. Kuridachos, Oberkönig der unterworfenen hunnischen Akatiren, schmeichelte ihm als dem „größten der Götter“. Und wenn Römer vor Hunnen es wagten, ihn als Menschen dem vergöttlichten Kaiser Theodosius nachzustellen, riskierten sie eine Schlägerei. Das berichtete Priscus, der 449 eine Gesandtschaft zu Attila begleitete. In einem der spannendsten Reiseberichte der antiken Literatur lieferte er authentische Bilder von den Verhältnissen in Attilas engerem Herrschaftsgebiet in der ungarischen Tiefebene und von seiner Hofhaltung in seiner wohlgebauten Residenz. Die Römer durften an einem großen von Heldenliedern begleiteten Gastmahl Attilas mit seinen hunnischen Kriegern teilnehmen.
Erstaunt erfuhren sie, dass seine Kanzlei genau über hunnische Flüchtlinge Buch führte, die namentlich zurückgefordert wurden. Es gab einen römischen und einen griechischen Sekretär für die Korrespondenz mit West- und Ostrom. Zu Attilas engeren Kreis von Beratern und Helfern, den logades, gehörten Hunnen und Nichthunnen, und eine Freundschaft verband Attila mit dem Gepidenkönig Ardarich und dem Ostgotenkönig Valamir, deren Stämme unter seiner Oberhoheit nördlich und südlich der Donau siedelten.
Vigilas, der Dolmetscher der Reisegruppe, verfolgte den stümperhaften Plan, Attila mit Hilfe seines bestochenen Leibwächters Edekom zu ermorden. Der Plan, den der mächtige Hofbeamte Chrysaphius, ein Eunuch, mit Theodosius ausgeheckt hatte, flog auf, weil Edekon ihn verriet. Attilas in diesem Fall gewiss nicht fingierter Zornesausbruch hätte Vigilas und seinen Sohn beinahe das Leben gekostet, hätte er sich nicht mit 50 Pfund Gold losgekauft. Der göttliche Theodosius musste sich in einem bitterbösen Brief von Attila beschimpfen lassen, dass er ihn degradiert habe. Er sei vom Schicksal zum Besseren erhoben worden, und Theodosius sei sein Sklave. Solche Töne hatte sich noch kein Barbarenkönig gegenüber einem römischen Kaiser erlaubt.
Aber Attila war sich bewusst, dass er jenseits solcher Schockdiplomatie die weitere Ausdehnung seiner Macht nicht vernachlässigen durfte. Auf dem derzeitigen Stand zu bleiben, hätte leicht zu einem Rückschlag führen und seine Herrschaft gefährden können. Daher richtete er seinen Blick auf den Westen des Römischen Reiches, nachdem die Donauprovinzen im Osten ausgeblutet waren. Willkommene Begleiterscheinung war die Verbindung, die Kaiser Valentinians Schwester Honoria mit ihm aufgenommen hatte. Attila interpretierte sie als Heiratsantrag und verlangte von Kaiser Valentinian die Hälfte seines Reiches als Mitgift. Dessen Weigerung war mit eine der Rechtfertigungen, zum Einfall in Gallien zu rüsten.
Ein riesiges Aufgebot von Hunnen und Verbündeten überschritt im Frühjahr 451 den Mittelrhein, zerstörte von Trier bis Zentralgallien alle Städte, kam aber vor Orléans zum Stehen. Attila zog sich bis zu den Katalaunischen Feldern bei Troyes zurück, wo ihn Aëtius mit einer großen Koalition, darunter vor allem den Westgoten, entgegentrat. In der blutigen Schlacht blieb Aëtius Sieger und zwang Attila zum Rückzug.
Dessen Einfall in Italien im folgenden Jahr sollte den Schaden an seinem Nimbus wiedergutmachen. Aquileia fiel nach dreimonatiger Belagerung, die Städte Oberitaliens bis Mailand folgten. Aëtiusʼ Vorrücken mit oströmischen Truppen und die riesige Beute, die die Hunnen gemacht hatten, sprachen für den Rückzug, den eine Gesandtschaft unter Papst Leo begrüßte. Raffael hat in der Stanza di Eliodoro im Vatikanpalast die Begegnung zwischen Papst und Hunnenkönig gemalt. Seuchen in der Sommerhitze, die auch spätere Invasionsarmeen dezimierten, mögen hinzugekommen sein.
Im Osten hatte Kaiser Marcian, der Nachfolger des 450 verstorbenen Theodosius, in der Zwischenzeit eine hunnische Schar über die Donau zurückgetrieben und sich schon vorher geweigert, die Tribute seines Vorgängers weiter zu zahlen. Attila beschloss, ihn im nächsten Jahr seine Hand spüren zu lassen. Zuvor wollte er noch die Zahl seiner Ehefrauen vergrößern. In der Hochzeitsnacht mit der Germanin Idilko starb er jedoch an einem Blutsturz. Dem naheliegenden Gerücht, er sei von ihr ermordet worden, widersprach das eingangs zitierte Totengedächtnis.
III.
Attilas Macht und Größe belegten e negativo seine Söhne, die sich nach seinem Tod sofort um die Herrschaft stritten und es daher nicht fertigbrachten, sein Reich zusammenzuhalten. Den entscheidenden Stoß erhielt es bereits im folgenden Jahr in einer Schlacht am Nedao in Pannonien, in der ehemalige Verbündete Attilas, die sich nach seinem Tod losgesagt hatten, gegen einige seiner Söhne und treu gebliebene Stämme wie die Ostgoten siegten.
Für Attilas historische Größe spricht aber auch sein Nachleben. Sein Name blieb im kollektiven Gedächtnis Europas fester verankert, als das je bei einem anderen nichtchristlichen Großen der antiken Geschichte der Fall war. Dabei gilt für ihn mehr als für Schillers Wallenstein:
„Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt
Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.“
Das soll der zweite Teil meines Vortrags zeigen. Attilas Bild reicht vom blutrünstigen Tyrannen bis zum verehrten Helden und idealen Herrscher. Spätantike und mittelalterliche Chroniken sprachen vom Zeitalter Attilas, und Eugipp bestimmte im Eingangssatz seiner Severins-Vita die Ankunft des Heiligen in Noricum durch das Jahr, in dem der Hunnenkönig starb. Wichtige Vermittler waren die Viten gallischer und italischer Bischöfe, die die Feldzüge von 451 und 452 erlebt hatten. An ihrem Jahresgedächtnis wurde im Gottesdienst aus ihren Viten vorgelesen und über ihren Widerstand gegen Attila gepredigt. Schön früh wurden die Viten mit allerlei Wundererzählungen ausgeschmückt bis hin zu der erbaulichen Feststellung, Attila habe sich zum Christentum bekehrt. Ihm begegnet zu sein wurde geradezu zum Ehrentitel mancher Bischöfe und zum Ausweis ihrer Heiligkeit. Die theologische Deutung: Gott habe Attila geschickt, um die Menschen für ihre Sünden büßen zu lassen, führte zu seinem Beinamen „Geißel Gottes“.
Die Awarenkriege Karls des Großen 781 und 803 waren in den jüngeren Reichsannalen und bei seinem Biographen Einhard Feldzüge gegen die Hunnen, die für das bestraft wurden, was sie dem Frankenreich angetan hatten. Im 10. Jahrhundert lieferten die Einfälle der Ungarn, der nach Mitteleuropa und Italien zurückgekehrten Hunnen, neuen Stoff für Attilalegenden. Obwohl die Hunnen nie nach Paris kamen, rettete die spätere Patronin Genovefa die Stadt vor ihnen. Auch Köln sah keine Hunnen trotz der heiligen Ursula und der 11.000 Jungfrauen, die von ihnen niedergemetzelt wurden. Aquileia hatte Attila wirklich zerstört. Bei dem Dichter Paulinus von Aquileia schmorte er dafür in der Hölle. In Oberitalien besiegte der sagenhafte König Dardanus Attila, verfolgte ihn bis Rimini und erschlug ihn mit einem Schachbrett.
Gegenüber den Großen der germanischen Heldenepik, Männern wie Frauen, war Attila immer der Schwächere. Im Walthari-Lied musste er in ohnmächtigem Zorn seine Geiseln Walther und Hildegund ziehen lassen. Im älteren Atli-Lied der Edda tötete er die Burgunderkönige und wird dafür von ihrer Schwester Gudrun ermordet. Im jüngeren Atli-Lied staucht Gudrun ihren feigen Gemahl so heftig zusammen, dass er sie am Ende nur noch um ein ehrenvolles Begräbnis bitten kann. Der Attilastoff war im Mittelalter selbst unter Klerikern beliebt. Bischof Gunther von Bamberg (1057-1065) beschäftigte sich lieber mit Attila und den Amalern als mit Augustinus und Papst Gregor, wie der Leiter seiner Domschule Meinhard in einem Brief klagte. Von Gunther lässt sich vielleicht eine Brücke zu dem anonymen Verfasser des Nibelungenlieds schlagen, der wohl ebenfalls Kleriker war und dem Passauer Bischof Wolfger von Erla (1191-1204) nahegestanden haben könnte. König Etzel – die mittelalterliche Form für Attila – steht der Rache seiner Gemahlin Kriemhild an Hagen und ihren Brüdern hilflos gegenüber. Als zum Schluss die Köpfe Hagens und Kriemhilds rollen, bricht er zusammen mit Dietrich von Bern in Tränen aus.
Ungarische Historiker des 11. und 12. Jahrhunderts stellten Stammbäume Attilas auf, an deren Beginn Japhet, der Sohn Noas, oder der große Jäger Nimrod aus der Genesis standen. Später galt der ungarische König Matthias Corvinus (1458-1490) als der neue Attila.
Mit der modernen Geschichtsschreibung setzte auch die Analyse der Quellen zu Attila und den Hunnen ein. Montesquieu billigte im 19. Kapitel seiner „Betrachtungen über die Gründe der Größe der Römer und ihrem Niedergang“ von 1734 Attila schon in der Überschrift Größe zu. Seine Politik habe insofern zum Niedergang Roms beigetragen, als die römischen Kaiser nicht mehr in der Lage waren, die Barbarenvölker wie früher üblich gegeneinander auszuspielen.
Schärfer als Montesquieu sah sein Nachfolger Edward Gibbon im 2. Band seiner berühmten „History of the Decline and Fall of the Roman Empire“ von 1783 in Attila den „wilden Zerstörer“ und „schrecklichen Barbaren“, dem man das Diktum zuschrieb, wo sein Pferd hintrete, wachse kein Gras mehr. Gibbon war der Meinung, hätte der verweichlichte Kaiser Theodosius seine Truppen energisch aufgerüstet, so hätten die Barbaren „auf der Majestät des Reiches nicht länger herumgetrampelt“. Ludwig Theobul Kosegarten, Propst auf Rügen und später Geschichtsprofessor in Greifswald, sah 1801 in Aëtius den Helden, der auf den Katalaunischen Feldern das christliche Europa gegen die Tartaren gerettet habe.
Auch die Dichtung bemächtigte sich des Hunnenkönigs. Pierre Corneille brachte 1667 in Paris einen Attila auf die Bühne und erklärte im Vorwort, er sei mehr ein Mann des Kopfes als der Hand gewesen. 1809 erlebte die Tragödie „Attila“ des Konvertiten und Priesters Zacharias Werner in Wien ihre Uraufführung, ein „romantisches Erlösungsstück und Gnadendrama“: Bevor Attila von seiner Verlobten Hildegund erschlagen wird, hat ihm der Papst seine Sünden vergeben.
Goethe verkniff sich eine harsche Rezension, während die Napoleon-Gegnerin Madame des Staël begeistert war. Der Korse galt nach seinem Einfall in Italien 1796 so manchem Zeitgenossen, Papst Pius VI. darunter, als der moderne Attila, und er selbst zeigte sich noch in der Verbannung auf St. Helena von dem Vergleich angetan. Werners Drama inspirierte das Libretto zu Verdis Oper Attila von 1846. Auch hier bildete der tödliche Racheakt Odabellas, der Tochter des Herzogs von Aquileia, das dramatische Finale, in dem der Risorgimento spürbar wird.
Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 sahen die Franzosen in den Preußen die Hunnen, die unter Bismarck nach 451 ein weiteres Mal über Gallien herfielen. Spottend schrieb der Ministerpräsident an seine Frau im August 1870: „Die alten Weiber, wenn sie meinen Namen hören, fallen auf die Knie und bitten mich um ihr Leben. Attila war ein Lamm gegen mich. Nicht nur für die Franzosen war der nächste Attila Wilhelm II. Anlass war seine berüchtigte Hunnenrede vom 27. Juli 1900, mit er in Bremerhaven die Truppen für den Boxeraustand in China verabschiedete: „Führt eure Waffen so, dass auf tausend Jahre hinaus kein Chinese mehr wagt, einen Deutschen scheel anzusehen.“
Für viele Deutsche war der Attila Wilhelm eine Majestätsbeleidigung, wie das „Manifest der 93“ belegte, mit dem sich die bekanntesten deutschen Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs „An die Kulturwelt“ wandten. Am 2. September 1914 veröffentlichte die Londoner Times ein Gedicht von Rudyard Kipling: „The Hun is at the Gate“. Nach dem deutschen Überfall auf Belgien und der Bombardierung von Leuven, der die berühmte Bibliothek zum Opfer fiel, richtete der französische Schriftsteller Romain Rolland in einem offenen Brief an Gerhart Hauptmann die Frage: „Seit Ihr die Enkel Goethes oder Attilas?“, worauf Hauptmann antwortete: „Lieber sollen sich die Deutschen Söhne Attilas nennen lassen, als auf ihren Grabstein die Inschrift ‚Söhne Goethes‘ gesetzt bekommen.“
In den USA entfesselten Zeitungen, Büche und Filme einen Sturm der Entrüstung gegen die „Hunnen“, nachdem ein deutsches U-Boot am 7. Mai 1915 das britische Passagierschiff Lusitania versenkt hatte. Unter den fast 1200 Ertrunkenen waren 128 US-Bürger, was mit zum Anlass für den amerikanischen Kriegseintritt 1917 wurde. Ein Tag vor dem Waffenstillstand am 11.11.1918 verkündete die verbreitete britische Sonntagszeitung „News of the World“ die Schlagzeile: „Hunnische Kapitulation gewiss“. Für John Maynard Keynes, Mitglied der englischen Friedensdelegation in Versailles bot die deutsche Delegation unter Matthias Erzberger das typische Bild des deutschen Hunnen.
Fritz Langs Film „Die Nibelungen“ von 1924, „dem deutschen Volk“ gewidmet, schien diesem Bild widersprechen zu wollen. Heftiger wetterte Hitler im „Völkischen Beobachter“ 1921 gegen das Ausland, das die Deutschen als Hunnen verunglimpfte. Doch er selbst nannte im Dezember 1940 die Anweisung, nach dem Sieg über Frankreich die noch freie Südhälfte des Landes zu besetzen, „geheime Kommandosache Unternehmen Attila“. Dem Deckwort entsprechend erläuterte er: „Sollte örtlich Widerstand auftreten, ist er rücksichtslos zu brechen.“ Dazu kam es nicht mehr.
Denn nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion 1941 wurde für ihn Stalin zu Attila – er bevorzugte Etzel aus dem Nibelungenlied – und die Russen wurden zu Hunnen. Ein neuerlicher Hunnensturm bedrohe Europa, warnte er, und Propagandaminister Göbbels griff die Warnung eilfertig auf. Allan Bullock, dessen zweibändige Hitlerbiographie in den 50er Jahren millionenfach verkauft wurde, fand dagegen in Attila die einzige historische Gestalt, die er mit Hitler vergleichen mochte, und der jüngste Hitlerbiograph Ian Kershaw nahm den Vergleich auf. Jörg Friedrich verwob 2002 in seinem Buch „Der Brand“ die Bombardierung deutscher Städte mit Rückblicken auf Attila und die Hunnen, die in Köln die Heilige Ursula und 11.000 Jungfrauen abgeschlachtet und an Etzels Hof den Burgundern den Untergang bereitet hatten.
Trotzdem haben die Berliner ihre Attilastraße noch nicht umgetauft, und der Senat hat 1992 sogar den Mariendorfer Bahnhof in Bahnhof Attilastraße genannt. Europaweit ist die Symbolkraft von Attila und den Hunnen immer noch lebendig. „Attila the hen“ titulierte der Labour-Abgeordnete Clement Freud, Enkel Sigmund Freuds, die konservative Ministerpräsidentin Margret Thatcher. Aus Sorge um den Verlust der klassischen Bildung in Europa gab der italienische Altphilologe Luca Canali 2009 seinen Essays zur lateinischen Literatur den Titel „Attila aufhalten. Die klassische Tradition als Gegenmittel gegen das Vordringen der Barbarei“.
Am 9. Mai 2015 veröffentliche der Schriftsteller Jean dʼOrmesson im Pariser Le Figaro einen „offenen Brief an den Präsidenten der Republik und an die Attilas des Bildungswesens“, in dem er gegen die Reform der gymnasialen Bildung protestierte, die die Kultusministerin beabsichtigte, „eine Art lächelnder Attila, hinter dem Wiesen historischer Erinnerung nie mehr aufblühen werden“. Ganz anders der amerikanische Bestsellerautor Wess Roberts, der zwei Ratgeber für Manager publizierte: „Victory Secrets of Attila the Hun“ und „Leadership Secrets of Attila the Hun“.
In Ungarn, wo Attila beliebter Vorname ist, sind die Hunnen und ihr König nicht nur literarische Symbole, sondern eine scharfe politische Waffe. Gabór Vona, Vorsitzender der rechtsnationalen Jobbik, begrüßte seine Parteifreunde als Söhne Attilas und schloss: „Vergesst nicht, dass ihr Söhne Attilas seid!“ „Attila“ lautet die Parole gegen Brüssel, die Juden und die Zigeuner. Victor Orbán bekannte 2018 auf einer Konferenz der Präsidenten der Turkstaaten Aserbaidschan, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgistan, Türkei und Usbekistan: Die Ungarn, immerhin ein EU-Mitglied, sind Nachkommen Attilas. Politische und wirtschaftliche Kooperation der Turkstaaten könnten ein Gegengewicht gegenüber der Europäischen Union sein.
Diesen Trend unterstützen Sprachwissenschaftler, für die das Ungarische nicht zur finno-ugrischen Sprachfamilie, sondern zu den uraltaischen oder Turansprachen gehört. Es gibt sogar eine „heilige hunnische Kirche“, für deren Gläubige Attila der Große Schamane und Jesus ein Halbhunne ist. Jeder ungarische Autofahrer verkündet die hunnische Vergangenheit seiner Heimat: Das internationale Kennzeichen H auf seinem Nummernschild geht über das englische Hungary zurück auf das mittelalterliche Hungaria, das Hunnenland.
Weniger Geschichte und Politik als Krawall haben deutsche Fußballhooligans im Sinn, die sich Hunnen nennen. Zum Glück gibt es auch harmlosere Hunnenhorden. 1958 gründete ein Rheinländer die Erste Kölner Hunnenhorde, inspiriert von dem amerikanischen Film „Attila, der Hunnenkönig“. Weitere Hunnenhorden folgten. Sie ziehen im Karneval mit und veranstalten in den Ferien mit Kind und Kegel Hunnenlager. Eine weit sichtbare Banderole über der Hauptstraße in meinem Nachbarort verweist Jahr für Jahr auf ein solches Hunnenlager.
Ich dachte mir, hier könne ich vielleicht Bildung unters Volk und meine Attila-Biographie an den Mann bringen. Zum Glück besuchte ich vorher das Lager. Beim Duft von Grillwürstchen, kreisenden Kölschdosen, lauter Technomusik und der entsprechenden Stimmung wurde mir allerdings rasch klar: Karneval und Wissenschaft passen nun einmal nicht zusammen. Mit dieser Einsicht trollte ich mich, und mit ihr schließe ich auch am heutigen Aschermittwoch meinen Vortrag.