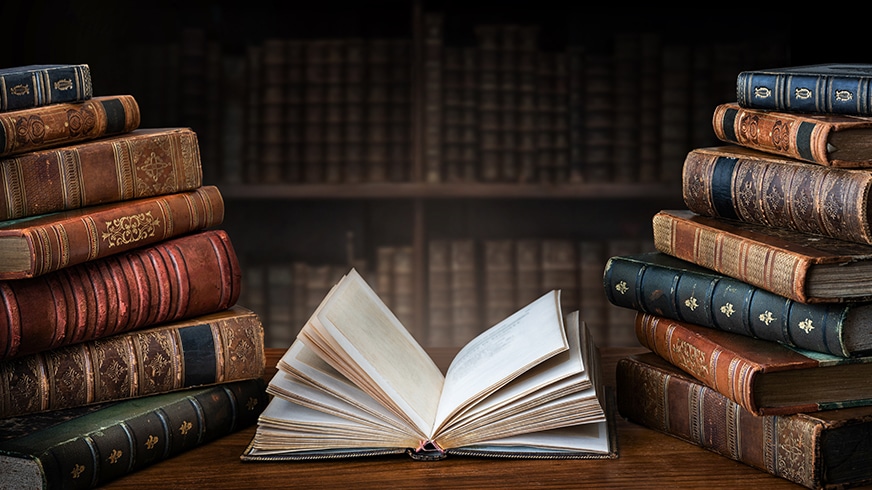I.
Wladimir Uljanow lebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in München, genauer: vom September 1900 bis zum April 1902. Hier schrieb Lenin, wie er sich nun nannte, unter anderem sein Schlüsselwerk „Was tun?“, in dem er seine Lehre von der proletarischen Partei niederlegte. Das „Prinzip der Demokratie“ lehnt Lenin hier bereits vehement ab als „leere und schädliche Spielerei“. Was Lenin dagegen für die entscheidende Aufgabe hält, ist „strengste Konspiration, strengste Auslese der Mitglieder, Ausbildung von Berufsrevolutionären.“ Solche Revolutionäre haben dann auch keine Zeit, an einen „Spielzeugdemokratismus“ zu denken. Dagegen werden sie „zu allem“ bereit sein – „bis hin zur Vorbereitung, der Festsetzung und Durchführung des allgemeinen bewaffneten Volksaufstandes“.
15 Jahre später hat Lenin, mit deutscher Hilfe, die Gelegenheit, seine Prinzipien in die Tat umzusetzen und macht damit Weltgeschichte. Die Russische Oktoberrevolution der Bolschewiki entfacht überall in Europa neue Hoffnungen auf den Frieden. Am äußeren Rand der europäischen Linken wird das Ereignis enthusiastisch als Wendepunkt gefeiert. Und unabhängig davon, wie man im Einzelnen zu Lenin stand, durfte es keinen Zweifel daran geben, dass die Russische Revolution als ein Erfolg zu werten war. Sie hatte das Rad der Weltgeschichte um eine entscheidende Umdrehung weitergerollt, und dementsprechend gebannt verfolgten Freunde wie Gegner der Bolschewiki die Entwicklungen in Russland. Was immer also 1918 und 1919 in Deutschland passiert – die russische Komponente, der Bezug auf Russland ist dabei.
Das gilt auch umgekehrt: Lenin und die russischen Bolschewiki blicken nach Deutschland. Sie erwarten dort die Revolution; denn Deutschland ist hochindustrialisiert und verfügt über die weltweit größte organisierte Arbeiterbewegung. Unzählige russische Sozialisten hatten sich vor 1914 in Deutschland oder im deutschen Sprachraum aufgehalten; manche von ihnen haben sich dauerhaft in Deutschland niedergelassen und die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Jedenfalls gibt es eine Fülle persönlicher Kontakte, Freundschaften, Kooperationen, aber auch Feindschaften.
Die allermeisten Sozialdemokraten lehnen Lenins Parteilehre und damit auch die Oktoberrevolution ab; in der Kultur der deutschen Arbeiterbewegung ist der Gedanke der Demokratie viel zu sehr verankert, als dass man sich mit Lenins Version der einer Parteidiktatur wirklich anfreunden könnte.
II.
Das gilt auch für Kurt Eisner, der am 8. November 1918 in München den Freistaat Bayern ausruft und der jeden Gedanken an „russische Ziele“ zurückweist. Eisner war Mitglied der SPD, dann der USPD. Er war Pazifist und weniger ein Marxist als vielmehr ein neokantianisch geschulter Humanist. Wie auf Reichsebene auch bildete sich in Bayern eine Koalitionsregierung aus Mehrheitssozialdemokraten und Unabhängigen unter dem neuen Ministerpräsidenten Eisner. Die neue Regierung wollte möglichst schnell zu geordneten Verhältnissen übergehen und schrieb daher Wahlen zum Landtag für den 12. Januar 1919 aus.
Von Beginn an war Eisner als Bayerischer Ministerpräsident die Zielscheibe einer ungezügelten nationalistischen und antisemitischen Hetze. Nach seiner Ermordung am 21. Februar 1919 mündet die Revolution in Bayern 1918/19 in eine Geschichte der unaufhaltsamen Radikalisierung, Hysterisierung und Militarisierung. Tatsächlich brodelt es in München nach der Ermordung Eisners immer gefährlicher. Dem sinkenden Einfluss der Mehrheitssozialdemokratie entspricht der kometenhafte Aufstieg der Schwabinger Literatenszene mit anarchistischen Neigungen. Dies ist die kurze Stunde, in der Gustav Landauer, Ernst Toller und Erich Mühsam ins Rampenlicht treten und Anfang April die erste Räterepublik aus der Taufe heben. Der Name Lenin erscheint ihnen, wie Mühsam rückblickend festhält, als Vorbild. Und der erste Aufruf verkündet: „Die Baierische Räterepublik folgt dem Beispiel der russischen und ungarischen Völker.“
Die Münchner Kommunisten bleiben dem zum Teil grotesken Intermezzo der Ersten Räterepublik noch fern. Allzu sehr wollen die Literaten die Wirklichkeit nach ihrer Vorstellung formen. Auch das Proletariat – was immer das genau sein mag – kommt den Kommunisten zu kurz. Am 6. April erklärt Erich Mühsam in einer Mitgliederversammlung der KPD: „Das Programm spielt keine Rolle“. Auf den Einwand, man könne keine Räterepublik vom grünen Tisch, ohne den Auftrag des Proletariats ausrufen, erwidert er: „Wenn ich es für richtig halte, eine Räterepublik zu proklamieren, pfeife ich darauf, ob das Proletariat einverstanden ist oder nicht.“
Als aber die Kommunisten am 13. April die Machtübernahme der zweiten Räteregierung erzwingen, scheint so manchem Bürger München endgültig dem Bolschewismus preisgegeben zu sein. Die örtliche Macht halten aus Russland stammende Kommunisten in den Händen: Eugen Leviné, der freilich längst deutscher Staatsbürger ist, Max Levien und Tobias Axelrod. Unter den Revolutionären genießen sie große Autorität, ja Bewunderung. Ernst Toller berichtet: „Das große Werk der russischen Revolution verleiht jedem dieser Männer magischen Glanz, erfahrene deutsche Kommunisten starren wie geblendet auf sie. Weil Lenin Russe ist, trauen sie ihnen dessen Fähigkeiten zu. Das Wort ‚In Russland haben wir es anders gemacht‘ wirft jeden Beschluss um.“
Umgekehrt provoziert die Rolle, die die „Russen“ spielen, die gegenrevolutionäre Propaganda gegen die „landfremden Elemente“. Dass die drei führenden Russen Juden sind, nährt das antisemitische Propagandaklischee vom angeblich „jüdischen Bolschewismus“. Und in der Stadt selbst wächst die Hoffnung, wie Kardinal Michael von Faulhaber am 22. April 1919 in sein Tagebuch schreibt, „die Weiße Garde werde München bald von den Spartakisten und ihrem russischen Terror erlösen“.
Es ist also eine gespenstische Atmosphäre, die München in diesen Apriltagen umgibt. Deutlich wird die immer stärker werdende Isolation der kommunistischen Räteregierung. Von außen durch die republikanischen Truppen des gewählten Ministerpräsidenten Hoffmann blockiert, droht dem von Eugen Leviné geführten Vollzugsrat die Erdrosselung. Zwar radikalisiert er sich in Wort und Tat und begeistert sich daran, dass in München „die Sonne der Weltrevolution“ aufgegangen sei. „Die proletarische Revolution, so Leviné in einer Rede am 22. April 1919, ist von Osten gekommen. Im Osten ist das Glück, im Osten ist die Sonne aufgegangen. Wir danken unseren russischen Brüdern, die zuerst aufgestanden sind und mit ungeheurer Kraft und mit einem unermesslichen Opfermut das gewaltige Werk auf sich genommen haben, in die Reihen des Kapitalismus vorwärtszustürmen gegen die Feste des Kapitals. Wir sind nachgefolgt und andere werden nachfolgen.“
Aber der größte Teil der Münchner Mittelschichten hält Distanz. Und auch die Bauern verhalten sich keineswegs so, wie Lenin in seiner Münchner Zeit für eine revolutionäre Situation prognostiziert hatte: Sie machen keinerlei Anstalten, sich mit dem Kommunismus zu verbünden, sondern sie boykottieren im Gegenteil die Stadt, was zu deren prekärer Versorgungslage bis hin zur Hungersnot beiträgt.
Am 26. April 1919 kommt es zu einer Spaltung im Vollzugsrat. Gegenüber der Verordnung Axelrods, die Wertsachen der Bankschließfächer zu konfiszieren, weigert sich der „Volksbeauftragte für das Finanzwesen“ Emil Karl Maenner mit der Bemerkung: „Wir machen eine bayerische und nicht eine russische Revolution.“ In dieser Situation erkundigt sich Lenin persönlich per Funkspruch nach dem Stand der Dinge. Zwar hat er dies auch in den vergangenen Wochen regelmäßig getan; jetzt aber, am 27. April 1919, will er es genauer wissen. Scheint nicht aus der Ferne die Situation in München ganz derjenigen in Petrograd im Oktober 1917 zu gleichen?
„Von ganzem Herzen“ begrüßt Lenin die Bayerische Räterepublik; und formuliert dann geradezu stakkatoartig die aus seiner Sicht lebenswichtigen Fragen, die sein eigenes Politikverständnis offenbaren und aus seiner Sicht über Wohl oder Wehe der Revolution entscheiden werden: „Haben Sie Arbeiter- und Gesinderäte in den Stadtteilen geschaffen, die Arbeiter bewaffnet, die Bourgeoisie entwaffnet, […] haben Sie die Fabriken und Reichtümer der Kapitalisten in München […] enteignet, […] den Wohnraum der Bourgeoisie in München beschränkt, um sofort Arbeiter in die Wohnungen der Reichen einzuweisen, alle Banken in Ihre Hände genommen, Geiseln aus der Bourgeoisie festgesetzt, […] und die Arbeiter ausnahmslos sowohl für die Verteidigung als auch für die ideologische Propaganda in den umliegenden Dörfern mobilisiert?“
III.
Eine Antwort auf dieses Telegramm, das am 29. April in deutscher Übersetzung in München vorliegt, kann die Räteregierung nicht mehr formulieren. Am 1. Mai bricht sie unter dem Ansturm von Reichswehreinheiten und Freikorps praktisch widerstandslos zusammen. Einer kurzen Periode kommunistischer Diktatur und kommunistischer Gewalt folgt die Gewalt der Gegenrevolution.
Tatsächlich haben die extreme Polarisierung in Wort und Tat und die Aufschaukelung der Gewalt München für lange Zeit traumatisiert. Die Ermordung Kurt Eisners, die Erschießung der zehn Geiseln im Luitpold-Gymnasium am 30. April, überwiegend Mitglieder der Thule-Gesellschaft, die Hinrichtung Eugen Levinés und Gustav Landauers nach kurzem Prozess und die willkürliche Ermordung von geschätzt bis zu 1000 Menschen durch die Regierungstruppen – das alles war eine schwere Hypothek für München; so wie vergleichbare Vorgänge in Berlin und im Ruhrgebiet eine schwere Hypothek für die Weimarer Republik im ganzen waren.
München verlor seinen Charakter als weltoffene, liberale Künstlerstadt. Vielmehr wurde die sogenannte „Ordnungszelle Bayern“ im Namen von Antibolschewismus und Antisemitismus zum Fluchtort von rechtsextremer Umstürzler und Gewalttäter. Das war dann auch die politische Atmosphäre, in der die frühe NSDAP und ihr Anführer Adolf Hitler reüssierten.
Dass sich aber eine Revolution nach bolschewistischem Muster in Deutschland nicht durchsetzen kann und auch kaum Anhänger hätte, liegt tief in der Struktur der deutschen Politik und Gesellschaft begründet. Das Deutsche Kaiserreich war kein Polizeistaat wie das zaristisches Russland; und die SPD kein politischer Geheimbund wie Bolschewiki, sondern eine offen agierende Massenpartei. Wenn also Lenin einer Anekdote gemäß darauf verwies, die Deutschen könnten keine Revolution machen, so lag dies nicht nur daran, wie er meinte, dass sie keinen Bahnhof besetzen konnten, ohne zuvor eine Bahnsteigkarte gelöst zu haben. Die Gründe lagen tiefer und wurzelten in der im Vergleich zu Russland ganz unterschiedlichen politisch-gesellschaftlichen Tradition und Struktur. Dem entsprach es, dass der Kommunismus nach 1918 in den entwickelten Industriestaaten Zentral- und Westeuropas nicht, wie Lenin fest glaubte, Fuß fassen konnte. Was in Petrograd, in Moskau, schließlich in ganz Russland gelungen ist, wird in Berlin, München, schließlich auch in ganz Deutschland keine Chance haben. Insofern schließt sich der von Lenin beschworene Kreis zwischen Russland und Europa auch in München nicht.