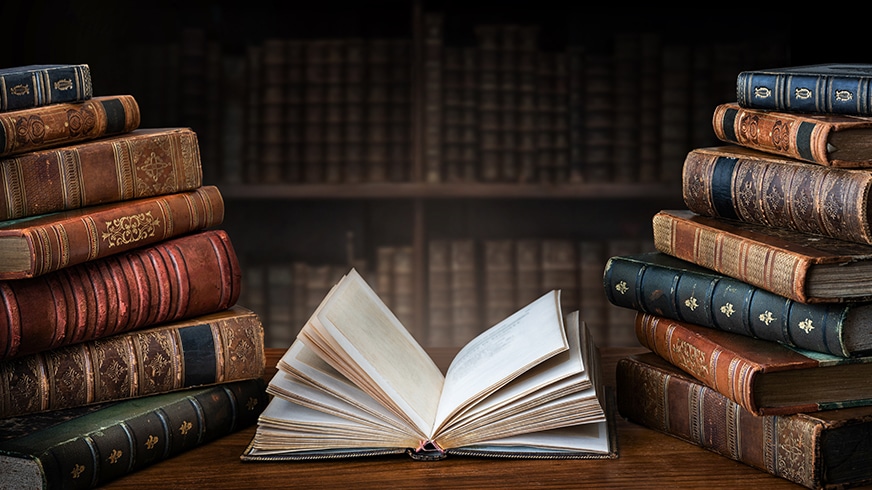I.
Die Anfänge eines Frühen Volkes handeln vor allem von dessen Herkunft und Namen. Wer aber einen Historiker damit befasst, versetzt ihn in größte Verlegenheit. Diesbezüglich befragt, würde er am liebsten wie weiland Ritter Lohengrin den nächsten Schwan nehmen und abreisen. Der Historiker kann nämlich die Frage mit seinem methodischen Instrumentarium und aus Mangel zeitnaher schriftlicher Quellen nicht beantworten; denn Ursprünge und Anfänge werden erst literarisch, wenn man sie braucht und dann viele Generationen weit von ihnen entfernt ist. So muss der Historiker Anleihen bei Archäologie und Linguistik machen. Beide sind aber keine Historien mit anderen Mitteln, sondern haben ihre eigenen Fragestellungen, auf die sie mit eigenen Methoden ihre eigenen Antworten zu finden suchen. Die Zeugnisse der Archäologie und Linguistik sind daher nur mit großer Sorgfalt einer historischen Darstellung einzufügen, um nicht in die Falle der „vermischten Argumentation“ zu tappen, wovor Rolf Hachmann und Volker Bierbrauer so eindringlich gewarnt haben.
Es ist zwar weitgehend anerkannt, dass die Namen der gotisch/gautischen Völker diesseits wie jenseits der Ostsee das Gleiche bedeuten und etwas mit „gießen“, got. giutan, zu tun haben. Fraglich ist jedoch, wer oder was der/die Gießenden waren, ob ethnozentrisch die gotischen Männer, die Samenausgießer, die sich bescheiden als the Menschen verstanden, wie es viele derartige Völkernamen tun. Oder sie waren die Hengste nach einer eponymen Gottheit in Pferdegestalt, von der man allerdings nichts weiß, außer dass übelmeinende Nachbarn sich die Geschichte erzählten, wonach das gesamte Gotenvolk nicht mehr wert sei als ein einziger Gaul. Oder die Goten/Gauten, aktuell Götar trugen ihren Namen nach einem Fluss, wofür in Südschweden der noch aktuell so benannte Göta Älv und auf dem Kontinent der vom Älteren Plinius im 1. Jahrhundert erstmals erwähnte Guthalus = vielleicht Gotenfluss zur Verfügung standen. Dazu gibt es neben den beiden südschwedischen Götaländer auch die nach Goten/Götar benannte Insel Gotland. Anscheinend oder scheinbar eindeutige Sachverhalte. Doch bleiben wir zunächst noch bei der Namensfrage.
Spätestens für die Zeit ab dem Ende des 3. Jahrhunderts spricht man im Deutschen von Westgoten und Ostgoten, meist ohne die damals gültigen Namen zu berücksichtigen. Tatsächlich wird bereits im Frühjahr 291 zum ersten Mal von einer pars Gothorum berichtet, die Terwingen, Waldbewohner, hieß und die westliche Abteilung im heutigen Rumänien bildete. Das östliche ukrainische Gegenstück dazu waren die Greutungen, die Steinbewohner. Beide Ethnonyme waren landschaftsgebundene Exonyme, Fremdbezeichnungen, und verschwanden um 400 mit der Aufgabe der gotischen Sitze nördlich von Donau und Schwarzem Meer. Ihre Namen lebten aber in aufschlussreicher Weise im nordischen Heldenlied fort. Sich selbst bezeichneten die westlichen Goten auch als Vesier, als die Guten/Edlen, die östlichen Goten als die Ostrogothen, als die durch den Sonnenaufgang glänzenden Goten. Die Getica machten im 6. Jahrhundert aus diesem Namenspaar die Vesigothen im Sinne von Westgoten im Gegensatz zu den Ostrogothen, den Ostgoten. Als Selbstbezeichnung überwog jedoch zu dieser Zeit und für die Zukunft bei beiden Völkern stets der einfache Gotenname, wie auch der Wechsel von einem Gotenvolk zum andern jederzeit leicht möglich war.
Was die Herkunft der oder, besser, von Goten betrifft, ist nochmals festzuhalten, dass auf beiden Seiten der Ostsee Völker mit demselben Namen lebten. Ob sie jemals ein Volk gewesen sind, mus skeineswegs gesagt sein. In seiner Marius-Biographie berichtet Plutarch, die Schlacht von Aquae Sextiae 122 v. Chr. sei durch das Aufeinandertreffen der mit dem Teutonen verbündeten, wohl germanischen Ambronen mit den ligurischen Ambronen des Römerheeres eröffnet worden. Beide Ambronenvölker gebrauchten ihren Namen als Schlachtruf, doch wird ihnen keine gemeinsame Abkunft zugesprochen. Dagegen behauptet die gotische Origo eine solche Herkunft für Goten und Gauten. Das heißt, eine schriftliche Quelle, die es trotz ihrer Problematik zu bedenken gilt.
Was ich dazu, meine Damen und Herren, zu sagen habe, ist kein Dogma, sondern offen für jeden Ein- und Widerspruch und lautet ungefähr so: Auf Wunsch Theoderichs des Großen verfasste Cassiodorus Senator eine gotische Herkunftsgeschichte, vollendete sie aber erst 533 nach des Königs Tod wohl in Ravenna und überarbeitete sie um die Jahrhundertmitte im byzantinischen Exil. In Konstantinopel redigierte der anscheinend katholische Mösogote Jordanes das Werk Cassiodors. Er brachte dessen origo actusque Getarum (kurz: Getica) in eine Form, die erhalten blieb, weil sie die historische Entwicklung von um 550 berücksichtigte, während die umfangreichere Vorlage ihre Aktualität verloren hatte und daher verloren ging.
Jordanes änderte aber nichts an Cassiodors Entwurf, wonach die Goten unter König Berig die Insel Skandza, Skandinavien, in drei Schiffen verlassen hatten und an der Gothiscandza, an der heute pommerschen Küste, gelandet seien. Das sei genau im Jahre 1490 vor Christus geschehen. Das heißt noch vor dem Trojanischen Krieg, von dem die Römer ihrerseits ihre Herkunft herleiteten. Von der Gothiscandza seien die Goten nach etwa fünf Generationen in den südosteuropäischen Raum gezogen, wo sie nacheinander drei Wohngebiete besiedelten. Zuerst in Skythien am Asowschen Meer, dann in den Römerprovinzen Moesien, Thrakien und Dacien, das heißt im Getenland, und schließlich wieder in Skythien.
In der ersten Heimat, in Oium, In den saftigen Wiesen, habe noch der Wanderkönig Filimer regiert, der die schamanistischen haliurunnae, die Mütter der Hunnen, aus dem Volk verbannen musste. In die zweite Heimat kamen die Goten, um hier die Geten zu werden. Zurück in der dritten, wieder skythischen Heimat wurden sie klüger und teilten sich in balthische Westgoten und amalische Ostgoten. Aber entscheidend war zunächst ihre Gleichsetzung mit den Geten. Die Geschichte des seit Herodot bekannten Balkanvolkes schloss die der dakischen und skythischen Nachbarn ein und machte die Amazonen zu höchst erfolgreiche gotische Kriegerinnen.
Schon die jüdische Geschichtsschreibung hatte die Endzeitvölker Gog und Magog bei den Skythen gefunden, ein Wissen, das nun ebenfalls auf die Goten übertragen wurde, wobei man die ursprünglich pejorative Bedeutung unterdrückte. Bereits vor Cassiodor hatte ein unbekannter Autor den Japhet-Enkel Ashkenas trotz oder, gerade, wegen seiner biblischen Kinderlosigkeit zum Stammvater der Ascanaci gentes Goticae erklärt und damit die Goten zu den ersten Ashkenasim der Geschichte gemacht. Liutpold Wallach, der bereits 1939 und dann 1963 auf diese Stelle aufmerksam gemacht hat, stellte die Frage, ob nicht Ascanaci auch deswegen gewählt wurde, weil man den Namen etymologisch mit der Insel Scandza verband.
Mit der Verschriftlichung ihrer Herkunft erhielten die Goten eine den antiken Völkern, insbesondere den Römern vergleichbare Geschichte: „Originem Gothicam historiam fecit Romanam“, (=„er machte die gotische Herkunftsgeschichte zur römischen Historie“), läßt Cassiodor den König Athalarich über seine Komposition in Kapitel 40 der Getica von Jordanes sagen. Kein Wunder, dass die ältesten Goten keine Ahnung von einer solchen Herkunft hatten und sich wunderten, als sie Cassiodors römische Gotengeschichte hörend lasen, als sie ihnen vorgetragen wurde, wie der Autor selbst zugeben musste.
II.
Wir Heutigen können die Verwunderung der gotischen Alten verstehen, können aber die getische Geschichte der Goten als unhistorisch bezeichnen, weil wir wissen, dass sie der heute verlorenen Getika des Dion Chrysostomos (gest. vor 120 n. Chr.) entnommen wurde. Aber wir spitzen wie die gotischen Greise die Ohren, wenn mitten im Getenblock die 17gliedrige, inhaltlich wie sprachlich rein gotische Genealogie der Amaler auftaucht. Ein Sieg über die Römer zur Zeit Kaiser Domitians (81-96) – selbstverständlich der getischen Historia entnommen – motivierte die origo Amalorum, den Stammbaum der Amaler, des höchstrangigen gotischen Königsgeschlechts, dem auch der Auftraggeber Theoderich der Große angehörte.
Der Text bezieht sich ausdrücklich auf die mündliche Überlieferung der Goten, die in ipsis fabulis die Amaler als A(n)sen, wie das viel später überlieferte skandinavische Göttergeschlecht hieß, und Halbgötter, als beständige Glücksbringer im Kampf und keineswegs als puri homines priesen. Trotzdem beginnt die origo Amalorum nicht mit dem Heros eponymos, sondern weist Amal bloß den vierten Platz in einer Genealogie zu, die mit zwei oder drei skandinavischen Götternamen beginnt. An der Spitze steht Gaut, der Stammvater vieler Völker auf dem Kontinent, in Britannien und vor allem der skandinavischen Gauten. Einst bekennt Odin, sein „früherer“ Name sei Gautr gewesen, und auch die gotische Überlieferung kennt keinen Odin/Wodan.
Also kamen die Goten doch aus Skandinavien, wie es die Getica ohnehin behaupten? Oder waren es nur die Amaler, die von dort nach Süden aufbrachen? Tatsächlich kannte Ptolemaios um 150 nicht bloß Gutonen an der Weichsel, sondern auch skandinavische Guten, und Prokopios wusste im 6. Jahrhundert von Gauten auf Thule. Die beiden Griechen übertreffend, erwähnt Cassiodor skandinavische Ostrogothen, Gautigothen und andere gotisch-gautische Völker. Liest man aber die Getica-Stellen genauer, könnte man sagen: Die Kunde von ihren skandinavischen Verwandten und ihrer daraus abgeleiteten Herkunft hatten die Goten nicht ein halbes Jahrtausend lang auf ihren Wanderungen mitgeschleppt, was schon deswegen nicht denkbar ist, weil es die Goten als unveränderliches Ethnos nie gab. Vielmehr hatte ein Flüchtling diese Nachricht erst vor kurzem nach Ravenna gebracht. Um 500 verzichtete nämlich ein skandinavisch-gautischer Roduulf auf „sein eigenes Königtum, vertraute sich dem Schutz des Gotenkönigs Theoderich an und fand das Gewünschte (in Ravenna, wie bei einem Stammesverwandten, möchte man hinzufügen)”.
Mit der Nennung Roduulfs schließt Cassiodor den Skandinavien-Block ab; der Autor kennt dafür keine andere Quelle, und zwar ganz im Unterschied zur skythischen Vergangenheit der Goten. Für deren Beglaubigung zitiert Cassiodor die mündlichen Tradition , die prisca carmina pene storico ritu, und die verissima historia des ominösen Ablabius, des descriptor Gothorum gentis egregius, der diese Überlieferung bestätigt. Aus der Erzählung Roduulfs könnte Cassiodor die Herkunft der Goten aus Skandinavien konstruiert und folglich mit einer mythischen Fahrt in drei Schiffen über die Ostsee verbunden haben. Die Dreiheit bedingte der Umstand, daß es für den Autor Ostgoten, Westgoten und die zur Einschiffung fast zu spät gekommenen Gepiden gab.
Von der literarischen Konstruktion abgesehen, ist aber sicher: Es gab Völker in Skandinavien wie auf dem gegenüber liegenden Festland, die ein Gefühl der Zusammengehörigkeit einte, woraus wie im Falle Roduulfs praktisches Handeln wurde. Diese Völker führten denselben Namen, was auch für je einen Fluss nördlich wie südlich der Ostsee zugetroffen haben dürfte. Obwohl Zuwanderungen nicht auszuschließen, ja geschehen sind, denn Roduulf ist sicher zunächst mit dem Schiff und keineswegs ohne Begleitung nach Ravenna gekommen, ist jedenfalls die Annahme falsch, die Goten seien als fertiges Volk von Skandinavien ausgezogen, wie schon Reinhard Wenskus betonte. Dass Königsgeschlechter, wie die Amaler, ihre Herkunft von Skandinavien herleiteten, ist an ihrer Namenstradition als mündliche, von wo immer auch bezogene Überlieferung festzumachen, als Narratio aber das Werk der antiken und frühmittelalterlichen Ethnographie.
Dafür gab es die gute Erklärung, die auch die Getica übernahmen: Skandinavien sei die officina gentium aut certe velut vagina nationum und daher das Auswanderungsland der antiken Ethnographie schlechthin gewesen. Das kalte Klima verlängerte die Fortpflanzungsfähigkeit von Mann und Frau. Die extrem langen und eisigen Winternächte förderten in den zugigen Hütten das Zusammenrücken und begünstigten den phantastischen Fortpflanzungsdrang der Einheimischen, so dass Skandinavien stets unter Übervölkerung litt. Diese Vorstellung ist ein ethnographischer Topos und beruht weder auf historischen Daten noch auf archäologischen Vorgaben, die übrigens keine oder bestenfalls umstrittene Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Festland feststellen (Rolf Hachmann).
Ein weiterer Grund für die Bevorzugung Skandinaviens als Ursprungsland könnte die Ferne der „Insel Scandia“ gewesen sein, vergleichbar mit Abrahams Ur in Chaldäa, das den Juden einen besonderen Stammbaum verschaffte. Vielgliedrige Genealogien schufen Altehrwürdigkeit und damit Vorrang unter den Völkern und Königsgeschlechtern. Sie halfen aber auch im täglichen Leben. Wer die 24 Vorfahren der großen keltischen Heiligen Brigit, die freilich einst eine heidnische Göttin war, aufsagen konnte, war damit vor den Nachstellungen des Teufels, aber auch vor irdischen Feinden für den Tag und die Nacht gefeit. Lange Stammbäume entsprechen dem Konservatismus einer Inselkultur. Dagegen blieben sie auf dem Kontinent nur in geringer Zahl und ohne skandinavischen Bezug zumeist nur in kurzer Form erhalten. Der mächtige Frankenkönig Chlodwig nahm in seiner vorethnographischen Genealogie bereits den vierten Platz ein. Schon sein Urgroßvater war ein halbgöttlicher Stier, erzählte man sich in Kreisen, die den Merowingern eher unfreundlich gesinnt waren. Jedenfalls kann die Antwort auf die gotische Herkunftsfrage nur lauten: skandinavischer Zuzug ist in irgendeiner Form möglich, aber nur für Roduulf nachweisbar.
III.
Damit kann endlich die historische Erzählung die Origo ablösen. Während die Überlieferung in- wie außerhalb der Getica für Skandinavien nur Namen kennt, werden als erstes mögliches gotisches Volk die Gutonen als handelnde Subjekte beschrieben. Zwischen Christi Geburt und der Mitte des 2. Jahrhunderts erwähnen sie je zwei griechische und lateinische Autoren und lokalisieren sie zunächst in Küstennähe zwischen Oder und Weichsel, also noch in, obgleich am Rande der Germania. Zugegeben, die Bezeichnung der Gutonen als gotisches Volk ist keine rein historische, sondern eine linguistisch-archäologische Annahme. Es gibt nicht wenige Archäologen, die die pommersch-westpreußische Wielbark/Willemberg-, die ukrainische Černjachov-und die siebenbürgische Sântana-de-Mureş-Kultur miteinander in Verbindung bringen, sie als gotisch verstehen und somit die Gutonen als Vorgänger der donauländischen und pontischen Goten annehmen. Linguistisch wird argumentiert, dass der Name Gutones die volkssprachliche Eigenbezeichnung Gut enthält, wie vielleicht in Gúthalus, vor allem aber in Gútthiuda = Gotenvolk im Sinne von Gotenland nachweisbar.
Die Gutonen waren ein zeitweise abhängiges und noch um 150 n. Chr. kleines Volk, das Tacitus zu den germanischen Oststämmen zählte. Sie besaßen nach ihm und dem Älteren Plinius Beziehungen zu zwei gentilen Verbänden, zur lugisch-vandalischen Völkergruppe an und östlich der Oder und zu den Markomannen im heutigen Böhmen und Mähren. Gemeinsam mit den Lugiern gerieten die Gutonen am Beginn des 1. Jahrhunderts unter markomannische Oberherrschaft, blieben jedoch am Rande des Einflussgebietes von König Marbod, so dass sich bei ihnen eine Opposition gegen dessen Großreich bilden konnte.
Vom gutonischen Stammesgebiet aus wurde der mächtige Markomannenfürst mit römischer Hilfe im Jahre 18 oder kurz danach gestürzt. Aus der Marbod-Zeit stammen zwei Gegenstände, die das Markomannenland mit dem gutonischen Siedlungsgebiet verbinden. Von den zwei aus derselben römischen Werkstatt importierten, völlig gleichen Bronzekesseln, denen die Produzenten je vier bärtige Germanenköpfe attachiert hatten, wurde der eine im südmährischen Mušov/Muschau, der andere im ostpommerschen Czarnowko/Scharnhorst bei Lębork/Lauenburg gefunden.
Die Gutonen hatten ein für Germanen sehr starkes Königtum. Dieses besaß die Fähigkeit, die Gutonen gefolgschaftlich wie als polyethnisches Volk zu organisieren. Nach der Mitte des 2. Jahrhunderts wurden die Gutonen so mächtig, dass sie sich von Mittelpolen über die Weichsel nach Südosten zum Schwarzen Meer hin ausbreiteten. Die Wanderer lösten eine so große Unruhe aus, dass die Alte Welt von den Markomannenstürmen heimgesucht wurde, und erlebten selbst eine gewaltige Veränderung. Sie vergesellschafteten sich mit finnischen, baltischen, iranisch-sarmatisch und venetischen Völkern. Aus ihnen wurden „Skythen“, die die antiken Autoren als Goten von den Germanen unterschieden.
Nach einigen Jahrzehnten der Konsolidierung begann 238 an der unteren Donau der große Gotenkrieg, der im wesentlichen bis 269/71 dauerte. Zu Lande und bald auch zur See greifen die Goten mit ihren verbündeten Völkern an. Sie plündern, verheeren und suchen dann beutebeladen das Weite. Oft fangen die Römer die Angreifer ab und fügen ihnen schwere bis schwerste Verluste zu; doch sobald die Einbußen behoben waren, sind sie wieder da. Das Land ist zerstört; die Einheimischen, die der Feind nicht getötet oder fortgetrieben hat, fallen nun Hunger und Seuchen zum Opfer.
Aber im römischen Heer, das Kaiser Gordian III. im Jahre 242 gegen die Perser führte, befanden sich germanische und gotische Völker. Man konnte sie offenkundig als Hilfsvölker unter Vertrag nehmen. In den Jahren 250/51 erlitten die Römer eine gewaltige Goteninvasion, die zur Katastrophe von Abrittus führte. Die kappadokischen Vorfahren Wulfilas werden 257 von Donaugoten nach Norddanubien verschleppt. Das katatrophale Ausmaß der Zerstörungen dokumentiert der kanonische Brief, worin Bischof Gregorios Thaumaturgos von Neokaisareia im Pontus Polemiakos die sozialen Verwerferungen anprangert, die die staatlichen Christenverfolgungen und die gotischen Überfälle der Jahre 256 und wohl auch 257 verursachten.
Im Jahre 268 gelingt den gotischen Flotten, denen sich Eruler angeschlossen hatten, der Durchbruch vom Schwaarzen Meer in die Ägäis. Aber nur wenige der Angreifer werden die Heimat wiedersehen. Dazu erleidet ein gotisches Landheer 269 die schwere Niederlage von Naissus, worauf der Sieger Kaiser Claudius II. den Triumphaltitel Gothicus annimmt und die Goten der römischen Welt offiziell bekannt macht. Zwei Jahre später 271 besiegt Kaiser Aurelian die Goten auf ihrem eigenen Territorium nördlich der Donau. Ein ganzes Stammesheer geht zugrunde, angeblich 5000 Mann. Allerdings eine problematische Zahl, weil es so vieler toter Feinde bedurfte, um in Rom einen Triumph zu feiern, wie dies Aurelian tat. Der Gotenkönig fällt, das im Westen dominierende Königtum erlischt, die Goten spalten sich in westliche königlose Terwingen und östliche Greutungen, die das Königtum behalten oder sehr bald mit den Amalern wieder errichten.
Der dürre Bericht über das 3. Jahrhundert entspricht der dürftigen Quellenlage, die noch dazu auf späten, nicht immer verlässlichen Autoren beruht. Der einzige und außerdem höchst kompetente Zeitgenosse der Ereignisse wäre der Grieche Publius Herennius Dexippos gewesen, der in der Mitte der 270er Jahre eine Skythika, vorwiegend eine Gotengeschichte, verfasste, wovon jedoch nur Fragmente erhalten blieben. Ihre Zahl wurde erst jüngst und wird weiterhin durch das Projekt Scythica Vindobonensia vermehrt. Damit ist die Bearbeitung eines griechischen Palimpsests der Wiener Handschriftensammlung gemeint, die Jana Grusková und Gunther Martin so erfolgreich durchführen. Ihnen und ihren Mentoren Otto Kresten und Fritz Mitthof kann nicht genug gedankt werden.
Als die Kollegen vor einiger Zeit den Namen Knivas entdeckten, war zu erwarten, dass dadurch die Geschichte des bloß in den Getica einwandfrei genannten Gotenkönigs erweitert und gesichert würde. Als aber nicht lange danach ein Zeitgenosse Knivas und gotischer Heerführer namens Ostrogotha auftauchte, hatte der ostrogothische Heros eponymos, ansische Amaler und mythische Vorfahre Theoderichs des Großen einen sehr realen historischen Namensvetter erhalten, und zwar einen, auf den der Gotenkönig zu Ravenna wahrlich nicht stolz sein konnte, erinnerte er ihn doch an seinen glücklosen jüngeren Bruder Thiudimund.
Cassiodor kannte Dexippos, zitierte ihn jedoch aus guten Gründen nicht im Zusammenhang mit den römisch-gotischen Kämpfen der Mitte des 3. Jahrhunderts. In der Schlacht von Abrittus beim heutigen bulgarischen Hisarlȃk nahe Razgrad besiegte der Gotenkönig Kniva die beiden Decier, wobei Vater und Sohn den Tod fanden. In den Getica nimmt ein König Ostrogotha an keiner der gotischen Großtaten südlich der Donau teil, sondern Cassiodor macht ihn, den Amaler, zum Vorgänger des nichtamalischen Kniva und läßt ihn, wie zu errechnen, 251, im Jahr von Abrittus, sterben. Der Getica-Ostrogotha hatte über eine gewaltige Streitmacht aus germanisch-sarmatischen Völkern und römischen Überläufern verfügt, richtete jedoch nichts Großartiges aus, so dass man diesen Ostrogotha schon als Beinamen Knivas angesehen oder ihm überhaupt jegliche Historizität abgesprochen hat.
Cassiodor fand jedenfalls in seiner Vorlage Dexippos offenkundig nichts, was für seine Gotengeschichte verwendbar gewesen wäre. Deshalb lässt er Ostrogotha, der eigentlich schon tot ist, auch das Römerreich verlassen. Nach langer erfolgloser Belagerung von Marcianopolis sei Ostrogotha mit seinen Goten, durch Empfang von Lösegeldern „bereichert“, in die Heimat abgezogen, heißt es in den Getica. Die Heimkehr war aber auch höchste Zeit, denn die Gepiden hatten es auf das Lösegeld und die Wohnsitze der Goten abgesehen. Ostrogotha besiegt die Gepiden unter König Fastida und ist scheinbar vor der Geschichte gerettet. Nur dumm, dass sich die gotisch-gepidische Auseinandersetzung 40 Jahre später um 290 ereignet hat, als der Getica-Ostrogotha wahrlich längst schon tot war, und wahrscheinlich im heutigen Siebenbürgen stattfand, wo ein Ostrogotha als König von pontischen Ostrogothen nichts zu suchen hatte.
Aber auch für diese Schwierigkeit weiß Cassiodor Rat: für ihn ist Ostrogotha im Widerspruch zu anderen Stellen der Getica und zur Logik einer ethnischen Namensgebung hier noch der König beider Gotenvölker. Dagegen berichtet eine gute zeitgenössische Quelle zum Frühjahr 291 von Kämpfen der westlichen Goten, der Terwingen, und ihrer taifalischen Verbündeten, mit Gepiden und Vandalen. Es werden aber weder die Namen der beteiligten Heerführer noch die Orte der Auseinandersetzungen genannt.
Anscheinend hatte Cassiodor davon auch andere Nachrichten. Er wusste nämlich, dass der Kampf beim Oppidum Galtis stattfand, und zwar an einem Fluss, der den germanischen Namen Auha/Ache trug. Diese ganze Geschichte stammt aus der Überlieferung der westlichen Goten, wofür auch die Mitwirkung der nördlich der unteren Donau lebenden Taifalen spricht. Weil aber der gotische Anführer anscheinend ebenfalls Ostrogotha hieß, läßt Cassiodor seinen amalischen Ostrogotha auch den Sieg über den Gepidenkönig Fastida feiern
IV.
Die Scythica Vindobonensia zeichnen dagegen ein ganz anderes Bild und bringen Licht in das Chaos von Widersprüchen und Anachronismen.
Es gab tatsächlich einen Zeitgenossen Knivas, der Ostrogotha hieß, nur war er weder ein König noch der Stammvater der Ostrogothen noch ein Angehöriger der Ostrogothen, die es sicher noch nicht gab, noch der Sechste im heroisch-mythischen Stammbaum der Amaler, sondern ein Mann, der „Glanzgote“ oder „Sonnenaufgangsgote“ (vgl. Anatol) hieß und ein durchaus realer Archon von Skythen, das heißt, ein nichtköniglicher Heerführer von Goten war. Kaiser Decius erwartet seinen Angriff; doch brechen hier die neuen Fragmente derzeit noch ab. Knapp vorher hatten diese Fragmente mitgeteilt, dass Ostrogotha auf römischem Boden operierte, und zwar gleichzeitig, aber völlig unabhängig von Basileus Kniva und ohne Erfolg.
Dagegen priesen die Goten Knivas ihren König in Lobliedern wegen glücklicher Siege und im besonderen wegen der Einnahme von Philippopolis im Sommer 250. Ein derartiger Lobpreis war eine hohe Auszeichnung, wie die Getica an mehreren Stellen betonen. Dagegen warfen die Goten der Scythica Vindobonensia ihrem Anführer Ostrogotha Feigheit, μαλακία, und vor allem δυστυχία, Glücklosigkeit, vor. Kein schlimmerer Vorwurf als dieser war denkbar. Glück musste ein König haben, und das Gleiche galt von den nichtköniglichen Anführern und ihren Sippen, die den „Königen an Würde und Glück nicht nachstanden,“ wie ausgerechnet Dexippos wusste. Die Ergebnisse der beiden Palimpsest-Forscher können daher getrost als Sensation gelten, zumal sie Anstoß für eine Sicherung der Autorenschaft der Getica geben dürften.
Cassiodor zählte Ostrogotha zu den amalischen Heroen, die die Goten als nicht gewöhnliche Menschen, sondern als a(n)sische Halbgötter verehrten, „mit deren Art von Glück sie zu siegen pflegten“. Der Heros eponymos Amal „erglänzte“ in einem sicher von Cassiodor entworfenen Amalaswintha-Stammbaum durch sein Glück, felicitate. Ruhmreich setzte die Amalerin die Reihe ihrer königlichen Vorfahren fort, da „unter einer solchen Herrin ….unser (der Goten) Heer die Fremden schreckt“. Soweit der Lobpreis, den Cassiodor der regierenden Königin spendet. Nun aber muss er bei Dexippos von Goten gelesen haben, die demjenigen Ostrogotha, den Cassiodor als amalischen Asen und möglichen Heros eponymos der über Italien herrschenden Ostrogothen stilisierte, Feigheit und Glücklosigkeit vorwarfen, wodurch jede Form von Herrschaft infrage gestellt wird.
So wusste Ammianus Marcellinus, dass die Burgunder eine Mehrzahl von Königen hatten, die den Namen hendinos (recte *kindinōs) trugen. Ein solcher König war für die fortuna belli verantwortlich und wurde „entfernt“, wenn das Kriegsglück ausblieb. Ammianus verwendete das Verbum removeri, was alles von der Absetzung bis zur Tötung des glücklosen Königs bedeuten konnte. Nachdem König Vitigis mit den in Ravenna eingeschlossenen Goten 540 vor Belisar kapituliert hatte, gaben die transpadanischen Goten nicht auf und trugen dem Vitigis-Neffen Uraias das Königtum an. Dieser konnte sich mehrerer Erfolge gegen die Kaiserlichen rühmen und war im Besitz der zweiten gotischen Königsstadt Pavia samt Teilen des Königsschatzes.
Uraias aber lehnte ab, weil, wie die glücklose Kriegführung des Onkels bewies, seiner Familie das nötige Glück, die τύχη, fehle. Den antiken Autoren waren Bedeutung und Wirksamkeit des Glücks jedoch nicht bloß aus der barbarischen, sondern auch aus der eigenen Geschichte vertraut. In Lukans Pharsalia begrüßt Caesar sein Heer mit den Worten: O domitor mundi, rerum fortuna mearum, / miles. „ Oh Ihr Soldaten, Ihr Beherrscher der Welt und das Glück meiner Sache.“ Im 13. Jahrhundert machte der unbekannte isländische Verfasser der Rómverja saga, der Geschichte von den Rommännern, aus diesem Vokativ einen an die Getica erinnernden Instrumentalis und übersetzte: „Höret nun ihr Ritter, die ihr über die weite Erde mit meinem Glück, með minni hamingiu, gesiegt habt.“
V.
Verlauf und Ende des Kriegszugs von 250/51 zeigen die Goten bereits auf einem ersten Höhepunkt ihrer Macht und Ausstrahlungskraft. Kniva erweist sich als Feldherr, der über mehr als bloß primitive Kenntnisse in Taktik und Strategie verfügt. Trotz seines starken Königtums und seiner spektakulären Erfolge ist Kniva jedoch kein monarchischer König aller Goten gewesen. Tatsächlich gab es unter Einschluss Theoderichs des Großen keinen einzigen König von Goten, der der König aller Goten gewesen wäre. Dexippos zeigt sich bestens darin, aber auch über die barbarischen Institutionen insgesamt informiert. Er nennt Ostrogotha einen Archon, einen nichtköniglichen Heerführer, und Kniva einen Basileus, einen Großkönig. Lateinisch gesprochen, war Ostrogotha ein dux, Kniva ein rex; auf gotisch könnten Ostrogotha ein *draúhtins, Kniva noch ein thiudans, wenn nicht schon ein reiks gewesen sein.
Das Wiener Palimpsest bestätigt einen historischen Ostrogotha für die Mitte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts. Es ist nicht unmöglich, dass um 290 ein zweiter historischer Ostrogotha terwingische Krieger gegen Gepiden und Vandalen führte. Wahrscheinlich um seines/ihres Namens willen hat Cassiodor den oder die nichtamalischen Ostrogothae der westlichen Tradition entnommen und daraus einen mythische Amaler, Vorfahren der Könige von Ravenna und Vater der in Italien herrschenden Ostrogothen gemacht.
Das Ethnonym schloss aber keineswegs die Vergabe des Namens als Personenname aus. Die Schwester eines unglücklichen gepidischen Kronprätendenten des 6. Jahrhunderts hieß Ostrogotho, in langobardisch-lateinischer Lautung Austrigusa. Der Name wurde demnach unabhängig von einer ostrogothischen Volkszugehörigkeit an Goten vergeben, und die Gepiden gehörten dazu, wie die Tatsache beweist, dass Austrigusas Bruder der Westgote hieß (Wolfgang Haubrichs).
Dank der Scythica Vindobonensia sind viele beschriebene Seiten, davon auch manche eigenen Makulatur geworden. Handschriften-Archäologie lohnt sich eben, ihren erfolgreichen Adepten gebührt unsere respektvolle Anerkennung. Vivant sequaces!