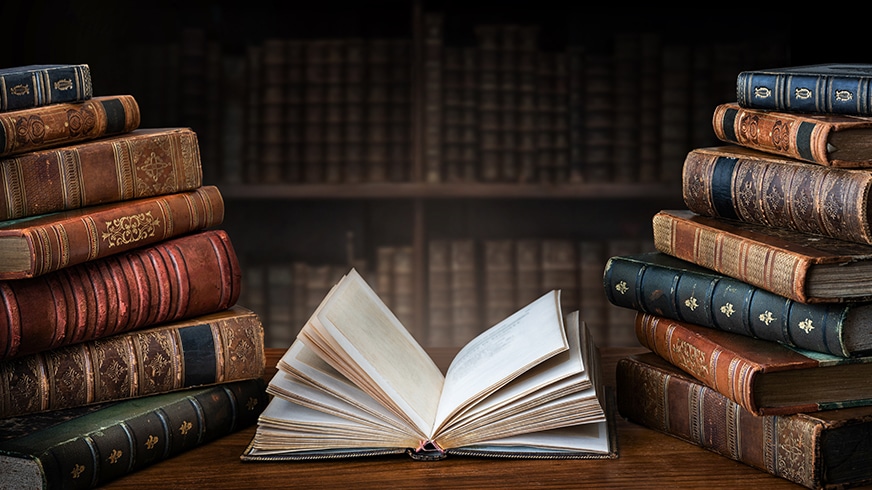Kurzer Überblick
„Wir sind alle ein bisschen Goten.“ Mit diesen Worten meinte die russische Kulturpublizistin Natalja Vanhanen, dass alle europäischen Völker eine „gotische Komponente“ in sich tragen, so weit und breit ist dieses ostgermanische Volk über den alten Kontinent gewandert, so viele Siedlungsgebiete hatte es – von Skandinavien im Norden bis zum Balkan, den Apenninen und den Pyrenäen im Süden, und vom heutigen europäischen Teil Russlands und der Ukraine im Osten bis zur Schweiz, Süddeutschland und Südfrankreich im Westen, und mit so vielen Völkern – germanischen, slawischen, romanischen und finno-ugrischen – hatte es sich über die Jahrhunderte vermischt und somit auf die Ethnogenese diverser europäischer Volksverbände eingewirkt.
Diese genetische Spur und Verbindung ist wichtig. Aber viel wichtiger ist das kulturhistorische Erbe der Goten, von den archäologischen Artefakten und den Architekturdenkmälern bis zu den gotischen Lehnwörtern in fast allen europäischen Sprachen und den gotischen Toponymen, Hydronymen und Eigennamen in nahezu allen Teilen Europas. Auch die gotischen Heiligen in den Kalendern der orthodoxen Kirchen und der katholischen Kirche sprechen von der Bedeutung dieses Volkes in der Christianisierung Europas. Die Sagen und Mythen mehrerer Völker und sogar einige Karnevalsspieltraditionen, noch im 10. Jahrhundert vom byzantinischen Kaiser Konstantin VII. als „gotische Spiele“ beschrieben, sprechen von den Goten. In einigen europäischen Ländern wie Schweden und Spanien ist die „gotische Spur“ bis in die Gegenwart besonders lebendig. So hieß der offizielle Titel der schwedischen Könige bis 1974 „Sveriges, Götes och Vendes konung“ (König der Schweden, Goten und Wenden).
In Spanien betrachtet man das Westgotische Reich vom 5. bis 8. Jahrhundert als den ersten Vorläufer des heutigen spanischen Staates und die Westgoten als dessen Gründungsväter. In den anderen europäischen Ländern, wo sich in der Antike und Spätantike kleinere oder größere Gruppen von Goten angesiedelt haben, verbindet man heute mit den Goten vor allem die Vorstellung von einem archäologischen, kulturhistorischen Erbe, wozu auch Heldenlieder, Legenden und Mythen dieser Nationen gehören.
Gotische Helden und eine gotische Beziehung haben wir nicht nur im Hildebrandslied und im Nibelungenlied – den großen deutschen Heldenliedern – sondern auch in der norwegischen Thidrekssaga. Der legendäre Ostgotenkönig Theoderich der Große, die wohl bedeutendste Herrschergestalt in der gotischen Geschichte, ist hier der Prototyp. Ebenso spielt er als König Amalia eine Rolle als Vorfahre in der Schweizer Sage von Wilhelm Tell. Von gotischen Frauen, „die am Rande des Meeres“ leben, ist im russischen Nationalepos des 12. Jahrhunderts, dem Igorlied, die Rede. Unzählig sind die gotischen Helden in verschiedenen spanischen Heldenliedern, aber auch in der Legendenwelt des benachbarten Portugal.
Die bekannte norwegische Altgermanistin Gerd Høst-Heyerdahl (1915-2007) betont, dass das frühmittelhochdeutsche Annolied vom Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts auch eine Abstammungslinie der Bayern von den Krim- und taurischen Goten sieht. Auch im bekanntesten altenglischen Heldenepos Beowulf um 730, dessen Schauplatz Dänemark und Südskandinavien ist, ist der Hauptheld ein gotischer Fürst. Natürlich haben wir auch die Goten-Saga als eine Art Ur-Epos von den Ursprüngen der Goten aus Skandinavien.
Ich habe meine Ausführungen mit der Sagen- und Mythenwelt der europäischen Völker angefangen, weil sie sehr gut zeigt, wie vielfältig das Gotische in den Vorstellungen, den historisch-legendären Assoziationen, im – immateriellen – Erbe sehr unterschiedlicher europäischer ethnokultureller Traditionen verankert ist. Das europäische Prinzip der „Einheit in der Vielfalt“ ist hier kulturhistorisch bestens dokumentiert, aber auch in allen anderen Aspekten und Formen der Existenz der gotischen Spur in den verschiedenen Teilen Europas.
Als Nachlass der Goten haben wir auch weltbekannte Denkmäler wie das Mausoleum des Theoderich in Ravenna aus dem 6. Jahrhundert, oder die Wulfila- Bibel/Silberbibel/Codex Argenteus, ebenfalls aus dem 6. Jahrhundert, die in der Universitätsbibliothek in Uppsala aufbewahrt wird. Aber noch Dutzende andere gotische Architekturdenkmäler, zerstreut über ganz Europa und besonders in Spanien und Portugal aus dem 6. bis 7. Jahrhundert, und noch etwa ein Dutzend gotischer Schriftdenkmäler: kleinere Fragmente der gotischen Bibelübersetzung Wulfilas, ein Bibelkommentar (skeireins) und seit neuestem auch die (neu)entdeckten gotischen Graffiti auf Kirchensteinen aus der Krim – in gotischer Sprache und mit dem Buchstaben Wulfilas aus dem 9. bis 10. Jahrhundert.
Es gibt Mannigfaltiges von den Goten, sowohl was materielles und immaterielles Erbe betrifft, als auch Eigennamen, Orts- und Gewässernamen, aber auch Wörter für das Religiöse und das Alltägliche. Der in den slawischen Sprachen sehr populäre Eigenname Vladimir hat einen gotischen Ursprung. In seinem 2019 erschienenen Buch „Die Goten und Bulgarien“ hat der bulgarische Archäologe und Historiker Rumen Ivanov herausgefunden, dass zur selben Zeit in zwei entfernten Teilen Europas, in den kleinen Nachfolgestaaten des hispanischen Westgotenreiches im Norden der pyrenäischen Halbinsel, vor allem in Asturien und im Bulgarenreich auf der Balkanhalbinsel im 9./10. Jahrhundert, ohne jegliche bekannte Verbindungen zwischen diesen mittelalterlichen Staaten, drei Könige in Hispanien und ein König sowie ein Thronfolger bei den Bulgaren sehr ähnliche, gotische Namen tragen: Rademirus, Radimiros und Redemiro bei den einen, im Bulgarenreich Radomir als Zar und sein Neffe. Außerdem haben wir bis heute ähnliche Toponyme: Rademirizi in Spanien und Radomirzi und Radomir in Bulgarien! Man interpretiert das Wort etymologisch und leitet es ab von got. raps = schnell, leicht und got. merjan = künden, rühmen also jemand, der durch seine Schnelligkeit, Flinkheit berühmt ist.
Gotische Toponyme und Hydronyme hat man fast überall in Europa: von der Insel Gotland in der Ostsee, die Donau (von got. donawi) bis zur autonomen Provinz Katalonien, früher Gotalanien in Spanien. Es gibt kaum eine europäische Sprache, in der wir nicht gotische Lehnwörter haben. Hier ein bekanntes Beispiel aus dem Polnischen: chvila (= der Augenblick) hat den selben Wortlaut und dieselbe Bedeutung im Gotischen: hveila. Polen ist auch das erste Land, in dem in Pflege und Andenken des gotischen Erbes ein gotisches Dorf als Freilichtmuseum nachgebaut wurde – Wioska Gotow.
Ein anderes bekanntes Wort, das mit gotischer Vermittlung in mehreren romanischen, germanischen und slawischen Sprachen zu finden ist und in Deutsch mit „Botschaft“ übersetzt werden kann, ist „ambasciata“ im Italienischen, gekommen vom Provenzalischen „ambaissat“, was dorthin wiederum vom Gotischen kommt: „andbahti“ (= Amt, Dienst) und „andbahtjan“ (= dienen). Nur eine Auswahl weiterer Sprachen: „ambassade“ im Französischen, „ambassad“ im Schwedischen, „ambassade“ im Norwegischen, schließlich „ambasada“ im Serbischen, Kroatischen und Slowenischen.
Auf der anderen Seite der Skala findet man einen gotischen Einfluss auf der Mikro-Ebene, bei Dialekten, z.B. bei dem bayerisch- österreichischen Dialekt des Deutschen. Auf einige dieser Dialektwörter hat Herwig Wolfram in seinem Vortrag auf dem Jubiläums-Symposium Wulfila 311-2011 in Uppsala hingewiesen: „Dult“ im Bayerischen (Jahrmarkt, Messe) kommt von got. „dulths“ (=Fest). Auch einige Bezeichnungen für Wochentage kommen hier aus dem Gotischen: „arestag-irchtag“ für Dienstag, „pempti hemera-pfinztag“ für Donnerstag.
Aber nicht nur im bayerischen Dialekt, sondern auch in der deutschen Sprache überhaupt gibt es einige Wörter, die vom gotischen abgeleitet oder mit gotischer Vermittlung aus dem Griechischen bzw. Althebräischen gekommen sind. Auch hier sieht man die berühmte Vermittlerrolle der Goten zwischen der antiken Welt und ihrer Sprachen und den neuen, mittelalterlichen Sprachen Europas. Das bekannteste Wort hierfür im Deutschen ist Samstag (ahd. sambaztag – got. sabbato dags – vulgärgr. sambaton -Normalform in gr. sabbaton, ursprünglich abgeleitet vom Hebräischen schabbath „wöchentlicher Ruhetag“). Wir haben im Gotischen auch den Eigennamen Sabigota, mit einer übertragenen Bedeutung wie etwa das „Sonntagskind“ im heutigen Deutsch. Es ist bezeichnend für die Diversität der gotischen Vermittlung, dass in einigen Sprachen der slawischen Welt die Bezeichnung, der Name des Samstags auch vom hebräischen und griechischen über das gotische kommt: „sabota“ im Bulgarischen und „subbota“ im Russischen.
Nun sei hier auch daran erinnert, dass zwei Grundbegriffe des christlichen Glaubens, Engel und Teufel, ebenfalls über gotische Vermittlung in die deutsche Sprache gekommen sind, was unter anderem ein Zeugnis der Bedeutung der gotischen Mission ist: Engel kommt vom althochdeutschen „engil“ und dort wiederum vom gotischen „aggilus“, was wiederum eine Entlehnung aus dem griechischen „angelos“ (Bote) ist. Bei dem Wort Teufel haben wir als Entlehnungskette ahd.“tiufal“ – got. diabaulus – gr. diabolos, wobei die ursprüngliche Bedeutung Verleumder war.
Diese Dichotomie zwischen „Engel“ und „Teufel“ im übertragenen, symbolischen Sinne war über die Jahrhunderte für das Verständnis und die Rezeption der Goten und des Gotischen typisch, bezeichnend, zwischen dem Hochlob und der Verherrlichung einerseits und der Verteufelung und Diffamation andererseits, zwischen Gotizismus und Anti-Gotizismus, eine Ambivalenz par excellence, die man in der einen oder anderen Form bis heute beobachten kann, und die auch zum Teil historisch begründet ist. Die Goten waren zugleich die Zerstörer des (spät)römischen Reiches und die Erbauer, die Begründer der ersten frühmittelalterlichen Staaten und damit Vermittler, auch was das Rechtswesen betraf, zwischen Antike und Mittelalter.
Die erste christliche Mission unter den neuen Völkern Europas, die die Römer und Byzantiner weiterhin als „Barbaren“ bezeichneten, war die gotische, auch wenn sie wegen ihrer halb-arianischen Ausprägung nur eine begrenzte Nachwirkung hatte, und trotzdem durch Wörter in den germanischen und slawischen Bibelübersetzungen in Erinnerung blieb.
Zu erinnern ist auch an die erste anti-jüdische Gesetzgebung Europas, formuliert und durchgesetzt Ende des 7. Jahrhunderts im spanischen Westgotenreich? All das darf nicht vergessen werden. Aber andererseits sind heute der Germanenkult der Nazis und der Gotenkult der Ustascha In Kroatien oder der Falange in Spanien glücklicherweise Vergangenheit. Wie der Chefredakteur des populären deutschen Geschichtsmagazins G/Geschichte Klaus Hillingmeier 2017 schrieb: „Die Tage nationaler Vereinnahmung der Goten sind lange vorbei. Heute unterstreicht die Forschung ihre europäische Dimension.“
Archäologische Spuren der Goten
Hier ist seit den 1970er Jahren und der These von R. Hachmann, die Goten seien gar nicht aus Skandinavien in Richtung Südküste der Ostsee ausgewandert, sondern hätten immer an der Südküste gelebt, die offene Frage, ob dies oder die traditionelle Vorstellung wahr ist, dass die Urheimat der Goten Skandinavien ist. Wie man sieht, sind Thesen und Antithesen zu Herkunft, Identität und historischen Bedeutung der Goten oft zur gleichen Zeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit vorgetragen worden, denn im selben Jahr, als Hachmanns Buch erschien, fand auch ein Goten-Symposium in Stockholm statt, das unter der Koordination von Ulf Erik Hagberg die übliche Vorstellung von der Herkunft der Goten aus dem heutigen Südschweden und der Insel Gotland in der Ostsee bestätigte. Es ist eine Diskussion bis in die heutigen Tage, die aber in ruhiger Manier geführt wird, vor allem, weil die schwedische Wissenschaft nicht mit Aggression auf neue, ungewöhnliche Sichtweisen auf die ursprüngliche gotische Auswanderung reagiert hat, sondern mit großer Geduld und Sachkenntnis.
In dieser Beziehung machte ein Buch des schwedischen Archäologen Anders Kaliff einen Kompromiss-Vorschlag: Aufgrund von historischem Quellenmaterial, von archäologischen, sprachlichen und kulturellen Zeugnissen, stellte er fest, dass die Kontakte und die Migration von Bevölkerungsgruppen im Ostseeraum schon aus früheren Zeiten, Jahrhunderte vor dem Aufkommen der Goten, beiderseits, also von Norden nach Süden und von Süden nach Norden vor sich gingen und daher eine Diskussion im Sinne von „Entweder – Oder – Konstellationen“ im Grunde sinnentleert ist.
Der französische Byzantinist Michael Kazanski findet bestimmte Spezifika des Begräbnisses der Goten, eine Kombination von Steinbox-Urnen mit Überresten von Leichenverbrennung, überall auf dem Wanderweg der Goten von Südnorwegen bis zu den Pyrenäen. Dieselbe Beobachtung macht auch der bekannteste russische Goten-Forscher Mark Shchukin in seinem Buch Der gotische Weg. Skandinavien ist aufgrund der archäologischen Funde klar in die Gesamtsicht über den gotischen Wanderweg durch Europa eingeschlossen. Shchukin meint auch, die materielle Kultur der Goten wurde während ihrer langen Wanderzeit durch die Kontakte mit anderen, auch nicht-germanischen Völkern bereichert – mit den Kelten, mit Rom, mit den baltischen Völkern, mit den Steppenvölkern im Schwarzmeergebiet, dabei vor allem den Sarmaten, und mit den Thrako-Geto-Daken.
Seit dem 4. Jahrhundert sind die bekanntesten archäologischen Indikatoren der gotischen Präsenz im Schwarzmeergebiet, auf dem Balkan, im heutigen Italien, Spanien, Portugal, Südfrankreich, Süddeutschland, Österreich und der Schweiz einige Typen von Fibeln: die sogenannten Bügelfibeln, Kerbschnitt- und Zikaden-Fibeln, in Italien auch die Spangenhelme. Die Adlerfibeln, oft inkrustiert, auch mit Bernstein-Dekoration, sind die beständigen, stabilen Zeichen der gotischen und auch anderer „ur-germanischen“ Präsenz in der Völkerwanderungszeit. Aber auch diese sehr germanischen Attribute wurden von den Steppenvölkern des Ostens übernommen, in der Zeit der Kontakte im nördlichen Schwarzmeergebiet seit dem 3./4. Jahrhundert n. Chr. Daher finden wir sie nicht in den vorherigen Perioden der gotischen Geschichte, als sich diese Stämme in weiten Gebieten um die Ostsee befanden. Das betrifft auch die Adlerkopfschnallen, die man in vergangenen Zeiten auch gern als „urgermanisch“ ansah.
Bernstein, der von der Ostseeküste kam, wurde über die Goten ein beständiger Teil des Schmuckes im spätrömischen Reich. Die Goten kontrollierten auch den Bernsteinhandel in Europa über Jahrhunderte. In der Überlieferung, nicht nur ihrer, sondern auch vieler anderer europäischer Völker blieben sie, verherrlicht oder verdammt, als Krieger, Soldaten und Anführer in Erinnerung. Sie waren aber auch die bekanntesten Juweliere des spätrömischen Reiches und mit den viel zierlicheren und schöneren Fibeln als die klassischen römischen so bestimmend, dass sich bei dieser Omnipräsenz der neuen Mode im 4. bis 7. Jahrhundert im Mittelmeerraum Archäologen oft die Frage stellen: gotisch oder nach gotischer Mode nachgemacht? Und die Frage ist berechtigt, denn so weit, bis etwa nach Nordafrika, konnten die Goten doch nicht gekommen sein. Hier waren aber die Vandalen und ihr Königreich, und andere Ostgermanen wie die Gepiden oder die Heruler haben die gotische Kleidungsmode nachgemacht.
Wenn wir heute über die kulturellen Spuren der Goten sprechen, dann dürfen wir eben nicht vergessen, dass eine der wichtigsten auf dem Gebiet der Mode, des Kleidungsschmucks dieser Epoche lag, aber auch bei anderen, heute würde man sagen, Luxusgegenständen mit sakralem Charakter wie die sogenannten Votiv-Kronen von Guarrazar in Spanien. Andere berühmte Schätze sind der von Domagnano, aufbewahrt in San Marino, ostgotischer Frauenschmuck aus dem 6. Jahrhundert und der gotische Schatz von Pietroasa (4./5. Jahrhundert), aufbewahrt im Nationalen Historischen Museum in Bukarest.
Prinzipiell unterscheidet die Archäologie einige Perioden der gotischen materiellen Kultur, vor allem archäologische Artefakte, die ihre Metamorphosen über die Jahrhunderte und die Gegenden der gotischen Migration und Ansiedlung erfährt.
- Gotische Funde, vor allem Keramik, Fibeln, Gürtelschnallen, aus Südskandinavien und der Insel Gotland. Wie oben dargestellt, wird diese Vorperiode vom ca. 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum 1. Jahrhundert n. Chr nicht von allen Archäologen als gotisch anerkannt. Sie lässt sich als solche aber auch von der „sprachlichen Archäologie“ bestätigen, nicht nur von der Gotensaga über die Urheimat der Goten und den späteren Nacherzählungen von Jordanes oder von Isidor von Sevilla. Von allen gegenwärtigen Sprachen steht das Schwedische der gotischen Sprache am nächsten.
- Die Wielbark-Kultur an der südlichen Ostseeküste und im Gebiet zwischen Elbe und Weichsel/Wisla, im 1. bis 3. Jahrhundert und teilweise später, vor allem auf dem Territorium des heutigen Polen und auch der russischen Enklave von Kaliningrad-Königsberg, einem Teil des ehemaligen Ostpreußens.
- Die Chernyakov-Kultur vom Anfang des 3. bis Anfang des 5. Jahrhunderts. Hierzu werden auch die Gräber von Lučistoe auf der Krim hinzugezählt.
- Die Sintana de Mures-Kultur auf den Gebieten der heutigen Länder Republik Moldau und Rumänien in der zweiten Hälfte des 3. Bis 5. Jahrhunderts. Etwas Typisches für diese Periode ihrer frühen Geschichte sind die „langen Häuser“, oft 21 Meter lang und 11 Meter breit.
- Die römische Periode vom 4. bis 6. Jahrhundert n. Chr., als Ost- und Westgoten neu ins Reich einfielen und auf dessen Territorium ihre Vasallenstaaten gründeten. Die Schmuckfunde aus dieser Zeit zeigen eine noch feinere Kunst.
- Die Funde und Denkmäler aus spätrömisch-gotischer Zeit, vor allem vom Ostgotischen Reich mit seiner Hauptstadt Ravenna im 6. Jahrhundert, und dem Westgotischen Reich mit den Hauptstädten Toulouse/Toledo im 5. bis 8 Jahrhundert n. Chr. Aus dieser Epoche haben wir auch bis heute erhalten gebliebene Architektur: Denkmäler wie das Theoderich-Mausoleum in Ravenna aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. und einige kleine Kirchen aus der westgotischen Zeit in Spanien wie Santa María de Quintanilla de las Viñas in Burgos aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. oder San Pedro de la Nave in Zamora, ebenfalls aus dem 7. Jahrhundert n. Chr.
Die gotischen Schriftdenkmäler
Zum kulturellen Nachlass der Goten gehören ca. ein Dutzend Schriftdenkmäler, manche davon Palimpseste, vor allem aus dem 6. Jahrhundert, die in Bibliotheken und Museen verschiedener europäischer Länder aufbewahrt werden. Das sind Texte in gotischer Sprache, geschrieben mit dem gotischen christlichen Alphabet des Bischofs Wulfila (311-383), der in der römischen Provinz Niedermösien, dem heutigen Nordbulgarien, auch die gotische Bibelübersetzung schuf. Das bedeutendste dieser Denkmäler ist der Codex Argenteus, die Silberbibel, eine Abschrift von Wulfilas Werk aus dem 6. Jahrhundert, die in der Universitätsbibliothek Uppsala gehütet wird. In Deutschland wird in der Bibliothek in Wolfenbüttel der Codex Carolinus, auch aus dem 6. Jahrhundert, aufbewahrt. In deutschem Besitz, im Museum von Speyer, befindet sich auch das Speyer-Blatt, ein Blatt des Codex Argenteus, das erst vor ca. 50 Jahren entdeckt wurde.
Es werden, wenn auch in zeitlichen Abständen, immer wieder gotische Schriftdenkmäler gefunden, wie die Gotica Bononiensia aus dem 6. Jahrhundert, entdeckt 2009 in der Kirche San Petronio in Bologna. Sensationell und unerwartet war die Entdeckung von gotischen Graffito-Inschriften auf Basilika-Steinen von der Krim seit 2014. Inzwischen sprechen Spezialisten sogar von einer Bibliothek auf Steinen, denn es handelt sich um mehrere geritzte Inschriften, die auch ins 9. bis 10. Jahrhundert datiert werden. Die spätesten bis jetzt gefundenen gotischen Schriftdenkmäler sind also ca. 300 bis 400 Jahre später als die in Westeuropa gefundenen Gotica.
Zum christlichen Glauben der Goten: Arianer – Orthodoxe – Katholiken
Lange Zeit herrschte in den wissenschaftlichen Kreisen vor allem des Westens die Vorstellung, die Goten seien nur (Halb-)Arianer gewesen. Hier war die prägende Meinung vor allem von evangelischen Theologen wie Gert Haendler oder Knut Schäferdiek federführend, auch im 20. Jahrhundert. Das entsprach natürlich nicht ganz der Wahrheit. Es gab schon im 4. Jahrhundert auf dem Balkan und der Krim und auch in Konstantinopel orthodoxe Gruppen, und im Westgotenreich nach der Bekehrung zum Katholizismus 589, aber auch kurz zuvor (St. Hermenegild), gotische katholische Christen. Wir haben zum Beispiel 33 gotische Heilige im Kalender der Bulgarischen Orthodoxen Kirche. Ähnlich groß ist die Zahl der gotischen Heiligen auch in den orthodoxen Kirchen Russlands. Hier haben wir zum Beispiel auch den lokalen Heiligen der Krim, den heiligen Johannes von Gotien aus dem 8. Jahrhundert, der den Aufstand gegen die Chasaren-Herrschaft anführte. Er wird auch von der Ukrainischen Orthodoxen Kirche anerkannt.
Weiterhin werden gotische Heilige auch von fast allen anderen orthodoxen Kirchen anerkannt, in Fortführung der byzantinischen Tradition und des byzantinischen Kalenders. Im Serbisch-Orthodoxen Kloster von Visoki Dečani werden ein Teil der Gebeine des im Osten wohl bekanntesten gotischen Heiligen St. Niketas der Gote aufbewahrt. Dieser Heilige aus dem 4. Jahrhundert wird auch St. Nikita Zelebnik (Heiler) genannt, weil er laut Überlieferung bei den verschiedensten Krankheiten effektiv zur Heilung beiträgt. Die Orthodoxen und die katholische Kirche verehren in ihren Kalendern zugleich zwei gotische Heilige, den ersten gotischen Märtyrer und Heiligen St. Sabbas Stratelates am 24. April, dem Tag seines Märtyrertodes in Rom im Jahre 272 mit noch 70 seiner Soldaten auf Befehl des Kaisers Aurelian, als er sich als Präfekt der Prätorianer-Garde des Kaisers weigerte, seinen christlichen Glauben abzulegen.
Der zweite Heilige der Goten sowohl in der Ost- als auch in der Westkirche ist der Heilige Hermenegild, ebenfalls ein Märtyrer des orthodoxen/katholischen Glaubens, ein Königssohn Leowigilds, der sich weigerte, auf Befehl des Vaters den arianischen Glauben anzunehmen und deshalb auch auf dessen Befehl umgebracht wurde. An ihn erinnern der katholische Kalender am 13. April und der orthodoxe am 1. November.
Darüber hinaus hat besonders die katholische Kirche Spaniens mehrere gotische Heilige im Kalender, auch aus der Zeit des Widerstands gegen die muslimisch-arabische Herrschaft besonders im 8./9. Jahrhundert. Aber noch davor, aus dem 7. Jahrhundert, stammt der bekannteste gotische Heilige katholischen Glaubens, St. Ildefonso, der eine besondere Marien-Verehrung einführte und heute Schutzpatron der alten Hauptstadt Toledo ist. Hier, in der Kathedrale der Stadt, wird weiterhin eine katholische Messe in der sogenannten mozarabischen Liturgie gehalten, die auch gotische Elemente enthält, die nach der Bekehrung des Westgotenreiches zum Katholizismus 589 vom alten Glauben in die neue, katholische Liturgie übernommen werden durften.
All diese Ausführungen bedeuten aber nicht, dass man vergessen sollte, dass ein Großteil der Goten (Halb-)Arianer waren, und sich dann in diesen Gemeinschaften auf dem Balkan, in Italien und Südfrankreich neue Ketzerbewegungen, heute würde man sagen, heterodoxe christliche Glaubensvorstellungen, durchsetzten: die Bogomilen auf dem Balkan, die Patarener in Norditalien und die Katharer in Südfrankreich. Das war früher der Weg der gotischen Migration und Ansiedlung in Richtung Westen. In der Nazi-Zeit, aber auch davor und später, wurde der Akzent auf diese eine heterodoxe, arianische Richtung des gotischen Christentums gesetzt, und die anderen orthodoxen und katholischen Dimensionen wurden ignoriert. Himmler wollte ein besonderes, ein „germanisches“ Christentum herbeireden, das sich von allen anderen Christen unterscheiden und fast heidnisch sein sollte.
Unabhängig von diesen nazistischen Übertreibungen hat das westgotische Christentum, und zwar das katholische, im 8. bis 12. Jahrhundert, als das westgotische Reich auf das kleine Asturien im nordöstlichen Pyrenäen-Gebiet zusammenschrumpfte, einen wichtigen Beitrag für Europa und für das europäische Christentum geleistet: die Begründung des ersten christlichen Pilgerweges in Europa, des Jakobsweges, zu den Gebeinen des heiligen Jakobus nach Santiago de Compostela im spanischen Galicien. Es waren westgotische Eremiten, die ihre Einsiedeleien entlang dieses Weges in den Höhlen des Kantabrischen Gebirges gründeten und somit den frühen Pilgern Unterkunft und geistige Unterstützung auf dem langen und mühsamen Weg gewährten.
Ein weniger bekannter, westgotisch-suebischer Heiliger, dessen Gebeine sich ebenfalls in Santiago de Compostela befinden und zur Anziehungskraft des Pilgerortes beitragen, ist St. Fructuosus von Braga, der im 7. Jahrhundert lebte und wirkte. Er gründete insgesamt zehn Klöster und schuf zwei Mönchsordnungen, wobei die eine mit ihrem demokratischen Geist einzigartig ist, weil sie einen Vertrag, „pactum“, zwischen den Mönchen, die in die Klostergemeinschaft eintraten und dem Abt vorsah, mit entsprechenden Pflichten und Rechten – ein Phänomen für die damalige Epoche, das ja eher an die Praktiken in modernen Zeiten erinnert.
Ein anderer westgotischer Mönch, Benedikt von Aniane, schuf im Frankenreich im 9. Jahrhundert ebenfalls eine Mönchsordnung, versuchte eine Klosterreform durchzuführen und gilt neben Benedikt von Nursia als einer der Väter des Benediktinerordens,. Seine Mönchsordnung von 817 hatte eine vorläufige Wirkungskraft für große Teile der katholischen Mönchswelt. Und ein anderer westgotischer Geistlicher im Frankenreich des frühen 9. Jahrhunderts, Theodulf von Orleans, leistete den führenden Beitrag in der endgültigen Formulierung des „filioque“ im Jahre 809, der theologischen Doktrin der westlichen, katholischen Kirche, dass der Heilige Geist nicht nur vom Vater, sondern auch vom Sohn ausgeht. Wir haben zu der gleichen Zeit im Frankenreich einen Erzbischof mit dem gotischen Namen Wulfar (802-816 im Amt), von dem leider nur bekannt ist, dass er der Auftraggeber eines Augustinus-Codex gewesen ist.
Die Nachwirkungen des gotischen Christentums und des hispanischen westgotischen Staates auf die westeuropäische Welt fasste Gert Haendler folgendermaßen zusammen: „Isidor von Sevilla fasste das Wissen der Antike kompendienartig zusammen und übermittelte es so dem frühen Mittelalter. Pirmin gründete 724 das später so berühmte Kloster Reichenau, Theodulf von Orleans verfasste zur Zeit Karls des Großen das umfangreichste theologische Gutachten, Benedikt von Aniane kämpfte unter Ludwig dem Frommen für eine durchgreifende Klosterreform, Erzbischof Abogard von Lyon und Bischof Claudius von Turin kämpften im 9. Jahrhundert gegen den Aberglauben ihrer Zeit“. Es darf auch nicht vergessen werden, dass wir auf dem Stuhl Petri In Rom zwei gotische Päpste hatten: Bonifaz II. (530-532 im Amt) und Pelagius II (579- 590 im Amt), wobei unter dem zweiten die Bekehrung des Westgotenreiches zum katholischen Glauben vielleicht auch deshalb so reibungslos und für beide Seiten zufriedenstellend verlief, weil sie unter Goten selbst vereinbart wurde.
Im Osten, in der orthodoxen Welt, war der Einfluss des gotischen Christentums nicht weniger groß, nicht nur wegen der bedeutenden Zahl gotischer Heiliger in den Kalendern vor allem der slawischen orthodoxen Kirchen, sondern weil hier die direkten Nachfahren von Bischof Wulfilas Kleingoten in Mösien, natürlich nach mehreren Generationen, im 9. Jahrhundert einen inspirierenden Einfluss auf die slawische Bibelübersetzung durch die Slawenapostel Kyrill und Method und die Schaffung des kyrillischen Alphabets durch deren Schüler im Bulgarenreich hatten. Eine vergleichende Analyse zwischen Wulfilas christlichem Alphabet und dem Kyrillischen aus dem 9. Jahrhundert illustriert diesen Einfluss, wobei man natürlich unterstreichen muss, dass für beide Schriftsysteme das griechische Alphabet eine wichtige Grundlage bildete.
Auch in der Vita des heiligen Kyrill, nach dem das slawische Alphabet benannt ist, haben wir einen direkten Hinweis, dass er bei der slawischen Bibelübersetzung im 9. Jahrhundert die gotische Vorlage zumindest als Inspiration und Vergleichsgrundlage für sein Werk hatte. Bei seinem Besuch auf der Krim, heißt es dort, habe er ein Evangelium und auch einen Psalter gefunden, geschrieben mit rossischen Buchstaben, und sich auch mit einem Mann ausgetauscht, der sie lesen konnte. Inzwischen ist klar, dass mit rossisch gotisch gemeint ist, obwohl sich gerade die sowjetische Wissenschaft lange Zeit dagegen wehrte und irgendwelche „ur.slawischen Buchstabenzeichen sehen wollte. Es steht aber fest, dass in baltischen und slawischen Sprachen mit ross die Nordländer – Goten /Wikinger – gemeint sind.
Außerdem haben wir eine zuverlässige Quelle, dass im 9. Jahrhundert im Bulgarenland weiterhin eine gotische Minderheit lebte, die ihre Sprache, Liturgie und Kultur über die Jahrhunderte bewahrt hatte: Der Abt des Klosters Reichenau und als Theologe und Dichter wohl einer der bekanntesten Vertreter der Karolingischen Renaissance, Walahfrid Strabo, schreibt, dass Benediktiner Bulgarien besucht und mit Erstaunen festgestellt hätten, dass hier die deutsche Sprache („lingua tiudisca“) in Bibeln und Liturgien in der Stadt Tomis am Schwarzen Meer, heute Konstanza in Rumänien, weiterlebe. Wir wissen, dass das Goten-Fürstentum auf der Krim erst 1475 unter die Herrschaft der Osmanen fiel, das Bulgarenreich aber schon 1396. In all den Jahrhunderten der Existenz des mittelalterlichen bulgarischen Staates hatte man also einen gotischen Nachbarn, mit Territorial- und Meeresgrenze im Nordosten, auf der Krim. Außerdem gab es im Bulgarenreich selbst vermutlich bis zum 10. Jahrhundert eine gotische Minderheit, wie die norwegische Forscherin Höst-Heyerdahl schreibt.
Die Goten als die älteren Christen im Bulgarenreich hatten natürlich Einfluss auf die neugetauften Slawo-Bulgaren im 9. Jahrhundert. Daher auch die vielen gotischen Wörter in der slawischen Bibelübersetzung und auch die Ähnlichkeit zwischen den beiden Alphabeten. Noch interessanter ist die Parallelität, in gewisser Weise auch die Kontinuität in der Ausstrahlung, in der internationalen Breitenwirkung beider Missionen, der gotischen und der slawischen. Sie gingen vom selben geographischen Gebiet aus, dem heutigen Nordbulgarien, auch wenn dies im 4. Jahrhundert, zur Zeit Wulfilas, Teil des spätrömischen Reiches und im 9. Jahrhundert Kernland des Bulgarenreiches war.
Durch die gotische Mission wurden eine Reihe von ostgermanischen Völkern christianisiert, vor allem die Heruler und Vandalen, aber auch Westgermanen wie die Langobarden. Genauso ging Jahrhunderte später die slawische Mission nach einem Scheitern in Morawien (= Mähren) in Mitteleuropa von Bulgarien aus und führte zur Christianisierung Russlands, Serbiens und der späteren Fürstentümer Walachei und Moldau, die zuerst Teile des Bulgarenreiches waren. Beide Missionen waren auch byzantinisch inspiriert, weil zur Kulturpolitik des spätrömischen/byzantinischen Reiches bezüglich des Christentums die Förderung der Mehrsprachigkeit gehörte.
Bischof Wulfila behielt hier, in der orthodoxen Welt, einen guten Namen wegen der Mission in eigener Sprache für sein Volk. Man glaubte offensichtlich schon damals nicht so sehr, dass er unbedingt Arianer gewesen sei, was auch neueste Forschungen in Frage stellen. Auch wenn man den Gotenbischof nicht zum Heiligen erklärt hatte, schrieb man über ihn mit Worten der Hochachtung und der Würdigung seiner Mission, so zum Beispiel der bedeutendste russische Theologe des 18. Jahrhunderts, der heilige Dmitrij Rostowskij, dessen 12-bändige orthodoxe Enzyklopädie der Heiligen bis heute in Russland immer wieder neu verlegt und gedruckt wird. Er bezeichnete Bischof Wulfila als einen „einsichtsvollen“ und „ehrenwerten“ Mann.
Auch die evangelische, besonders die evangelisch-lutherische Kirche im 19. Jahrhundert schenkte Bischof Wulfila besondere Aufmerksamkeit. Man führte einen Gedenktag für Wulfila ein, den 26. August, den Tag seines Todes 383 in Konstantinopel. Diese Tradition führte man nicht weiter, vor allem, weil die evangelischen Kirchen nicht die Tradition haben, Heilige zu ehren. Durch das Frankfurter Parlament 1848 wurde Wulfila auf Vorschlag von Jacob Grimm als Symbolfigur für ein demokratisches, national gesinntes und gebildetes Deutschland besonders erwähnt.
Auch wenn ich bis jetzt keine schriftlichen Quellen darüber finden konnte, steht ein anderer Beitrag eines evangelischen Kirchenhistorikers aus der ehemaligen DDR, Gert Haendler, außer Zweifel. Er erlaubte sich, in einem Vortrag vor der Lutherakademie in Eisenach 1959, dann in seiner Antrittsvorlesung zur Semestereröffnung der Theologischen Fakultät der Humboldt Universität in Berlin und schließlich in einem kleinen Buch, herausgegeben zuerst in einer winzigen Auflage in Ost-Berlin und 1961 vom Calwer Verlag in Stuttgart, Bischof Wulfilas Leben und Werk mit dem des Heiligen Ambrosius, also eines katholischen Zeitgenossen von ihm, zu vergleichen.
Dabei stellte er fest, dass Wulfila mit seiner Toleranz und Menschenliebe und selbst mit seinen Bearbeitungen der heiligen Schrift (er ließ die Bücher der Könige weg, wie die historischen Quellen berichten, um den kriegerischen Geist seiner Goten nicht noch weiter anzuschüren) dem christlichen Weltverständnis und -empfinden näher steht als Ambrosius: „Wenn wir als evangelische Christen in der Kirche nicht primär eine Organisation sehen, die zu Macht und Einfluss gelangen soll, sondern primär den Ort, an dem das Evangelium verkündet wird und in dem sich Menschen um die Nachfolge Jesu bemühen, dann werden wir in Wulfila eher als in Ambrosius einen Weggenossen für uns sehen können“.
2015 Haendler weiter: „Bischof Wulfila hat mich vor 60 Jahren beeindruckt, weil er als Vertreter einer Minderheit machtlos und manchmal sogar verfolgt an seinem Glauben festhielt und mit seiner Bibelübersetzung sowohl zur Mission wie auch zur Kulturgeschichte beitrug. Für mich hatte Wulfila große Bedeutung für unser Suchen in der DDR nach einer christlichen Lebensführung als Minderheit“. Diese Worte des Doktorvaters des früheren deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck zeigen, dass gerade in Diktaturen solche historischen Leitfiguren wie Wulfila „das Licht der Vergangenheit“ sein können, „das den Weg in die Zukunft leuchtet“, um mit den Worten von Karl Jaspers zu sprechen. Auch solche ungewöhnlichen Nachwirkungen aus den fernen Zeiten der Goten und ihres „Apostels“ sprechen von der Inspirationskraft großer historischer Persönlichkeiten.
Auch wenn manche Worte über den Gotenbischof eher übertrieben klingen mögen, so kann man seine kulturhistorische Bedeutung als verbindende Figur zwischen verschiedensten Nationen und Kulturen nicht absprechen, deren Bedeutung umso stärker hervortreten wird, als nationale Egoismen, Nationaltümelei und Provinzialismus auf der Gegenseite versuchen, Terrain zu gewinnen.
Die Gotik
Die Bezeichnung „Gotik“ und „gotisch“ in der Architektur kam Jahrhunderte später auf, nachdem die Reiche der Goten in Westeuropa untergegangen waren. Ich möchte hier betonen, dass die slawischen Sprachen eindeutig zwischen „gotski“, also mit den Goten selbst verbunden, und „gotičeski“, den späteren Stilrichtungen in verschiedenen Künsten, unterscheiden. Im Deutschen, Englischen, Französischen wie in anderen germanischen und romanischen Sprachen generell benutzt man das gleiche Wort für beides, was zu Verwirrung führen kann. „Gotik“ war ursprünglich von Vertretern der italienischen Renaissance abwertend gemeint, im Sinne von primitiv, barbarisch, eben wie von den Goten kommend, die das Römische, die Romanità, zerstörten. Man behauptet, als erster hätte es Raffael (1483-1520) gerade mit dieser Bedeutung in einem Brief an Papst Leo X. benutzt. Giorgio Vasari (1511-1574), der Begründer der Uffizien in Florenz, nicht nur Maler, sondern auch der erste bedeutende Kunsthistoriker, behauptete aber um 1550 irrtümlicherweise, der Spitzbogen in der Architektur sei ein gotischer Bogen und von den Goten, die Rom eingenommen hatten, erfunden worden. In Wirklichkeit ist der gotische Stil um 1150 In Frankreich entstanden, schreibt der bekannteste Forscher des Gotizismus, J. Svennung, und hat nichts mit den Goten selbst zu tun!
Von nun an begann aber in Bezug auf diesen Begriff dieselbe polarisierte Interpretation und Anwendung zwischen Hochloben und Diffamierung, wie bei den Goten selbst. Zu seiner positiven Umpolung trugen Künstler, Dichter und Denker aus dem europäischen Norden bei, auch prominente Deutsche wie Goethe und Jacob Grimm. Das ging Hand in Hand mit einer kulturellen Rehabilitierung der Goten selbst, besonders in den Zeiten der deutschen Romantik. 1848 publizierte Jacob Grimm nicht nur seine Geschichte der deutschen Sprache, sondern auch ein berühmtes Vorwort zu Ernst Schulzes Gotischem Glossar, wo er einen besonderen Akzent auf die kulturelle Mission Wulfilas setzte.
In der Literatur bekam aber der Begriff gotisch im 18. Jahrhundert in England eine neue, unerwartete Wandlung. Die Gothic Novel war voll von Blut- und Horrorszenen und mittelalterlicher Mystik. Als erstes Werk dieser Stilrichtung gilt der Roman von Horace Walpole The Castle of Otranto (1764). Dieses Genre erlebte seine Blüte bis ca.1820, aber im Englischen blieb seitdem gerade diese Assoziation mit mittelalterlich, dunkel, aber auch ritterlich. So hieß zum Beispiel eine Ausstellung über das englische Mittelalter im Jahr 2003 im renommierten britischen Victoria & Albert Museum in London Gothic: Art for England 1400-1547.
Summary and outlook
Die Goten gründeten die ersten frühmittelalterlichen Reiche Europas als Erben des Imperium Romanum und sind so zu wichtigen Vermittlern zwischen Antike und Mittelalter geworden, Ihre archäologischen, sprachlichen und kulturellen Spuren findet man fast überall in Europa. Die erste Königssalbung fand im Westgotenreich statt. Die Schlacht bei Adrianopel von 378, bei der die Goten das römische Herr vernichtend schlugen und dabei maßgebend eine eigene Reiterei einsetzten, wurde im Mittelalter nicht nur als deren Sieg, sondern als Anfang und Vorbild für das Rittertum betrachtet.
Die christliche Mission der Goten unter Wulfila hatte noch jahrhundertelang Nachwirkungen in Ost und West. Es gab eine Reihe einflussreicher gotischer Geistlicher und Gelehrter in der Karolingischen Renaissance, aber auch einen gotischen Einfluss bei der slawischen Mission im 9. Jahrhundert, und besonders bei der Schaffung des kyrillischen Alphabets, mit dem heute über 200 Millionen Menschen schreiben.
Es gab auch eine direkte gotische Vermittlung bei der Herrscher-Zusammenbringung zwischen Byzanz und dem mittelalterlichen Russland: Konstantin von Mangup, ein Fürst aus dem letzten gotischen Fürstenhaus auf der Krim brachte eine Prinzessin des letzten byzantinischen Herrscherhauses Paleologos, Sophia, nach Moskau, wo sie den russischen Großfürsten Iwan III. heiratete und damit den Anspruch Moskaus, nach Rom und Konstantinopel ein „drittes Rom“ zu sein, auch für die spätere Zaren-Dynastie der Romanovs bis zu deren Sturz durch die Revolution im Jahr 1917 legitimierte.
Die gotischen Heiligen in den Kalendern der katholischen und der orthodoxen Kirchen sind eine weitere, wichtige Spur der Goten im geistigen Leben des heutigen Europa, ebenso wie die Lehnwörter aus dem Gotischen in den unterschiedlichsten europäischen Sprachen, oder die gotischen Orts- und Gewässernamen in Ost und West.
Die Anregung und Etablierung von einem offenen, nationalen und transnationalen, interdisziplinären, multiperspektivischen Informations-, Reflexions- und Interpretations-Kontext über den Nachlass der Goten, im wissenschaftlichen, aber auch im breiteren gesellschaftlichen Diskurs, könnte eine sinnvolle Perspektive für die zukünftige Diskussion über das gemeinsame europäische Kulturerbe sein. Ein wirksamer Beitrag für neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf der Grundlage komparativer Studien und Analysen, aber auch für das europäische Zusammengehörigkeitsempfinden und die gesamteuropäische Identität.