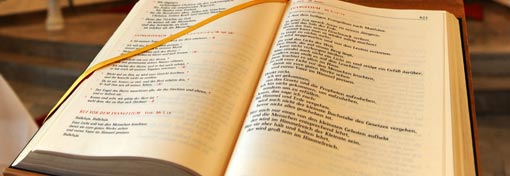Das Evangelium ist kein Buch. Bibelpastorale Aufbrüche, ganzheitliche Ansätze
Mit dem Vorabendgottesdienst beginnt heute am 1. Dezember ein neues Kirchenjahr. Das ist auch der Zeitpunkt, zu dem im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz die neuen Lektionare mit der neuen Einheitsübersetzung aus dem Jahr eingeführt werden. Die künstlerische Gestaltung der neuen Lektionare und ihr besonderes Schriftbild wollen alle, die daraus vorlesen, einladen, die Bibeltexte noch bewusster als mündliche Verkündigung vorzutragen. Welch ein geistlicher Genuss, wenn eine biblische Lesung ansprechend und überzeugend vorgetragen wird! Wie beglückend, wenn die helle Stimme einer selbstbewussten Lektorin in der ersten Lesung der Christmette ankündigt: Dem Volk im Finstern des Todesschattens ist ein Licht aufgestrahlt! Wie niederschmetternd, wenn sich ein Firmling widerwillig durch den Pfingstbericht quält!
Diese Tagung ist Einstimmung in den Advent und Vorbereitung für den Umgang mit dem Wort Gottes im neuen Lesejahr. Die Mündlichkeit (style oral) war das Lebensthema von Marcel Jousse, dessen biografischer und intellektueller Lebensweg uns eben vorgestellt wurde.
Dass unsere heilige Schrift aus mündlicher Überlieferung stammt, dass viele biblische Texte vor ihrer schriftlichen Fixierung eine längere Phase der Mündlichkeit durchlaufen haben, klingt selbstverständlich. Und doch können wir es uns nur schwer vorstellen, denn wir leben in einer Kultur der Schriftlichkeit, auch noch im digitalen Zeitalter.
Viele sprechen heute von den monotheistischen Buchreligionen, oft leider verbunden mit der Frage nach ihrem Gewaltpotential. Aber diese Redensart ist undifferenziert und wenig hilfreich. Denn das Evangelium ist für uns Christen etwas anderes als die Tora für die Juden oder der Koran für die Muslime. Zwar halten auch viele Christen das Evangelium für ein Buch, eine Schrift, einen Text, ein Stück Literatur. Dagegen stellt der Titel dieser Tagung die These: Das Evangelium ist kein Buch, keine Rede, keine Predigt. Es gehört zum Wesen des Evangeliums, dass es nur mündlich genau überliefert und verkündigt werden kann.
Jesus ist kein Schriftsteller, kein Redner, kein Prediger. Wohl ist er ein Dichter, jedenfalls in einem bestimmten, typisch jüdischen Sinn. Seine poetische Kunst ist originell, volkstümlich, wirkungsvoll und ganz auf mündliche Weitergabe angelegt.
Das biblische Jahrhundert
Papst Benedikt XVI. / Joseph Ratzinger ist einer der letzten Überlebenden aus der Generation der großen Theologen des 20. Jahrhunderts. Er äußert die Überzeugung, dass die schönste Frucht aus dieser großartigen Blütezeit der neue Zugang zu den Quellen des Glaubens ist. Keiner früheren Generation stand die Heilige Schrift, die Urkunde unseres Glaubens, so wie uns heute in ungeahntem Umfang offen: Editionen, Übersetzungen, Kommentare, Auslegungen in einer kaum mehr überschaubaren Überfülle. Für viele ist heute die Begegnung mit der Schrift der Einstieg zu einem persönlichen Glauben. Das Lesen der Schrift ist Hören auf das Wort des Gottes, der zu seinem Volk spricht. Kirche entsteht als Gemeinschaft des Hörens auf das Wort Gottes. Man spricht von ekklesialer Mystagogie: Kirche erneuert sich dort, wo dem Umgang mit dem Evangelium Priorität eingeräumt wird. Die Bibel ist die Seele aller geistlichen Reformansätze. Und umgekehrt: Wo man dem Wort Gottes die Chance verweigert, seine befreiende und erneuernde Kraft zu entfalten, bleibt Kirche steril, defensiv, ängstlich, flügellahm.
Das II. Vaticanum hat in der Offenbarungskonstitution – Dei Verbum – den Wert der Heiligen Schrift herausgestellt. Drei Kernaussagen sind:
- Die Heilige Schrift ist die Seele der christlichen Praxis. (21)
- Die Heilige Schrift ist die Seele der Theologie. (24)
- Darum sollen die Gläubigen einen möglichst breiten Zugang zur Bibel haben. (22)
Natürlich steht das Konzil dabei an einer bestimmten Stelle der angedeuteten Entwicklung, keineswegs schon an ihrem Abschluss. In den Jahrzehnten seit dem Konzil hat sich die Landschaft weiter entscheidend verändert.
Auch Marcel Jousse repräsentiert nur eine bestimmte, frühere Epoche der biblischen Erneuerung. Seine fruchtbarste Zeit sind die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen. Damals verfügte man noch nicht über die kritischen Bibelausgaben und über die exegetischen Erkenntnisse unserer Zeit. Die ermutigenden Impulse des Konzils kannte man noch nicht. Auf seine Weise hat Jousse mit seinen philologischen und ethnologischen Forschungen zum Fortschritt beigetragen, indem er viele Plausibilitäten der Exegese seiner Zeit kritisch hinterfragte. Seine ganze Aufmerksamkeit galt der mündlichen Überlieferung, konkret v.a. dem, was zwischen der mündlichen Verkündigung Jesu in Palästina und der Abfassung der Evangelien passiert ist. Das ist ein Zeitraum von fünf oder mehr Jahrzehnten, über den wir nicht umfassend durch schriftliche Quellen informiert sind. Die Brücke von der mündlichen Verkündigung zur schriftlichen Komposition kann man nur durch plausible Hypothesen schlagen. Jousse zieht dafür stärker die Tradition der orientalischen Kirchen heran, weil er überzeugt ist, dass ihre Bibelversionen – unabhängig vom Alter der Handschriften – den Ursprüngen wesentlich näher kommen als westliche Textfassungen.
Die katholische Bibelpastoral hat seit dem Konzil mächtig aufgeholt: Die Liturgiereform hat dem Wort Gottes seinen zentralen Platz im Gottesdienst zurückgegeben. Die bisher allein vorherrschende Vulgata wurde durch eine Vielzahl von Übersetzungen verdrängt. Die Einheitsübersetzung in den neuen Lektionaren ist ein großer Wurf allein schon dadurch, dass mit ihr im deutschen Sprachraum ein einheitlicher Bibeltext im liturgischen Gebrauch ist. Die Texte der Heiligen Schrift werden verbreitet und vertieft. Die exegetische Forschung macht täglich Fortschritte. Alle ökumenischen Bemühungen finden in der Bibel ihren Bezugspunkt. Die Theologie nimmt die Bibel immer stärker zum Ausgangspunkt. Es gibt Bücher, Zeitschriften, katechetisches Material, Internetseiten.
Aber nach diesen großartigen Zwischenergebnissen bleiben Ernüchterungen nicht aus. Heute erlebt die Exegese „eine Periode der Wüste und der Infragestellung“ (D. Marguerat). Viele stürzen sich mit Enthusiasmus in die Bibelpastoral, aber viele geben nach kurzer Zeit auch wieder entmutigt auf; denn letztendlich ist der Umgang mit der Bibel eine komplexe Operation, die eine Reihe Instrumente und eine gute Vorbereitung voraussetzt. Das Bibelrezitativ verspricht eine nachhaltige Alternative.
Marcel Jousse führte seine Studien zu einer Zeit durch, als die Auslegung der Bibel in einem radikalen Änderungsprozess begriffen war; und zu seinen Lebzeiten war nicht absehbar, wohin dieser Prozess führen würde. Wenn man heute Fachexegeten auf seinen Namen anspricht, reagieren sie meist mit Achselzucken. In einigen Fachveröffentlichungen werden seine Werke zwar zitiert, aber in der Breite ist sein Ansatz, der in der Bibelpastoral so fruchtbar eingesetzt wird, wissenschaftlich nicht rezipiert worden.
Für alle, die sich heute mit Jousse beschäftigen, bleibt der Dialog mit den Fachleuten der Bibelkunde ein dringendes Desiderat. Der Rekurs auf den aramäischen Jesus ist bei Jousse nicht wie bei Franz Alt ein Instrument für fundamentale Kirchenkritik. Das Bibelrezitativ gehört auch nicht in die Esoterik. Seine Praxis will sich der fachwissenschaftlichen Kritik stellen. Es will seinerseits einen neuen Zugang zu den biblischen Texten erschließen.
Die christliche Bibelauslegung im Altertum und im Mittelalter folgte der Lehre vom „vierfachen Schriftsinn“. Renaissance und Reformation hatten diese uralte Lehre verworfen und ließen nur den Literalsinn gelten. Sie forderten vehement die Rückkehr zu den Quellen, ad fontes. Luther erhob sola scriptura zum exklusiven Prinzip. In der Aufklärung trennte man den Literalsinn der biblischen Texte vom offenbarenden Wort Gottes und untersuchte den Bibeltext nach philologischen und historischen Methoden, wie man sie aus der Altertumsforschung z.B. zu Werken von Homer kannte. So entwickelte sich vor allem im protestantischen Raum die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung.
Katholischerseits betonte man v.a. seit dem Trienter Konzil, dass das päpstliche und bischöfliche Lehramt für die Erklärung der Bibel maßgeblich sei. Von der historisch-kritischen Zugangsweise befürchtete man eine Infragestellung der lehramtlichen Autorität. 1893 erließ Leo XIII. Normen zum Gebrauch der Heiligen Schrift. Sie waren schon gegen die Inspirationslehre von Alfred Loisy gerichtet. 1902 gründete er die Päpstliche Bibelkommission, praktisch ein Anhängsel des Heiligen Offiziums. Mit Pius X. verschärfte sich der antimodernistische Kurs. 1907 sprach er die entsprechenden Verurteilungen aus; und durch Neubesetzungen wurde in der Bibelkommission eine radikale Richtung durchgesetzt. Den Antimodernismus-Eid mussten seit 1910 alle katholischen Dozenten ablegen, später alle kirchlichen Amtsträger. Er wurde erst 1960 unter Johannes XXIII. abgeschafft. 1909 wurde das Päpstliche Bibelinstitut als Anhängsel der Gregoriana gegründet, dessen erster Rektor Leopold Fonck SJ war. Spätere renommierte Rektoren waren Bea, Martini, Vanhoye und Stock.
Eine vorsichtige Änderung dieses schroffen Kurses bewirkte Pius XI., der selbst als ehemaliger Rhetoriklehrer und Bibliothekar den historischen Forschungen aufgeschlossen gegenüber stand. Er verlieh der Bibelkommission das Promotionsrecht, sah sie also mehr als Forschungsinstitut und weniger als Kontrollinstrument. In diese Zeit fallen der Rom-Besuch und die Papstaudienz von Marcel Jousse, der einige Sonntagsvorträge am päpstlichen Bibelinstitut hielt und dort 1927 seine Forschungsergebnisse vorstellte.
Die Exegese findet damals im Spannungsfeld zwischen katholischen und protestantischen Autoren und zwischen deutschem und französischem Sprachraum statt. Alfred Loisy wurde von seinen Landsleuten als Einfallstor der deutschen protestantischen Exegese in die frankophone katholische Welt angesehen. Jousse erlebte die Zensur und das Lehrverbot von einigen seiner Mitbrüder, darunter Teilhard de Chardin, dessen Rehabilitation jetzt auf der Tagesordnung von Papst Franziskus steht. Jousse betont darum gerne, wenn auch mit ironischem Unterton, er sei Anthropologe und nicht Theologe. So will er seine Lehren aus dem fruchtlosen Modernismus-Streit heraushalten. Er erklärt sich darin gewissermaßen neutral und möchte sich nicht vereinnahmen lassen.
Jousse lässt sich schwer in das Schema konservativ – progressiv – reaktionär – liberal einordnen. In gewisser Weise war er mit seiner Betonung der mündlichen Überlieferung seiner Zeit voraus. Sie war noch ganz fasziniert von den Forschungserfolgen der historisch-kritischen Methode, von den philologischen Errungenschaften der Bibelkritik, von den unaufhaltsamen Verbesserungen des Bibeltextes durch die Handschriftenforschung und von den Kontroversen um Schrift und Überlieferung.
Konservative römische Stellen interessierten sich positiv für Jousse wegen der Betonung der mündlichen Überlieferung. Darin erkannte man eine Affinität zum katholischen Traditionsverständnis. Beim Streitthema „Schrift und Überlieferung“ (um die Materialsuffizienz der Bibel, die das ganze Glaubensgut enthält) gewann man so ein Argument für die katholische Lehre von der unverzichtbaren Bedeutung der Tradition.
Jousse hat sich diese kirchenpolitische Deutung seiner Studien gefallen lassen. Seine Forschungen waren fortschrittlich, seine Geisteshaltung ist konservativ. Er steht in gewisser Weise außerhalb der damaligen Konfrontationen: protestantisch – katholisch, historisch-kritisch – lehramtlich. Auch das ist womöglich ein Grund für die geringe Rezeption, die sein Werk zu Lebzeiten erfahren hat. Erst lange nach seinem Tod 1961 findet sein Werk größere Beachtung, jedoch mehr im bibelpastoralen und praktisch-katechetischen Bereich. Ob einmal eine breitere Rezeption in der Fachexegese kommen wird, ist schwer vorherzusagen. Manche sehen eine Zeit kommen, in der die aramäische Muttersprache Jesu für unser Verständnis seiner Verkündigung aus den Evangelien bis hinein in die Textfassungen und Übersetzungen eine stärkere Rolle spielen wird.
Paradigmenwechsel in der Exegese – Autor, Text, Leser
Marcel Jousse starb am Vorabend des II. Vatikanischen Konzils. Die Entwicklung ist nicht an diesem Punkt stehengeblieben. Die jüngere Geschichte der Exegese hat drei hermeneutische Wenden oder Paradigmenwechsel vollzogen, wobei das jeweils jüngere Modell die älteren nicht überwindet, sondern ergänzt und sie in ein komplexeres Modell einfügt.
Der Autor und seine Aussageabsicht
Zur Zeit des Konzils galt die Aufmerksamkeit der biblischen Forschung noch den Autoren, und das Konzil greift das ausdrücklich auf. In Dei Verbum 12 heißt es: „… mit großer Aufmerksamkeit danach forschen, was die Autoren der Heiligen Schrift wirklich sagen wollten …“. Welche Aussageabsicht hatten die Synoptiker, Paulus, Johannes? Welche literarischen Gattungen haben sie zur Umsetzung ihrer Aussageabsicht verwendet?
Im Hintergrund steht das Verständnis von Hermeneutik bei Schleiermacher und Dilthey: Einen Text verstehen heißt, in die Geisteswelt des Autors eindringen und den geistigen Horizont des Lesers mit dem des Autors verschmelzen. Der kompetente Leser ist derjenige, der sich mit dem, was der Autor bei der Abfassung des Textes gedacht, gemeint, empfunden hat, identifizieren und es wiedergeben kann.
Die Aussageabsicht lässt die Dialektik von explizit Gesagtem und implizit Gemeintem mitschwingen. Ein Text bedeutet immer mehr, als er sagt. Der Sinn überragt den Wortlaut. Man hält fest an einem Ideal der Objektivität und der Genauigkeit. Man stellt es sich so vor, dass der Autor sein Denken in einem Text objektiviert und dass dessen Sinn bestimmt, unwandelbar und fix ist. Der Leser erreicht den objektiven Sinn umso besser, je mehr er sich in die Aussageabsicht des Autors hinein versetzt. Die exegetischen Fachleute üben ein Wächteramt aus: Sie wachen mit kritischem Bewusstsein darüber, dass kein inkompetenter Leser mit seiner abweichenden Subjektivität diesen einen Sinn verunklärt. Letztlich liegt der Sinn nicht im Text selbst, sondern er liegt ihm voraus.
Das Erklärungsmuster der Aussageabsicht stößt aber irgendwann an Grenzen. Dagegen steht schon die pure Tatsache, dass der Text selbst Offenbarungsqualität hat. Die unparteiliche Objektivität des einen eindeutigen Sinnes ist eine Fiktion ohne Realitätsgehalt. Die neuen Theorien über Narrativität führen die Vorstellung eines Autors mit einer klaren Aussageabsicht ad absurdum. Der Text enthält viel an Instinkt, Sehnsucht, Fantasie, Unbewusstem des Autors jenseits seiner bewussten Absicht.
Der Text und seine Struktur
In einer zweiten Phase wendet sich die Exegese daher dem Text selbst zu. Egal wer ihn wann mit welcher Absicht verfasst hat: Der Text hat in sich eine Struktur und einen Sinn. Es interessiert nicht die Diachronie, die Fragen wie ein Text im Lauf mehrerer Redaktionsschichten entstand, sondern die Synchronie: Der aktuell maßgebliche kanonische Text ist eine Ganzheit, eine von seinem Autor unabhängige Wirklichkeit, ein organisches System von verbalen und non-verbalen Bedeutungsträgern. Er hat eine Mikrostruktur seiner einzelnen Teile und eine Makrostruktur als Einheit und Ganzheit. Die Konzentration auf den Text selbst ist eine immanente Methode. Alle Elemente außerhalb des Textes selbst, sogar sein Autor, verlieren an Bedeutung. Alle außersprachlichen Elemente werden eliminiert. Interessant sind nur die innertextlichen Beziehungen. Der Sinn des Textes ergibt sich als Wirkung aus dem Spiel dieser Beziehungen.
Der Leser und die Praxis
Die dritte und bisher letzte Phase der Bibelhermeneutik lenkt den Blick weg von Autor und Text hin auf den Leser und auf die Praxis des Hörens und Lesens. Der Rezeptionsprozess gehört zur Geschichte des Textes selbst. Ein Text, der nicht gehört und gelesen wird, ist kein Text. Der Text selbst erfordert, dass er einen Hörer und Leser findet. Er wartet auf ihn und stellt über ihn Hypothesen an. Er lenkt ihn und lässt ihm Freiräume für sein eigenes Verstehen. Der Text ist unvollständig, wenn ihn keiner liest und versteht. Ein Leser schließt im Akt des Lesens eine Art Pakt mit dem Text. Indem er den Text versteht, versteht der Leser in erster Linie sich selbst. Er erkennt sich selbst mit seinen Fragen, Themen und Vorlieben im Text wieder. Der Text ist ihm existentiell nicht fremd. Indem ich einen Text höre oder lese, springe ich in mein Inneres hinein und entziffere mich selbst. Ich setze mich dem Text aus und empfange mich von ihm bereichert und erneuert zurück. Dieses Verständnis von Hermeneutik findet sich z.B. bei Paul Ricoeur. Was von der Lektüre allgemein gilt, das gilt insbesondere von der Lektüre der Bibel. Die Bibel zu lesen wird fruchtbar in dem Maß, wie ich mich selbst ihr aussetze, wie ich selbst das Risiko eingehe, das diese Lektüre beinhaltet, wie ich mich verwundbar mache durch die Worte, denen ich begegne.
Die drei skizzierten Phasen der biblischen Hermeneutik waren Jousse noch nicht reflexiv bewusst; aber mit Theorie und Praxis des Bibelrezitativs hat er die Aufmerksamkeit schon stärker vom Autor auf den Text und auf den Hörer oder Leser gelenkt.
Mündliche und schriftliche Kultur – Merkmale, Zusammenhänge, Unterschiede
Die Rückkehr zum Evangelium ist immer der (einzige) Weg für die Reform der Kirche. So war es bei Franz von Assisi, bei Luther, beim II. Vatikanischen Konzil, so ist es bei Papst Franziskus.
Die Rückkehr zum Evangelium war auch das Lebensthema von Jousse. Er rekurriert dazu auf die allgemein geltenden anthropologischen Gesetze. Er erforscht, wie Menschen sich ausdrücken. Diese Gesetze liegen fest. Sie lassen sich nicht verändern. Sie sind im digitalen Zeitalter dieselben wie zu Zeiten der Bibel. Jousse spricht vom Evangelium meist mit dem aramäischen Terminus Peshitta. Gemeint ist das Evangelium Jesu jenseits des geschriebenen Textes, das Evangelium in seiner Ursprünglichkeit, in seinem genuinen Anfang beim Lehrer Jesus selbst. Mündliche Überlieferung ist ein gestisches Geschehen zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Rabbi und Jünger. Vorausgesetzt ist eine Kultur der Erinnerung und der mündlichen Verkündigung.
Die Art von Marcel Jousse, das Evangelium zu lernen und zu lehren, steht in der Tradition Israels seit 3000 Jahren. Diese Art der mündlichen Überlieferung trennt uns Christen nicht von Juden und Muslimen, sondern sie verbindet uns mit ihnen. Sie gibt Jesus seinen Platz in der Geschichte seines Volkes zurück.
Worte sind wie Perlen. Man kann eine Handvoll davon in Händen halten. Besser ist, sie an einer Kette aufzureihen. Im Hebräischen sind sefer (Buch) und seder (Ordnung, Reihenfolge) oft in eins gesetzt. Ein Buch ist wie die Schnur, auf der die Wörter wie Perlen aufgereiht sind, eine Halskette aus Rezitativen. Jetzt kann ich mit einer Fingerspitze mehr Perlen sicher hoch halten, als ich in der Faust unsicher hätte halten können. Indigene Völker, kleine Kinder, rurale Kulturen, wie die in Jousse’s Heimatregion Sarthe, besitzen noch mimische Spontaneität. Wir Menschen der Schriftkultur haben sie verloren; wir müssen solche Gesten wieder neu lernen.
Wenn wir die mündliche Verkündigung Jesu Katechese nennen, dann ist der Sinn von Katechese zu präzisieren. Katechismen sind heute eher eingeschmolzene Theologien, Dogmatik-Handbücher en miniature. Der ursprüngliche Sinn ist ein anderer: Katechese geschieht in der Übertragung von der Mutter auf das Kind. Ein Kind lernt das Glauben so, wie es das Sprechen lernt: durch Echo, Nachahmung, Nachsprechen, Verinnerlichen.
Jesus ist kein Akademiker. Er hat nie eine höhere Schulbildung bekommen. Trotzdem begegnet uns Jesus als exzellent gebildete Persönlichkeit, mit einer Bildung ganz eigener Prägung. Jesus ist auch kein Autodidakt. Jesus steht ganz selbstverständlich in der jahrhundertealten Lerntradition seines Volkes. Er ist ein besonders aufmerksamer und begabter Schüler seines Lehrers Johannes. Er ist auch ein kritischer Schüler, der die Botschaft des Johannes weiterdenkt und vom Kopf auf die Füße stellt.
Marcel Jousse experimentiert viel mit aramäisch versetzten Wiedergaben und grafischen Darstellungen des Bibeltextes; aber er glaubte nicht, schon eine gültige Übersetzung der Worte Jesu geschaffen zu haben. Er rechnete damit höchstens für eine ferne Zukunft. Er verstand seine Übersetzungsvorschläge als Provisorien, als vorläufige Verstehenshilfen, zugespitzt auf den Punkt, auf den es ihm ankam, auf den Aspekt der Mündlichkeit.
Die moderne neurologische Forschung bestätigt viele Intuitionen von Jousse. Die Entdeckung der Spiegelneuronen verweist auf die neuronalen Verbindungen zwischen den sinnlichen Wahrnehmungszentren und den Bewegungszentren, die die Gesten unseres körperlichen Ausdrucks bestimmen. Wir schauen einer Tänzerin bei ihren Bewegungen oder einem Handwerker bei seinen Vollzügen zu; ansatzweise verspüren wir den Impuls, ihre Bewegungen mit den Muskeln unseres Körpers nachzuahmen. Das ist der Mimismus, von dem Jousse spricht. Der Mensch lernt durch mimische Wiederholung.
Als Erwachsene unterdrücken wir die Ausführung der mimischen Wiederholung; übrig bleibt nur eine initiale Mikro-Bewegung, ohne dass der ganze Gestus ausgeführt wird. Die vielen passiven Stunden vor Bildschirmen und Displays ersticken dann oft auch noch die initiale mimische Wiederholung. Die Aneignung durch Wiederholung wird durch eine Überfülle an Bildern und Informationen überflutet und erstickt. Wir sind dauernd in eine Welt eingetaucht, die uns von anderen vorfabriziert wird und in der wir nicht selbst aktiv sind. Bildschirme und Displays sind falsche Gesprächspartner. Sie sprechen nie cor ad cor. Das wahre Leben spielt sich in den mündlichen Beziehungen der Menschen ab.
Im Neuen Testament, z.B. in den Briefen, gibt es sicher schon ursprünglich schriftlich abgefasste Texte; wesentliche Teile daraus sind aber im mündlichen Stil verfasst oder aber sie stammen zumindest von Autoren wie z. B. Lukas, die damit vertraut waren und die diesen Stil perfekt imitieren. Für Menschen im Mittelmeerraum war es normal, mehrere Sprachen gleich gut zu sprechen, virtuos zwischen Hebräisch, Aramäisch, Griechisch und Lateinisch zu wechseln. Das gilt nicht nur für die gebildete Oberschicht, sondern für die breite Masse der Bevölkerung. Ein Wanderhandwerker wie Josef von Nazareth und seine Familie waren in diesen verschiedenen Sprachen beheimatet. Jesus selbst hat durchgängig seine Muttersprache Aramäisch gesprochen; aber vermutlich sind Teile seiner Verkündigung auch auf Griechisch, man denkt an die Gespräche mit Pilatus oder mit der Syrophönizierin, oder auf Hebräisch, z.B. die Abendmahlsworte, gesprochen.
Die griechische Fassung der Worte Jesu in den Evangelien ist literarische Nachbildung seiner mündlichen Verkündigung. Das Griechische liegt wie ein durchsichtiger Schleier über dem alten Text. Die hebräischen und aramäischen Denk- und Sprachformen schimmern darunter hindurch. Die semitischen Rhythmen und Denkgewohnheiten, die Sprechgewohnheiten der Schriftgelehrten Israels geben mehr den Ton an als der hellenistische Sprachrhythmus.
Mündliche Kultur unterliegt einer gravierenden Einschränkung: Klang kann man nicht konservieren, oder jedenfalls nur sehr unvollkommen und erst seit kurzer Zeit. Man kann Töne höchstens aus der Erinnerung herbeirufen, nicht aber nachweisen oder nachschlagen. Orale Kultur ist gebunden an Klänge und Töne als einziges Substrat aller Sprache. In einer mündlichen Kultur funktionieren Soziodynamik und Psychodynamik nach eigenen Gesetzen, ganz anderen als denen der Schriftkultur. Das Gedächtnis des Menschen ist anfällig und verletzlich. Als Gegenmittel helfen nur ständige Rezitation und Wiederholung der Texte, rhythmische Atemtechnik, Rituale und Feste. Das orale Gedächtnis ist intensiv, aber kurz. Man sagt, der Klang schwingt mir im Ohr, oder das Wort liegt mir auf der Zunge. Das schriftliche Gedächtnis dagegen ist lang, aber schwach: „Das hab ich doch irgendwo schon mal gelesen.“
Mündliche Überlieferung kann man nur durch Auswendiglernen einigermaßen zuverlässig bewahren. Die Jünger heißen Lehrlinge; sie müssen das vom Rabbi Vorgetragene auswendig lernen. Sie sind ständige Hörer seiner ständig wiederholten Verkündigung. Zwischen den Lehrstücken stehen dauernd Aufrufe an die Hörer, die Ohren zu spitzen, gut zuzuhören, sich zu konzentrieren, sich nicht ablenken zu lassen, nicht vergesslich zu sein und die Worte im Herzen zu bewahren. Es gibt ausdrückliches Lob für den „Jünger, den Jesus liebte“, nicht aufgrund irgendwelcher Gefühle zwischen ihm und dem Meister, sondern weil er die Worte Jesu mit besonderer Konzentration und Aufmerksamkeit verinnerlichte und zuverlässig weitergab.
Die Bildung der mündlichen Überlieferung hängt mit der Aussendung der Jünger zusammen: Jesus schickt die Jünger in alle Himmelsrichtungen, in alle Dörfer, Gehöfte und Städte, um ihn in seiner Verkündigung zu unterstützen. Sie sind Apostel, Gesandte ihres Meisters, und geben seine Botschaft in Form der Lehrsummarien weiter, die sie sich als seine ständigen Begleiter durch häufige Wiederholung eingeprägt haben. Nachdem die Mehrheit der Bevölkerung aber die Verkündigung Jesu und seiner Jünger, den Ruf zur Umkehr, ablehnte, zog sich Jesus in den Kreis der engsten Jünger zurück und beschränkte sich auf deren Unterweisung. Die Zwölfergruppe wurde so zum wichtigsten Garanten für die Kontinuität der mündlichen Überlieferung.
Aber auch die ortsfesten Jünger, die nicht auf Mission auszogen und die räumlich von Jesus getrennt waren, brauchten geprägte Traditionen. Darunter waren auch schon zu Lebzeiten Jesu Vertreter der gebildeten Oberschicht. Vermutlich wurden Jesusworte zum ersten Mal in solchen Kreisen aufgeschrieben, also in größtmöglicher Nähe zu seinem oralen Stil.
Die Kenntnis von Marcel Jousse ist heute im französischen Sprachraum wieder verbreitet. Es gibt Rezeption in Schweden, USA, im italienischen und spanischen Sprachraum. Im deutschen Sprachraum gibt es das Übergewicht der protestantischen Bibelkultur, die eine eminent literarische, auf die Schriftlichkeit fixierte ist; Jousse fand bisher so gut wie keine Beachtung. Clara Vasseur hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Jousse und sein Werk bei uns bekannt zu machen.
Für alle, die sich heute mit Jousse beschäftigen, bleiben drei Desiderate:
- die Erarbeitung und Einübung von Bibelrezitativen im Geiste von Marcel Jousse,
- ein Anschluss an die philosophische Debatte im Deutungshorizont der Phänomenologie, um die leibliche Dimension der Jousse’schen Bibellektüre zu verorten,
- als Fernziel eine Übersetzung der Evangelien aus der mündlichen Überlieferung.