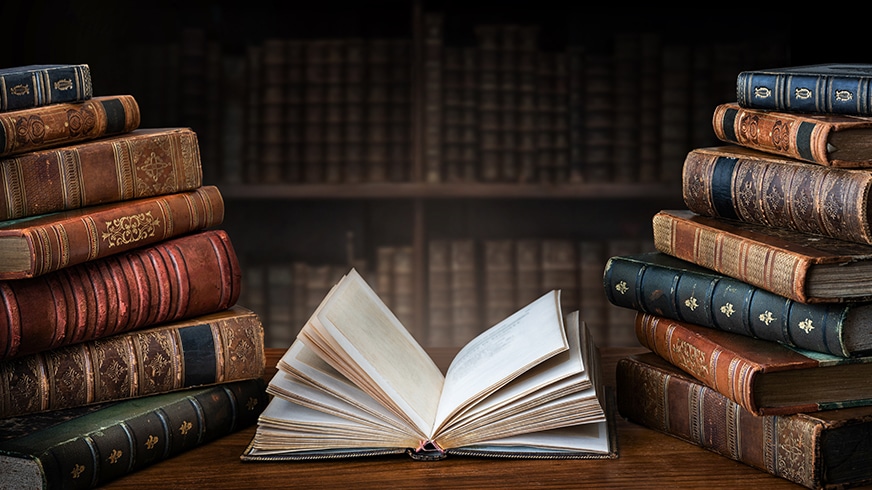I.
Das Erscheinen der Hunnen um 375 im nördlichen Schwarzmeerraum brachte die bisherige politische und soziale Ordnung nördlich von der Donau aus dem Gleichgewicht. Der Historiker Ammianus Marcellinus berichtet über die Panik, die sich damals unter den Goten ausbreitete. Bei den Goten habe sich das Gerücht verbreitet, dass das vorher noch nie gesehenes Menschengeschlecht, d.h. die Hunnen, das sich wie ein Sturmwind von hohen Bergen aus einem abgelegenen Winkel aufgemacht habe, jeden Widerstand breche und in Trümmer lege. Nach einem misslungenem Versuch, den Hunnen Widerstand zu leisten, kam es bei den Tervingen zu Teilungen und die Mehrheit der Ethnie ließ ihren bisherigen Herrscher Athanarich im Stich und wanderte unter der Führung von Alaviv und Fritigern nach Süden, um neue Wohnsitze zu finden. Darüber hinaus wanderten – ebenfalls nach Süden – auch die Greutungen unter Alatheus und Safrax, die inzwischen sogar Gruppierungen der Hunnen und Alanen für sich gewonnen hatten.
Im Jahr 376 sammelten sich Tausende von Flüchtlingen am Donauufer. Infolge der durch den Angriff der Hunnen hervorgerufenen Verwirrung und der daraus resultierenden Migrationen entstand eine Situation, die für die Römer ziemlich neu war. An der römischen Grenze standen Tausende potentielle Immigranten, und nicht Invasoren, die nur an Beute und Plünderung dächten. Sie wollten vor den Hunnen fliehen und erhofften sich Sicherheit jenseits der Donau. Man sollte dabei auch die wirtschaftlichen Folgen der Migrationen nördlich der Donau in Betracht ziehen. Es geht vor allem um die Störung des labilen Gleichgewichts im Bereich der Nahrungsmittelversorgung. Die Nahrungsmittel, die die Tervingen ja immer durch den Handel mit den Römern ergänzen mussten, wie der Mangel infolge des Embargos in den Jahren 367-369 dies gezeigt hatte, waren nun nicht ausreichend für die wandernden Barbarenmassen.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen die Donauufer im Jahr 376 belagerten. Die Quellen berichten übereinstimmend über eine große Masse von Barbaren. Nur Eunapios von Sardes gibt eine präzise Zahl an und spricht über fast 200.000 Kriegern. Obwohl diese Angabe zu bezweifeln ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich nicht nur auf die wehrfähigen Männer beziehen könnte, sondern auf die gesamte Masse der Tervingen. Es ist aber klar, dass es so viele potentielle Immigranten gab, dass die gesamte Situation eine ganz neue und überraschende Herausforderung für die oströmische Regierung darstellte.
Die Lebensmittel jenseits der Donau gingen schnell zu Ende, wie dies Ammian bezeugt, der berichtet, dass der größte Teil der Tervingen infolge des Mangels an Lebensmitteln stark geschwächt gewesen sei und deswegen Athanarich im Stich gelassen habe. Laut Ammian hielten die nach einem Ausweg aus ihrer schwierigen Situation suchenden Tervingen Thrakien für besonders attraktiv, denn es habe sehr fruchtbaren Boden gehabt und sei durch die Weite der Donauströmung von den Gebieten getrennt worden, in denen die Hunnen agierten. Damit wies Ammian auf zwei höchste Prioritäten der Goten hin: äußere Sicherheit und Sicherstellung der Versorgung mit notwendigen Lebensmitteln. Diese Prioritäten werden auch der Politik und den Erwartungen der gotischen Fürsten in beiden Teilen des römischen Reiches in den folgenden Jahren zugrunde liegen.
Die Tervingen des Alaviv und Fritigern schickten Unterhändler zu Kaiser Valens und versprachen nach seinen Gesetzen zu leben und Hilfstruppen zu stellen, wenn er ihnen Teile Thrakiens oder Mösiens zur Ansiedlung anweise. Die Römer aber waren sich wohl nicht völlig dessen bewusst, was wirklich nördlich von der Donau passierte und wie groß das Ausmaß der Wanderungen war. Einen Einblick in Entscheidungsfindungsprozess am Kaiserhof gewährt uns wiederum Ammian. Einige kaiserliche Berater waren der Meinung, dass man einen konkreten Nutzen aus der Aufnahme der Tervingen ziehen könne. In erster Linie hoffte man auf die Verstärkung der kaiserlichen Armee: die Immigranten könnten in die Armee eingezogen werden. Außerdem dachte man an ökonomischen Nutzen: man könnte auf die Zwangsaushebung in den Provinzen verzichten, dafür aber eine Geldablöse fordern.
Im Prinzip war die Idee, die Goten auf dem Reichsboden aufzunehmen und militarisch auszunutzen, keine Neuigkeit. Kleinere barbarische Gruppen waren schon früher aufgenommen worden. Neu war allerdings das Ausmaß der gewünschten Ansiedlung – so viele Imigranten waren auf einmal noch nicht aufgenommen worden. Die hochrangigen Politiker am Hof des Valens dachten wohl nicht daran, welche logistische Schwierigkeiten und Versorgungsprobleme ein solches Unternehmen nach sich zöge. Die Migranten sollten Land und Haustiere erhalten – über weitere Details der Vereinbarung berichten aber die Quellen nicht.
Die Aufnahme der Tervingen war nicht nur eine Chance, ihr militärisches Potential auszunutzen, sondern auch in der Tat die einzige Möglichkeit den militärischen Konflikt mit den zum Äußersten getriebenen Barbaren zu vermeiden. Es stellte sich nämlich die Frage, ob die lokalen römischen Truppen eine großangelegte barbarische Invasion damals erfolgreich hätten abwehren können. Valens bereitete sich ja auf einen Krieg gegen Persien vor und brauchte daher keinen Krieg auf dem Balkan. Zieht man dies in Betracht, scheinen die Motive, von denen sich Valens leiten ließ, nicht nur nicht sinnlos, sondern sogar sehr pragmatisch.
Darüber hinaus agierte er sehr vorsichtig, selbst wenn Ammian dies nicht bezeugen will. Als Garanten für das Wohlverhalten der Ankömmlinge sollten Geiseln dienen – laut Zosimos ließ der Kaiser viele gotische Kinder nach Asien bringen. Und Valens wollte auch nicht alle gotischen Migranten aufnehmen. Eine positive Antwort auf ihre Bitte erhielten nur die Tervingen des Alaviv und Fritigern. Wir wissen, dass auch andere gotische Gruppen an der Donau erschienen und ebenfalls um die Aufnahme baten. Sie bekamen hingegen einen abschlägigen Bescheid.
II.
Die Überquerung der Donau muss im Sommer 376 stattgefunden haben. Man dürfte somit danach fragen, wo der Fehler lag, warum es zum Konflikt kam. Es scheint vor allem, dass die Römer das Ausmaß der Migration falsch beurteilten und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht beachteten. Die Zahl der Immigranten wurde nicht sorgfältig geschätzt, selbst wenn die Beamten die Anzahl der über die Donau übergesetzten Goten rechnerisch zu erfassen versuchten. Man kontrollierte auch nicht die Bewaffnung der Ankömmlinge. Vieles deutet darauf hin, dass die Tervingen nicht entwaffnet wurden. Ein weiteres Problem bildeten Korruption sowie Missachtung der Pflichten durch Beamte und Soldaten, die laut Eunapios und Zosimos die Goten entwaffnen und zählen sollten. Sie hätten aber ihre Pflichten vernachlässigt, da sie sich um den Erwerb von Sklaven, schönen Jungfrauen und Jünglingen gekümmert hätten, wie Eunapios überliefert.
Ein Teil der für die Organisation des Übergangs zuständigen Beamten versuchte sich offensichtlich auf Kosten der Einwanderer zu bereichern. Laut Ammian lag der Grund für die kommende Katastrophe gerade im Verhalten der römischen Verantwortlichen. Er verweist auf Lupicinus, comes per Thracias and dux Maximinus, denen die Organisation des ganzen Unternehmens übertragen war, und stellt fest, dass ihre unersättliche Habgier die Quelle aller Übel gewesen sei. Darüber hinaus löste die Überquerung das Hauptproblem der Goten nicht: auf dem römischen Boden litten sie nach wie vor Hunger, während die Römer sie nicht ausreichend mit Nahrung versorgten.
Lupicinus und Maximinus machten aus dem Hunger der Tervingen ein Geschäft und verkauften die Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt zu enorm überhöhten Preisen. Es kam sogar dazu, dass man Hundefleisch gegen einen Sklaven einhandelte. Die Not war dabei so groß, dass es unter diesen eingetauschten Sklaven sogar Verwandte der Vornehmen unter den Tervingen gab. Die Goten fühlten sich dadurch zusätzlich erniedrigt und gedemütigt und dachten an die Rache.
Denn dass sich die Tervingen eine derart miserable Behandlung längerfristig nicht gefallen lassen, konnte man leicht voraussagen. Selbst die Tatsache, dass diese große Menge an Menschen nicht entwaffnet war, barg in sich riesiges Konfliktpotential. Es verwundert also nicht, dass sich bald Unmut über die schlechte Behandlung und mangelnde Versorgung mit Lebensmitteln unter den Tervingen erhob. Lupicinus war sich wohl bewusst, welche Stimmungen bei den Tervingen herrschten. Um die Probleme verhindern zu können, zog er Truppen heran, um so die eingewanderten Barbaren wieder zum Abzug aus dem Donauraum zu zwingen.
Durch den Abzug der Soldaten aus den Lagern an der Donau war die Donaugrenze zumindest teilweise von den römischen Truppen entblößt. Dies nutzten andere barbarische Gruppen aus: weil die römischen Truppen und die Donauflotte woanders beschäftigt wurden, setzten sowohl die Greutungen des Alatheus und Safrax mit ihren alanischen und hunischen Verbündeten als auch die Gruppe des Farnobius und die Taifalen zum römischen Ufer des Flusses über.
Durch den militärischen Druck zwang Lupicinus die Tervingen das Donauufer im Frühling 377 zu verlassen und nach Süden in Richtung Marcianopel abzuziehen. Wohl Anfang 377 wurden Fritigern und Alaviv von Lupicinus zu einem Gastmahl nach Marcianopel eingeladen, wobei ihre Leute weit von der Stadt ferngehalten wurden. Lupicinus muss nach einer Versöhnung und Verbesserung der gotisch-römischen Verhältnisse gestrebt haben. Wenig zuverlässig scheint hingegen die Überlieferung des Jordanes zu sein, dass der römische Feldherr von vornherein die Ermordung der Gotenfürsten plante. In diesem Fall hätte er alles besser vorbereitet und zielstrebiger agiert.
Zuzustimmen ist der Meinung von Herwig Wolfram, dass Misstrauen und falsche Einschätzung der Lage zu unkontrollierten Aktionen geführt hätten. Die Tervingen forderten Einlass in die Stadt, um sich die Lebensmittel zu verschaffen. Dabei kam es aber zu Streitigkeiten mit den Einwohnern und zu einem Handgemenge, wobei es auf der römischen Seite Opfer gab. Unterdessen tagte Lupicinus mit den gotischen Anführern. Auf die Nachricht von den Kämpfen geriet er in Panik und handelte ohne Logik und Konsequenz. Zuerst ließ er die Begleiter seiner Gäste töten, dann aber ließ er Fritigern und andere Goten frei. Er hoffte naiv darauf, dass Fritigern seine Leute vor der Stadt beruhigen werde. Diese dramatischen Ereignisse gaben den Tervingen nun einen Anlass zum offenen Aufstand und der Krieg brach aus.
Als die Gruppen der Goten die Umgebung von Marcianopel plünderten, versuchte Lupicinus die Rebellion im Keim zu ersticken. Er handelte schnell, aber letztlich erfolglos. Neun Meilen von Marcianopel entfernt kam es zu einer Schlacht, in der viele römische Soldaten getötet wurden, während Lupicinus selbst sich durch Flucht retten konnte. Der Sieg gab den Tervingen neuen Mut. Sie rüsteten sich mit römischen Waffen aus und zogen überall umher, ohne auf Widerstand zu stoßen. Zu den Rebellen strömte auch eine Menge von armen Landbewohnern, Sklaven, Minenarbeitern und Steuerflüchtlingen zu. Zweifelsohne wurden die Goten im Jahr 377 zu einer ernsthaften, gut bewaffneten militärischen Macht, selbst wenn sie keine festgefügte homogene Struktur aufwiesen.
Spätestens nach der Schlacht bei Marcianopel erkannte Valens, wie ernst die Lage auf dem Balkan war. Aus diesem Grund gab er den Plan einer militärischen Auseinandersetzung mit Persien auf und wollte alle Streitigkeiten auf diplomatischem Weg lösen. Allerdings kam er erst im Sommer 378 mit seiner Hauptstreitmacht nach Konstantinopel. Valens schickte aber die Heerführer Profuturus und Trajan mit einigen Legionen aus Armenien voraus. Diese Kampfgruppe muss nicht besonders groß gewesen sein, denn Ammian betont, dass sie den Barbaren an Zahl weit unterlegen war.
Gleichzeitig bat Valens, den Westkaiser, seinen Neffen Gratian, um militärische Hilfe. Dieser setzte bald den comes domesticorum Richomeres und den Heermeister Frigeridus in Marsch. Zuerst erreichten aber die aus dem Osten kommenden Truppen die Balkanprovinzen. Das strategische Konzept des Profuturus und Trajan setzte das Abdrängen der Rebellen nach Norden voraus, um sie zwischen der Donau und den wüsten Einöden einzuschließen. Hier sollte der Hunger die Barbaren zur Kapitulation zwingen. Und es gelang den Römern, zumindest kurzfristig, die Hauptgruppe der Goten nach Norden zurückzudrängen. Im Spätsommer 377 vereinigten Profuturus und Trajan ihre Kräfte mit den westlichen Verstärkungen, die unter dem Kommando von Richomeres standen – Frigeridus war hingegen erkrankt und nahm an den Kämpfen nicht teil.
So war eine beträchtliche römische Armee bei Ad Salices (wahrscheinlich in der Nähe von Tomi) versammelt, wo sie nur in geringer Entfernung der gotischen Wagenburg gegenüberstand. Dies muss bedeuten, dass der römische Plan zumindest teilweise verwirklicht wurde, da sich ja die Hauptmasse der Tervingen im nördlichen Teil der Balkanprovinzen befand.
Die Schlacht bei Ad Salices ging unentschieden aus, wobei beide Seiten hohe Verluste erlitten. Die Römer zogen sich nach Marcianopel zurück, während die Goten sieben Tage ihre Wagenburg nicht verließen. Bald danach kehrte Richomeres nach Westen zurück, um weitere Verstärkungen herbeizuführen. Profuturus und Trajan nutzten hingegen die Situation aus und sperrten die Balkanpässe. Alle Lebensmittel waren schon früher in die Städte transportiert worden. Die römische Führung plante durch die Abriegelung der Balkanpässe die Barbaren im mösisch-skythischem Raum einzuschließen und auszuhungern.
III.
Auf diese Weise wurden die Tervingen zwischen Donau, Schwarzem Meer und Balkan eingeschlossen. Man darf davon ausgehen, dass die Römer dieses strategische Konzept schon vor der Schlacht bei ad Salices in die Tat umzusetzen anfingen. Es stellt sich allerdings die Frage, warum die Römer den Angriff auf die Goten bei ad Salices riskierten, wenn sie einen alternativen Plan hatten, der nicht so gefährlich war wie eine offene Schlacht. Meines Erachtens liegt die Antwort darauf in der Tatsache begründet, dass die römische Führung klar erkannte, dass die Tervingen Fritigerns nur Teil des größeren Problems sind. Denn südlich der Donau agierten zu diesem Zeitpunkt mehrere barbarische Gruppen.
Ammian, unsere Hauptquelle, weiß aber über andere Barbaren sehr wenig. Der Angriff auf die Goten bei Ad Salices lässt sich somit als einen vergeblichen Versuch deuten, eine der feindlichen Gruppen möglichst schnell auszuschalten. Die Römer müssen sich vor einer möglichen Zusammenarbeit der Tervingen mit anderen Gruppen gefürchtet haben, wobei es wahrscheinlich ist, dass einige dieser feindlichen Truppen südlich des Balkangebirges agierten. Die Römer mussten somit verschiedene Szenarien in Betracht ziehen und sich auf Bedrohung von mehreren Seiten vorbereiten.
Auf die Nachricht von der Schlacht bei ad Salices schickte Kaiser Valens den magister equitum Saturninus als Unterstützung für die wenig effektiven Profuturus und Trajan. Inzwischen unternahmen auch die Goten Fritigerns die ersten erfolgslosen Versuche, die Blockade zu durchbrechen. Sie litten Hunger, denn alles Eßbare in den Gebieten Skythiens und Nordmösiens war schon verzehrt war. In dieser Situation verständigte sich Fritigern mit den Hunnen und Alanen. Die moderne Forschung nimmt an, dass diese mit den Greutungen des Alatheus und Safrax die sogenannte Drei-Völker-Konfederation bildeten. Diese heterogene Gruppe entstand noch jenseits der Donau. Es bleibt dahingestellt, wo die Truppen des Alatheus und Safrax waren – es liegt aber nahe, dass sie südlich vom Balkan handelten. Dies würde aber bedeuten, dass die römischen Einheiten, die die Balkanpässe kontrollierten, von zwei Seiten würden angegriffen werden können.
Saturninus wurde von dieser Gefahr durch die von ihm aufgestellten Vorposten rechtzeitig informiert, weswegen er mit einem geschickten Rückzug begann – er öffnete die Sperren und zog geordnet die Wachmannschaften ab. Die Truppen der Tervingen und ihre Verbündeten ergossen sich in der Folge plündernd über ganz Thrakien bis zum Rhodope-Gebirge. Eine der römischen Einheiten wurde von den Barbaren beim Schanzen überrascht und völlig vernichtet.
Unterdessen war der Feldherr Frigeridus von Gratian erneut nach Thrakien beordert worden, um bei Beroea die wichtigsten Straßenkreuzungen zu sperren. Er verfügte aber über keine großen Kräfte und konnte den Barbaren keinen effektiven Widerstand leisten. Unter dem Druck der gotischen Verbände zog er sich in Richtung Illyrien zurück. Auf dem Rückzug stieß er auf gotisch-taifalische Plünderungsschar unter Farnobius. Er besiegte die Barbaren, deren Überreste er in Oberitalien als Kolonen ansiedeln ließ. Er konnte danach auch den strategisch wichtigen Succi-Pass sichern und dadurch die Bewegungsfreiheit der Goten auf Thrakien beschränken.
Als Gratian im Jahr 378 seinem Onkel zu Hilfe kommen und nach Osten mit seinem Heer marschieren wollte, griffen die alamanischen Lentienser Rätien an. Gratian unterbrach nun den Anmarsch nach Thrakien und ging zur Gegenoffensive über. Er besiegte die Alamanen, verlor aber dabei sehr viel Zeit, so dass sein Heer auf dem thrakischen Kriegsschauplatz nicht rechtzeitig erschien. Im Mai 378 traf Valens mit den besten Truppen der Ostarmee in Konstantiopel ein. Er verließ die Hauptstadt wieder er am 11. Juni. Als die Aktivität der gotischen Plünderungsscharen im Bereich der Rhodopen dem Kaiser gemeldet wurde, beauftragte er den Heermeister Sebastianus, diese abzufangen und zu vernichten. Die Kampfgruppe des Sebastianus, die etwa 2000 Mann umfasste, stieß nördlich von Adrianopel auf eine mit Beute beladene Schar der Goten, die er vernichtend schlagen konnte. Unterdessen erfuhr auch Fritigern, dass der Kaiser mit einem starken Heer nach Thrakien kam, so konzentrierte er seine Kräfte, die zwischen Beroea und Nikopolis operiert hatten. Beide Seiten bereiteten sich also auf eine militärische Entscheidung.
IV.
Im August kam Valens bis kurz vor Adrianopel, wo er das Lager schlug und auf das Eintreffen Gratians und dessen Heeres wartete. Dorthin kam dann aber nur der comes domesticorum Richomeres und überbrachte dem Augustus des Ostreichs die Bitte Gratians, auf ihn noch kurze Zeit zu warten und die Goten erst nach der Vereinigung beider Armeen anzugreifen. In dieser Situation berief Valens einen Kriegsrat ein. Man war sich aber nicht darüber einig, welcher Entschluss getroffen werden sollte. Insbesondere Sebastianus, der seinen jüngsten Erfolg überschätzte, und seine Anhänger plädierten für den sofortigen Angriff, während der magister equitum Victor riet, auf Gratians Heer zu warten und mit westlicher Unterstützung gegen die Goten vorzugehen.
Laut Ammian ließ sich Valens vor allem von dem Motiv der Eifersucht leiten: Er habe es dem Mitkaiser gleichtun wollen, auf dessen Sieg über die Alamannen er neidisch gewesen sei. Die moderne Forschung erklärt aber die Entscheidung des Valens, die Schlacht ohne die westlichen Verstärkungen zu schlagen, vor allem aus militärischen bzw. politischen Motiven. Zweifelsohne war sich Valens seines Übergewichts sicher, weil er sich auf die Meldungen seiner Aufklärer stützte, die die Stärke der Goten nur auf 10 000 Mann schätzten. Ammian betont aber ausdrücklich, dass diese Berechnungen falsch waren: Es handelte sich hier nur um einen Teil der gotischen Kräfte, den die Römer irrtümlich für die ganze feindliche Streitmacht hielten.
Einen zusätzlichen zu erwägenden Faktor konnte das Streben danach bilden, die Gesamtheit der gotischen Kräfte auf einen Streich zu vernichten. Darüber hinaus sind auch strategische Gründe zu beachten: Valens erfuhr, dass die Goten auf den Posten Nike marschierten. Deswegen bestand die Gefahr, dass die Barbaren die Verkehrswege unterbrechen und ihn von Konstantinopel abschneiden könnten. Unter diesen Bedingungen muss der Kaiser den sofortigen Angriff auf die Goten als die beste Lösung betrachtet haben.
Am Morgen des 9. August 378 setzte sich die römische Armee in Marsch, wobei der Tross und das Gepäck im Lager bei Adrianopel zurückgelassen wurden. Nach einem langen Marsch, der etwa acht Stunden dauerte, bekamen die Römer am frühen Nachmittag das gotische Lager zu Gesicht. Die römischen Soldaten hatten Hunger und Durst und waren sowohl vom langen und schweren Marsch als auch von der glühenden Hitze ermüdet. Um die Hitze zu verstärken, setzten die Goten die weiten Ebenen in Brand. Es gibt keine zuverlässigen Zahlenangaben, aufgrund derer man feststellen könnte, wie groß beide Armeen bei Adrianopel waren. Insgesamt könnte das römische Heer etwa 24.000 bis 26.000 Mann umfasst haben. Die Stärke des gotischen Heeres ist ebenfalls unbekannt, aber mit Sicherheit war es größer als 10.000 Mann. Fritigern konnte meines Erachtens, ähnlich wie Valens, bei Adrianopel insgesamt über etwa 25.000 Soldaten, vielleicht etwas mehr, verfügen. Die Mehrheit seines Heeres bildete das Fußvolk. Dazu kamen aber noch die Greutungen, Alanen und Hunnen hinzu, die beritten waren. Ihre Stärke ist auf etwa 4000 bis 5000 Mann zu schätzen. Das Schlachtfeld lag 12 Meilen von Adrianopel entfernt, d.h. etwa 18 Kilometer Der genaue Ort des Kampfes ist aber unbekannt.
Das Gros des gotischen Fußvolkes nahm eine gute Verteidigungsstellung auf einem Hügel inmitten einer kreisförmigen Wagenburg ein. Die Wagenburg wurde zum zentralen und wichtigsten Punkt der gotischen Befestigungen. Außerhalb der Befestigungen befand sich hingegen die greuthungisch-alanisch-hunnische Reiterei, über deren Anwesenheit die Römer nichts wussten und auf deren Flankenangriff sie nicht vorbereitet waren.
Als die Feinde in Sicht kamen, begriff die römische Führung wohl, dass die Kräfte der Barbaren weitaus größer waren als erwartet, und dass die Goten eine sehr günstige Verteidigungsstellung eingenommen hatten. An diesem Tag versuchten die Goten aber noch, Friedensverhandlungen aufzunehmen. Die erste Gesandtschaft wurde wegen ihres niedrigen Ranges nicht beachtet. Laut Ammian wollten die Goten damit nur Zeit gewinnen, damit die Reiterei von Alatheus und Safrax rechtzeitig Stellung beziehen konnte.
Unmittelbar vor Ausbruch der Schlacht schickte Fritigern erneut eine Botschaft. Diesmal entschied Valens, Verhandlungen zu beginnen. Die Römer waren sogar bereit, Geiseln zu stellen. Fritigern zog die Sache absichtlich in die Länge: Zum einen brauchte er Zeit für Alatheus und Safrax, zum anderen war er wirklich kompromissbereit. Aus dem Bericht Ammians geht hervor, dass es unter den Goten keine Einmütigkeit gab, wobei die Gruppe um Fritigern in der Tat bereit war, Frieden mit Rom zu schließen. Ungeachtet der wirklichen Intentionen beider Seiten machte die Disziplinlosigkeit der römischen Truppen jeglichen Verhandlungen ein Ende.
Valens verlor sehr schnell die Kontrolle über das Geschehen. Zwei römische Abteilungen – sagittarii and scutarii – griffen ohne Befehl die gotischen Befestigungen an. Damit kam es spontan zur Schlacht. Dieser Angriff der Scutarier und Sagittarier wurde schnell zurückgeschlagen. Ihre Flucht provozierte aber die Reaktion der römischen Infanterie auf dem linken Flügel und diese rückte vor. Dadurch kam der linke Flügel schnell bis unmittelbar an die Wagenburg heran. Als die Römer hier erfolgreich nach vorne drängten, erschien die greuthungisch-alanisch-hunnische Kavallerie des Alatheus und Safrax auf dem Schlachtfeld, was die Römer völlig überraschte. Das Eingreifen der Reiterei in die Schlacht wirkte sich entscheidend auf den Verlauf des Geschehens aus. Denn die Reiter des Alatheus und Safrax griffen unerwartet die römische Flanke an.
Der Flankenangriff überraschte die römische Reiterei, die keinen Widerstand leistete und die Flucht ergriff. Der vorgerückte linke römische Flügel war entblößt, die gotischen, hunnischen und alanischen Reiter umfassten die römische Infanterie und gelangten in den Rücken der gesamten römischen Schlachtreihe. Auch das gotische Fußvolk verließ die Wagenburg und ging auf der ganzen Linie zum Gegenangriff über. Es ist klar, dass die Katastrophe auf dem vorgerücktem linken Flügel begann: Von dieser Flanke her wurde die römische Infanterie aufgerollt. Trotz der kritischen Situation leisteten die Römer einige Stunden tapferen Widerstand. Der umzingelte linke römische Flügel wurde fast völlig vernichtet. In anderen Abschnitten hielten die römischen Linien ungefähr bis zum Abend.
Auf dem Schlachtfeld fand auch der Kaiser Valens den Tod. Bei Adrianopel entkam kaum ein Drittel der Armee; außer dem Kaiser fanden zahlreiche hohe Offiziere den Tod. Insgesamt kann man die römischen Verluste auf etwa 16.000 Tote schätzen. Die Niederlage resultierte nicht aus einer falschen Strategie des Valens, sondern aus ganz konkreten Schwächen im taktischen Bereich und aus einem bestimmten Verlauf des Geschehens auf dem Schlachtfeld: Die römische Armee wurde überraschend von der Flanke und dann im Rücken angegriffen, und dies reichte aus, die Schlacht zu entscheiden. Darüber hinaus waren die römischen Soldaten vor Hunger, Durst und wegen des langen Marsches in brennender Hitze erschöpft.
V.
Die Lösung des Gotenproblems, die Gratian dem Feldherr Theodosius, den er zum Rang des Kaisers am 19. Januar 379 erhob, konnte nicht mehr in der bloßen Verdrängung der Goten aus den Reichsgrenzen bestehen. Dies zu schaffen, war Rom nun einfach zu schwach. Man suchte allerdings zuerst nach radikalen Methoden der Bewältigung der Krise. So wurden in Asien zahlreiche gotische Soldaten, die früher Aufnahme gefunden hatten und über verschiedene Städte und Lager verteilt waren, auf Befehl des Heermeisters Julius ermordet. Theodosius musste aber vor allem eine neue Ostarmee aufstellen. Viele Einheiten, die wir aus der Notitia Dignitatum kennen, wurden von diesem Kaiser 379 und 380 geschaffen. Selbst die Goten wurden damals wieder in großer Zahl angeworben.
Es ist nicht völlig klar, wie sich die Ereignisse auf dem Kriegsschauplatz es Balkans 379 bis 382 entwickelten, weil der Bericht des Zosimos, der auf Eunapios zurückgeht, wenig präzise ist und deutliche Kürzungen aufweist. Theodosius setzte sich wohl zum Hauptziel, Konstantinopel zu sichern, denn seine Handlungen konzentrierten sich auf Thrakien. 379 errang Modares, der Gote im römischen Dienst, einen Sieg über gotische Plünderer in Thrakien. Bald erkannte man aber, dass eine militärische Lösung nicht erreichbar ist – die Goten fügten der neuen kaiserlichen Armee eine weitere demütigende Niederlage zu, zahlreiche Soldaten desertierten vom Schlachtfeld, und Theodosius musste sich durch Flucht retten. dann Thessalien und Mazedonien fielen gotischen Plünderern zum Opfer.
Auf Theodosius’ Hilfegesuch schickte ihm Gratian ein starkes Korps unter Bauto und Arbogast. Es gelang ihnen, die Goten erneut nach Niedermösien zu verdrängen. Mehr erreichte man nicht. Gefährdet wurde auch Pannonien von den Greutungen und ihren hunisch-alanischen Verbündeten. Wenn der Historiker Jordanes Recht hat, kam Gratian damals zum Schluss, dass nur Verhandlungen auf diplomatischem Weg eine Chance für dauerhaften Frieden eröffnen und schloss ein Abkommen mit den Eindringlingen, wohl noch im Jahr 380. Er siedelte sie in den Provinzen Pannonia II und Valeria an. Theodosius selbst zog am 24. November 380 in Konstantinopel ein.
Nach einigen Erfolgen sowie Misserfolgen gelangte Theodosius eigentlich wieder an den Ausgangspunkt; er stand wieder vor dem Problem der Ansiedlung der Goten auf römischem Boden gegen ihren Dienst für das römische Reich. Er wusste aber besser als Valens, welche Bedrohungen und Auswirkungen dies nach sich zieht. Er war dabei imstande, gewisse freundliche Gesten zu machen, durch welche er sich bei den Goten großes Ansehen verschaffte, so dass sie ihn nicht nur als einen römischen Kaiser, sondern auch als einen Freund der Goten und einen Befürworter des Friedens wahrnahmen: „amator pacis generisque Gothorum.“
Dieser geschickte politische Kurs lässt sich im ehrenvollen Empfang des Athanarich in Konstantinopel am 11. Januar 381 erkennen, der aus seinem Land vertrieben wurde, und im großen Gepränge, mit dem Theodosius ihn nach dessen plötzlichen Tod bestatte. Dies war eine Demonstration der römischen Stärke aber auch ein Zeichen der Friedensbereitschaft. Auf diese Weise machte Theodosius den Goten ein verlockendes Angebot und bewies, dass er Teile von ihnen für sich gewinnen konnte. Die Ausnutzung der inneren Spaltungen und Konfliktlinien zwischen den einzelnen gotischen Gruppen oder Anführern muss somit als einer der wichtigen Faktoren betrachtet werden, die bald zum Frieden führen würden. Die Kämpfe hörten zwar nicht sofort auf, aber beide Seiten waren nun wieder bereit, dem Krieg ein Ende zu machen.
Am 3. Oktober 382 kam es zum Friedensschluss mit den Goten: Laut Consularia Constantinopolitana „unterwarf sich das ganze Volk der Goten zusammen mit seinem König dem römischen Reich”. Der anonyme gotische rex, der die Verhandlungen mit dem Kaiser geführt hatte, ist unbekannt. Das Wesen des mit Goten geschlossenen Vertrags, dessen Einzelbestimmungen unbekannt sind, ist in der Forschung umstritten. Themistios, Pacatus, Orosius und andere römische Autoren deuten ihn als eine bedingungslose Kapitulation. Die römische Seite wollte darin die Lösung des Gotenproblems und den Sieg über die Goten sehen.
Es ist aber auch klar, dass die Goten steuerfreien Grundbesitz in Thrakien zugeteilt erhielten und im Gegenzug Truppen für den Kriegsfall – gegen Bezahlung – zu stellen versprachen. Wie die späteren Ereignisse zeigten, kämpften sie in geschlossenen Verbänden unter eigenen Anführern und lebten in Thrakien nach eigenem Recht unter eigenen Fürsten. Obwohl sie Oberhoheit des Kaisers anerkannten, genossen sie Autonomie. Längerfristig führte aber dieser Schwebezustand zwischen Reichsangehörigkeit und Autonomie zu den weiteren Konflikten.
Für die Zeitgenossen bedeutete Adrianopel einen wirklichen Schock. Die Kaiserpanegyriken an Theodosius, die von Themistios oder Pacatus in der ersten Dekade nach der Katastrophe gehalten wurden, bieten einen Einblick in die offizielle Deutung der jüngsten Ereignisse. Immer wieder betont man dort, dass diese Schlacht eine echte Katastrophe war – die römischen Armeen seien wie ein Schatten völlig verschwunden, sagt Themistios. Der Frieden von 382 wurde von den Lobrednern als bestmögliche Lösung des Problems und als Ausdruck der römischen Milde und Vernunft gedeutet. Der Redner Themistios versuchte 383, den Frieden zu rechtfertigen, indem er für die These plädierte, dass Theodosius erkannt habe, dass nur die Klugheit und nicht die militärische Macht den Frieden schaffen könne. Er habe gewusst, dass die völlige Ausrottung der Goten unmöglich sei, so habe er Thrakien mit gotischen Bauern und nicht mit den Leichen der Toten füllen wollen. Auf ähnliche Weise argumentierte Pacatus 389, der den Frieden von 382 als Beweis der Unterwerfung der Goten deutete.
Darüber hinaus löste Adrianopel eine Diskussion über den Fortbestand des römischen Reiches aus, obwohl diese erst im 5. Jahrhundert richtig entflammte. So stellt Rufinus von Aquileia fest, dass diese Niederlage Anfang allen Übels für das Reich sei. Ammian, der seinen Glauben an Roms Ewigkeit an mehreren Stellen ausdrückt, vergleicht Adrianopel mit Cannae und greift auf das Motiv der Krisenbewältigung zurück: Rom habe die Fähigkeit, sich nach Katastrophen zu erneuern. Schon einige Male hätten die Römer schwere Niederlagen erlitten, trotzdem hätten sie immer den endgültigen Sieg errungen. Adrianopel, ähnlich wie Cannae, sei kein Ende.
Unter den Christen kursierten hingegen die Endzeiterwartungen. Adrianopel und spätere Niederlagen deutete man als Zeichen, die den Anbruch der Endzeit ankündigten, wobei Ambrosius im Werk De fide annahm, dass die Kriege gegen die Goten, die er mit Gog, dem Feind des Auserwählten Volkes, identifiziert, schon von Ezechiel verkündet worden seien: „Gog iste Gothus est. Auf diese Art und Weise, noch bevor Alarich 410 Rom einnahm, hatten sich Fritigern und seine Tervingen, zumindest kurzfristig, in den Augen der Römer in beängstigende Reiter der Apokalypse verwandelt.