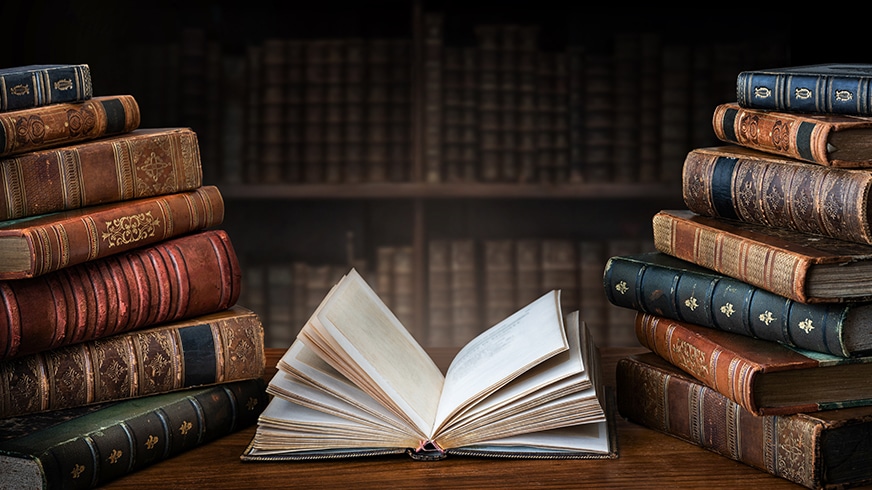Introduction
Das Westgotenreich von Toulouse (lat. Tolosa) war im 5. Jh. zweifellos das bedeutendste der Nachfolgereiche auf dem Boden des sich auflösenden Weströmischen Reiches. Um 500 erstreckte es sich vom Atlantik im Westen bis zur Saône und Rhône im Osten, von der Loire im Norden bis über die Pyrenäen im Süden. Ihm, nicht dem Frankenreich, schien die Zukunft in Gallien zu gehören. Dennoch kollabierte es auf dem Höhepunkt seiner Macht, und so gaben die Franken Gallien ihren Namen: Frankreich.
Heute ist die Erinnerung an das gallische Westgotenreich im Gegensatz zu anderen Reichen der so genannten Völkerwanderungszeit weitgehend verblasst. Während das Burgunderreich im Nibelungenlied und das Ostgotenreich im Sagenkreis um Dietrich von Bern noch heute fortleben, ist das Westgotenreich von Toulouse aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Dieser Beitrag befasst sich mit seiner Gründung, den Ursachen seines raschen Aufstiegs, den Fundamenten seiner Macht, den Umständen seines abrupten Endes und seinem Erbe für die Nachwelt.
Gallien am Vorabend der gotischen Ansiedlung (406-418)
Ganz Gallien habe wie ein einziger Scheiterhaufen geraucht! So beschrieb Bischof Orientius von Auch (Orient. comm. 2.184) in der ersten Hälfte des 5. Jh. die Situation in seiner Heimat. Zum Jahreswechsel 406/407 hatten verschiedene gentile Gruppen, darunter Vandalen, Sueben und Burgunder, vermutlich bei Mainz den Rhein überquert und waren sengend und brennend durch Gallien bis hinab zu den Pyrenäen und darüber hinaus gezogen. Kurz darauf setzte der römische Usurpator Claudius Constantinus mit seinen Truppen von Britannien aus nach Gallien über, um seinen Anspruch auf die Kaiserwürde des Westreiches durchzusetzen. Constantin (III.) drang bis Arles vor, dem Sitz der gallischen Präfektur, wo seine Herrschaft nach einer Rebellion unter seinen Anhängern zusammenbrach.
Die Reichsregierung um den legitimen Kaiser Honorius in Ravenna gewann die Kontrolle in Gallien zurück und ließ den Usurpator nach dessen Gefangennahme hinrichten. Gallien kam dennoch nicht zur Ruhe.
Jovinus, ein Angehöriger der gallo-römischen Senatsaristokratie, ließ sich 411 mit militärischer Unterstützung der Burgunder zum Kaiser ausrufen. Der römische Senator Priscus Attalus, einst vom Gotenkönig Alarich I. in Italien zum Gegenkaiser erhoben, um seinen Forderungen gegenüber der Reichsregierung Nachdruck zu verleihen, vermittelte ein Bündnis zwischen den Goten in Italien unter ihrem neuen Anführer Athaulf und ebendiesem Jovinus. Athaulf war ein Schwager des 410 verstorbenen Alarich I.
Die Versorgungslage der Westgoten in Italien war prekär, die seit fast zehn Jahren mit der Reichsregierung im Westen um den Abschluss eines Vertrages (lat. foedus) rangen, der ihre Lebensgrundlage sichern sollte. Stets mussten sie damit rechnen, dass die kaiserliche Regierung in Ravenna ein Heer zu ihrer Vernichtung mobilisierte. So entschied sich Athaulf, seinen Verband nach Gallien zu führen und ein Bündnis mit Jovinus einzugehen. Allerdings überwarfen sich die beiden Partner alsbald, sodass Athaulf die Nähe zur legitimen Regierung in Ravenna suchte.
Gegen die Zusage von Getreidelieferungen versprach er, Galla Placidia, die Schwester des Kaisers Honorius, die man einst bei der Plünderung Roms 410 verschleppt hatte, freizulassen und den Aufrührer Jovinus in Gallien niederzuwerfen. Während die Westgoten ihren Teil der Abmachung erfüllten, indem sie Jovinus festsetzten und nach Ravenna überstellten, konnte die römische Seite ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Wegen Unruhen in Nordafrika, der Kornkammer des Westreiches, sah sich die Regierung in Ravenna außerstande, die zugesicherten Getreidelieferungen einzuhalten.
Von solchen Dingen wusste Athaulf jedoch nichts. Um den Druck auf die Reichsregierung zu erhöhen, ließ er Narbonne und Toulouse besetzen. Ein Angriff auf die wichtige Hafenstadt Marseille hingegen scheiterte und zwang die Westgoten zum Rückzug nach Narbonne. Dort, im Haus des Senators Ingenuus, ehelichte Athaulf im Januar 414 die Kaiserschwester Galla Placidia nach römischem Brauch. Dem Chronisten und Zeitgenossen Orosius war zu Ohren gekommen, dass Athaulf erklärt habe, dass er das Römerreich zunächst habe erobern und so aus der Romania eine Gothia habe machen wollen. Er sei jedoch zu der Einsicht gelangt, dass seine Goten wegen ihrer Wildheit keinen Gesetzen gehorchen würden, aber ohne Gesetze kein Staat zu machen sei. Daher habe er den Entschluss gefasst, das Römerreich mittels der Goten nicht zu vernichten, sondern wiederaufzurichten, um so der Nachwelt als Erneuerer Roms in Erinnerung zu bleiben, so Orosius (Oros. hist. adv. pag. 7.43.5-6).
Kaiser Honorius war ob der Verbindung Athaulfs mit seiner Schwester erbost, war doch deren Freilassung, nicht Verheiratung verabredet worden. Er verhängte eine Seeblockade über die Mittelmeerhäfen Galliens sowie Spaniens, wohin die Westgoten in ihrer Not mittlerweile gezogen waren. In Barcelona fiel Athaulf 415 einer Fehde zum Opfer. Die Versorgungslage der Westgoten spitzte sich indes zu. Ein Versuch, nach Nordafrika überzusetzen, scheiterte, sodass Vallia, der neue Anführer der Westgoten, auf einen Ausgleich mit der Reichsregierung hoffte, der auch zustande kam: Gegen Getreidelieferung gab der Gotenkönig Galla Placidia, die Witwe seines Vorgängers Athaulf, frei und bekämpfte im Auftrag des Kaisers auf der Iberischen Halbinsel wütende Barbaren.
Im Jahre 418 erreichte die Westgoten die Aufforderung des römischen Oberbefehlshabers im Westreich, des Heermeisters (lat. magister militum) Constantius, nach Gallien zurückzukehren. Die Motive für diese Entscheidung sind in der Forschung viel diskutiert worden: Vielleicht fürchtete die Reichsregierung, die Goten könnten sich nach ihren militärischen Erfolgen die Iberische Halbinsel untertan machen oder erneut versuchen, in das für Westrom wirtschaftlich wichtige Nordafrika zu gelangen. Womöglich benötigte das Reich die gotischen Streitkräfte in Gallien, das von sozialen Unruhen erschüttert wurde.
Die Ansiedlung der Goten in Aquitanien (418)
Noch 418 kam es zum Abschluss eines Bündnisses (lat. foedus, pl. foedera) zwischen Ravenna und den Westgoten. Foedera waren seit der Römischen Republik ein gängiges Instrument römischer Außenpolitik. Föderaten (lat. foederati) waren dem Reich zum militärischen Beistand verpflichtet und erhielten im Gegenzug eine finanzielle Vergütung, Nahrungsmittellieferungen oder Siedlungsland angewiesen, so auch die Westgoten. Modalitäten der Ansiedlung und Umfang des Siedlungsgebietes, das den Westgoten 418 überlassen worden war, sind aufgrund der schlechten Quellenlage in der Forschung umstritten. Wahrscheinlich handelte es sich um hauptsächlich in der römischen Provinz Aquitania secunda, aber auch in angrenzenden Provinzen gelegene Gebiete mit einem deutlichen Schwerpunkt im Tal der Garonne zwischen Bordeaux und Toulouse (Chron. Gall. a. 511, 36).
Die Westgotenkönige residierten vornehmlich in Toulouse, wo sich aus westgotischer Zeit allerdings kaum etwas erhalten hat. Der Vorgängerbau der heutigen Basilika Notre-Dame de la Daurade zu Toulouse wurde als mögliche Palastkirche der Westgotenkönige gedeutet.
Es mangelt nicht an Versuchen, die Grenzen des den Goten 418 überlassenen Gebietes zu rekonstruieren. So will die Ortsnamenforschung eine Siedlungskonzentration um Toulouse ausgemacht haben, die sich allerdings archäologisch nicht bestätigen lässt. Vermutlich lebten die Goten unter ihren römischen Nachbarn, deren Bekleidungs- und Bestattungsgewohnheiten sie rasch annahmen. Auch ist viel gerätselt worden, weshalb die Reichsregierung den Westgoten gestattete, in eines der wirtschaftlich stärksten Gebiete Galliens einzurücken. So wurde angenommen, dass sie die Atlantikküste gegen Seeräuber verteidigen oder soziale Unruhen niederhalten sollten.
Womöglich war Ravenna daran gelegen, die Goten im aquitanischen Hinterland kaltzustellen und so von den reichen Metropolen der Mittelmeerküste fernzuhalten. Mit Gewissheit lässt sich hingegen sagen, dass die Westgoten an einem neuralgischen Punkt saßen, von dem aus sie bei Bedarf soziale Unruhen in Gallien ebenso bekämpfen konnten wie Barbaren im benachbarten Spanien. Offenbar wollte sich Ravenna das militärische Potential der Westgoten erhalten und gegebenenfalls nutzbar machen.
Über die Modalitäten der Ansiedlung der Goten in Aquitanien schweigen sich die Quellen weitgehend aus. So heißt es lediglich, ihnen seien „Sitze zum Wohnen“ (lat. sedes ad inhabitandum) überlassen worden (Prosp. Chron., 1271). Im spätantiken römischen Militärwesen gab es, anders als für die Grenztruppen, für das Feldheer im Hinterland keine Lager. Sie wurden nach dem Prinzip der hospitalitas (Gastfreundschaft) als Kostgänger der Landbesitzer in Städten und deren Umland einquartiert. Grundbesitzer hatten Truppen temporär unterzubringen und zu versorgen. Geregelt wurde die Zuteilung durch Römisches Recht. Ein Gesetz des Kaisers Honorius von 398 (Cod. Theod. 7.8.5) sah vor, dass betroffene Grundbesitzer ihren Besitz zu dritteln hatten. Dem Gastgeber (lat. hospes) stand die Wahl des ersten und letzten Drittels zu. Der Gast (lat. hostis), mithin der Soldat, wählte das zweite Drittel, das nach Abzug der Truppen an den Eigentümer zurückfiel.
Bis weit in das 20. Jh. war in der Forschung die Annahme unangefochten, dass diese Regelung in modifizierter Form im Jahre 418 auf die Westgoten Anwendung gefunden hatte. Demnach sei es zwischen Goten und römischen Landbesitzern zu einer Realteilung von Grund und Boden gekommen, wobei den Goten allerdings nicht ein, sondern zwei Drittel des bebauten Landes, wie spätere westgotische Gesetze nahelegen, dazu die Hälfte des Brachlandes, der Wiesen und Wälder sowie ein Drittel der Arbeitskräfte auf den Gütern, dauerhaft überlassen worden seien. Diese These stieß in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf Kritik, da es unglaublich schien, dass sich die römischen Grundbesitzer geräuschlos mit einer solchen faktischen Enteignung abgefunden hätten, in den Quellen aber nichts über Widerstand seitens der römischen Landeigner zu lesen ist. Die Kritiker der Realteilungsthese glauben daher, dass nicht das Eigentumsrecht an Grund und Boden auf die Goten überging, sondern lediglich der Anspruch auf die auf dem Grundbesitz lastende Steuerschuld, sodass die Einnahmen aus der Grundsteuer nicht an den römischen Fiskus abgeführt wurden, sondern direkt in den Unterhalt der gotischen Föderaten flossen. Die Kontroverse um die Modalitäten der gotischen Ansiedlung hält an.
Fest steht, dass die Quellen von der Überlassung von Grund und Boden (sedes) und nicht von Steueranteilen sprechen und uns Goten in den Quellen als Landbesitzer entgegentreten. Das Schweigen der Überlieferung über Widerstand seitens römischer Grundbesitzer ist dadurch erklärlich, dass diese wohl an der Aushandlung der Vertragsmodalitäten von 418 beteiligt waren, es sich mithin um ein von ihnen gebilligtes Verfahren handelte. Die Reichsregierung dürfte Rücksprache mit den römischen Grundbesitzern der betroffenen Regionen gehalten haben.
Gelegenheit hierzu bot sich auf dem Provinziallandtag (lat. concilium) von 418 in Arles. Im Beisein des Heermeisters Constantius diskutierten die anwesenden Ratsherren (lat. decuriones) der städtischen Kurien mit Vertretern der Großgrundbesitzer (lat. honorati) und der landbesitzenden Mittelschicht (lat. possessores) das „Gotenproblem“, um die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse wieder zu normalisieren. Die Goten dürften vorwiegend infolge der Wirren der letzten Jahre brachliegendes Land angewiesen bekommen haben, dessen Verlust die römischen Eigentümer verschmerzen konnten, denen zudem das Recht der ersten Wahl zugebilligt worden sein dürfte, um sich so die ertragreicheren Güter zu sichern. Die wirtschaftliche Grundlage der römischen Grundbesitzer war durch den Vertrag nicht gefährdet, während die ärmere Bevölkerung wohl von der Landteilung verschont geblieben war. Die Goten wiederum dürften mit den Bedingungen zufrieden gewesen sein, da nun eine sichere und rechtlich sanktionierte Versorgung auf Dauer gewährleistet schien.
Die Folgen des Vertrages von 418, nämlich dass die Ansiedlung der Goten in Aquitanien die Keimzelle des Reiches von Toulouse, des regnum Tolosanum, in sich trug, waren damals freilich nicht abzusehen, blieb doch zunächst vieles beim Alten. Die römische Bevölkerung in den betroffenen Gebieten unterstand weiterhin römischer Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Die Goten waren in die bestehenden militärischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des römischen Staates eingebunden. Sie waren aber weder Reichsangehörige, mithin keine römischen Bürger, noch reguläre römische Soldaten, sondern als Föderaten weiterhin Angehörige eines gentilen Verbandes unter eigenen Anführern mit eigenem Recht. Für die Römer wiederum dürfte es sich beim Vertrag von 418 schlicht um die temporäre Lösung eines drängenden Problems gehandelt haben: Wohin mit den Goten, die gegenwärtig militärisch nicht zu besiegen waren?
Die Expansion des gotischen Einflusses in Gallien (418-466)
Das foedus von 418 war wenig nachhaltig. In den folgenden Jahren schwankten die Westgoten zwischen Vertragstreue und offener Aggression. Ihr Verhalten orientierte sich an den sich ständig ändernden Bedingungen und Zwängen, denen sie ausgesetzt waren. Ob der Vertrag von 418 noch unter König Vallia († 418) ratifiziert worden ist oder bereits unter dessen Nachfolger Theoderid (418-451), einem Schwiegersohn Alarichs I., ist unklar. Theoderid nutzte die nach dem Tod des Kaisers Honorius († 423) ausbrechenden innerrömischen Machtkämpfe, um die eigene Position in Gallien zu festigen. Er ließ Arles belagern, um die Reichsregierung unter Druck zu setzen und bessere Vertragsbedingungen auszuhandeln. Im Jahre 427 kam es tatsächlich zum Abschluss eines neuen foedus, dessen Inhalt allerdings nicht überliefert ist.
In den 430er Jahren geriet das Weströmische Reich stärker als zuvor in Bedrängnis. Die Vandalen, die von der Iberischen Halbinsel nach Nordafrika übergesetzt hatten, bedrohten die für Westrom wirtschaftlich wichtigen nordafrikanischen Provinzen, während wiederum die Sueben in das von den Vandalen in Spanien hinterlassene Machtvakuum stießen. Die Burgunder plünderten die römische Belgica, während Gallien von sozialen Unruhen, der Bagaudenbewegung, heimgesucht wurde. Theoderid nutzte die Wirren für einen Vorstoß auf Narbonne, einen der wichtigsten römischen Mittelmeerhäfen.
Der römische Oberbefehlshaber für Gallien, Litorius, konnte den gotischen Angriff zwar abwehren, erlitt allerdings im Anschluss bei Toulouse eine Niederlage. Litoriusʼ Scheitern verschob das Kräfteverhältnis in Gallien. Die Reichsregierung sah sich gezwungen, unter Vermittlung des gallischen Präfekten Eparchius Avitus Frieden zu schließen und die Westgoten aus ihrem Status als Föderaten zu entlassen. Fortan erhoben die Westgotenkönige in ihrem Herrschaftsbereich Steuern und ließen Münzen schlagen, was bisher ein Vorrecht der kaiserlichen Regierung gewesen war.
Mit der Beendigung des Föderaten-Verhältnisses waren die Westgoten Ravenna nicht länger zur Waffenhilfe verpflichtet, und so musste Ravenna formal um deren militärischen Beistand ersuchen, als es darum ging, den Einfall der Hunnen Attilas in Gallien abzuwehren. Die westgotische Beteiligung an der antihunnischen Koalition des römischen Heermeisters Flavius Aëtius beruhte nicht auf vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ravenna, sondern auf strategischen Erwägungen Theoderids, denn Attila bedrohte das mühsam austarierte Kräfteverhältnis in Gallien und damit auch das Gotenreich von Toulouse. So fochten die Goten Theoderids im Jahre 451 auf römischer Seite in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern bei Troyes.
Die Hunnen konnten zum Rückzug gezwungen werden, aber der Blutzoll war hoch und König Theoderid in der Schlacht gefallen. Sein ältester Sohn Thorismund, der ihn auf dem Kriegszug begleitet hatte, trat seine Nachfolge an und setzte die väterliche Politik fort, die sich häufenden Schwächeanfälle des Weströmischen Reiches zum eigenen Vorteil zu nutzen. So klagte der gallo-römische Aristokrat und Dichter Sidonius Apollinaris, der Gote hege die Vision eines eroberten Rom und einer sich seinem Wahnsinn unterwerfenden Welt (Sidon. Apoll. carm. 7.361-362).
Bereits 453 wurde Thorismund auf Betreiben seiner jüngeren Brüder Theoderich und Friderich gewaltsam beseitigt. Mit dem neuen König Theoderich (453-466) setzte eine Interessenverschiebung in der westgotischen Politik ein, die darauf abzielte, die Westgoten zur stärksten militärischen und politischen Kraft im Weströmischen Reich zu machen. Das alte Bündnis wurde erneuert. Im Jahre 455 fiel der weströmische Kaiser Valentinian III. einem Mordanschlag zum Opfer. Im Namen seines Nachfolgers Petronius Maximus verhandelte der ehemalige gallische Präfekt Eparchius Avitus über die Bestätigung des bestehenden Vertrages, als die Nachricht hereinkam, dass auch der neue Kaiser bereits verstorben sei. Sogleich habe Theoderich Avitus, einst Erzieher des noch jungen Westgotenkönigs, aufgefordert, selbst die Kaiserwürde anzunehmen und sicherte ihm militärische Unterstützung bei der Durchsetzung seines Anspruchs zu, wie Sidonius Apollinaris, der Schwiegersohn des Avitus, überliefert (Sidon. Apoll. carm. 7.508-509).
Der in Italien ungeliebte Avitus konnte sich nicht lange an der Macht halten, wurde abgesetzt und hingerichtet. Theoderich, der sich auf einem Feldzug in Spanien befand, vermochte es nicht, seinen Schützling zu stützen, kehrte aber auf die Nachricht vom Sturz „seines“ Kaisers eilends nach Gallien zurück, um seine Interessen in den nun ausbrechenden Machtkämpfen zu wahren. Theoderich gab seine Pläne auf, das Römerreich mittels gotischer Waffen zu stützen, und bediente sich fortan bei jeder sich bietenden Gelegenheit an der Konkursmasse desselben. Im Jahre 459 musste er allerdings bei Arles, wo sich der römische Oberbefehlshaber für Gallien, Aegidius, verschanzt hielt, eine Niederlage gegen den neuen Kaiser Maiorian hinnehmen.
Nach einem gescheiterten Feldzug gegen die Vandalen wurde Maiorian 461 beseitigt, was neuerlich Wirren in Gallien heraufbeschwor, denn Aegidius erkannte Maiorians Nachfolger, Libius Severus, nicht an. Theoderich nutzte den Dissens zwischen Reichsregierung und römischer Militärführung in Gallien, um seinen Einfluss auszudehnen, allerdings ließ der Königsbruder Friderich bei einem Vorstoß auf Orléans an der Loire sein Leben. Aegidius, der die römische Verteidigung an der Loire organisierte hatte, trug sich mit dem Gedanken, in die Offensive zu gehen, starb aber 464 überraschend. Zwei Jahre später (466) wurde Theoderich von seinem jüngeren Bruder Eurich ermordet.
König Eurich (466-484)
Sidonius Apollinaris, selbst der schärfste Kritiker Eurichs, nannte ihn einen waffengewaltigen Mann von scharfem Verstand und energischer Jugend (Sidon. Apoll. ep. 7.6.6). Schon bald nach seinem Herrschaftsantritt löste Eurich das formal noch immer bestehende foedus mit dem Römischen Reich. Damit gab er endgültig den Versuch seines Vorgängers auf, innerhalb der (noch) bestehenden römischen Strukturen Einfluss auf die römische Politik zu nehmen. Der neue Kaiser im Westen, Anthemius, versuchte noch einmal, die Macht der Westgoten zu brechen. Von Ostrom mit Truppen und reichlich Geldmitteln ausgestattet, brachte Anthemius eine antigotische Koalition aus Teilen der mächtigen südgallischen Senatsaristokratie, den nördlich der Loire verbliebenen Römern nebst deren fränkischen Verbündeten, den Bretonen, burgundischen Föderaten und den hispanischen Sueben zustande.
Eurich, der die Bedrohung erkannte, holte zum Präventivschlag aus. Seine Heere drangen in Spanien bis Mérida und in Gallien bis Bourges vor, wo sie 469 ein bretonisches Aufgebot aufrieben. Im Jahre 471 überschritten Eurichs Truppen die Rhône, drangen bis Arles, Avignon und Orange vor und vernichteten ein kaiserliches Heer, das letzte, das Gallien zu Gesicht bekommen sollte. Bis 475 gelang Eurich die Eroberung Aquitaniens, das dem Westgotenkönig im Rahmen eines Friedensvertrages von Anthemiusʼ Nachfolger, Kaiser Julius Nepos, noch im selben Jahr offiziell abgetreten wurde. Mit dem Vertrag wurden Eurichs gallische Eroberungen von Ravenna formal anerkannt. Lediglich die Gebiete östlich der Rhône, d. h. die Provence mit dem Zentrum Arles, blieben römisch. Nach der Vertreibung des Julius Nepos noch im selben Jahr griff Eurich auch nach der Provence, die ihm von Odoaker, dem nach der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers, Romulus Augustulus, im Jahre 476 neuen starken Mann im Westreich, auch offiziell überlassen wurde.
Eurich hatte die Schwäche des Weströmischen Reiches erkannt und genutzt, um sein Reich aus dem Verband des römischen Staates herauszuführen. Das Reich von Toulouse erstreckte sich nun vom Atlantik im Westen bis zur Rhône im Osten, von der Loire im Norden bis hinaus über die Pyrenäen im Süden. Die Reichweite des westgotischen Einflusses auf der Iberischen Halbinsel unter Eurich ist umstritten. Nahm die Forschung lange Zeit an, dass Eurich die Eroberung weiter Teile der Halbinsel gelungen war, wird heute eher die Ansicht vertreten, dass sich lediglich die römische Provinz Hispania Tarraconensis in westgotischer Hand befunden hat. Eurichs Herrschaftsgebiet umfasste etwa 750.000 Quadratkilometer mit moderat geschätzten 10 Millionen Bewohnern, wovon nur ein geringer Teil Goten waren, die einst mit Athaulf aus Italien gekommen waren.
Angesichts dessen musste dem Westgotenkönig an einer Kooperation mit der römischen Mehrheitsgesellschaft gelegen sein, um sein Reich zu konsolidieren, die wiederum an der Wiederherstellung von Recht und Ordnung interessiert war. Beiderseits war man auf eine Zusammenarbeit angewiesen. Die gotische Militärmacht garantierte nach dem Rückzug der römischen Administration die bestehenden Eigentums- und Besitzverhältnisse, mithin Rechtssicherheit, während sich Eurich der Erfahrung der Gallo-Römer in Rechtswesen und Verwaltung bedienen konnte.
Obwohl sich die römischen Verwaltungsstrukturen in den Wirren der 470er Jahre allmählich aufgelöst hatten und die administrativen Einheiten von Präfektur und Diözesen verschwunden waren, blieb die lokale Verwaltung auf der Ebene der Stadtbezirke (lat. civitates) mit ihren Stadträten (lat. curiae), die sich aus der lokalen grundbesitzenden Oberschicht zusammensetzten, weitgehend intakt. Die Ratsherren (lat. curiales) waren weiterhin für die kommunale Selbstverwaltung ihrer Gemeinden und das Einziehen der Steuern zuständig. In den städtischen Archiven (lat. gesta municipalia) wurden nach wie vor Bürger- und Steuerlisten geführt sowie Urkunden und Verträge aller Art hinterlegt.
In dem sich Eurichs Herrschaftsgebiet aus dem Verband des Weströmischen Reiches löste, waren dessen römische Bewohner keine Reichsangehörigen mehr. Sie unterstanden nicht länger der kaiserlichen Rechtsprechung, gleichwohl aber Römischem Recht. Das Zusammenleben zwischen den verschiedenen Bevölkerungsteilen musste auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt werden. Hierzu diente eine leider nur fragmentarisch erhaltene, Eurich zugeschriebene und daher als Codex Euricianus bezeichnete Gesetzessammlung. Die darin enthaltenen Bestimmungen sollten vor allem die sich aus der Ansiedlung ergebenden erb- und vermögensrechtlichen Streitfragen klären, deren Regelung nicht von Römischem Recht abgedeckt wurde.
Vorgesehene Rechtsmittel und Terminologie legen nahe, dass die Gesetzessammlung von römischen Juristen redigiert worden ist. Diese orientierten sich am römischen Vulgarrecht, einer vereinfachten Form des Römischen Rechts, wie es unter Berücksichtigung lokalen Gewohnheitsrechts in den Provinzen angewandt wurde. Der Einfluss des Römischen Rechts kann angesichts der römischen Strukturen in Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung, in die die Goten mit ihrer Ansiedlung in Aquitanien eingetreten waren, nicht überraschen. Insofern ist der Codex Euricianus ein Zeugnis für die Akkulturation der Westgoten.
Einblicke in die Sozialstrukturen des Tolosanischen Reiches gewähren die Quellen kaum, ebenso wenig in die Strukturen arianisch-homöischen Kirche, der Eurich und der überwiegende Teil seines Verbandes angehörten. Der Arianismus, benannt nach dem alexandrinischen Priester Arius, verneinte die Wesensgleichheit von Gott Vater und Sohn. Im Rahmen ihrer Kontakte mit der römischen Welt im 4. Jh. im unteren Donauraum hatten die Goten das Christentum in seiner arianisch-homöischen Form angenommen, der damals im Osten des Reiches dominierenden christlichen Strömung, die im Westen jedoch niemals Fuß zu fassen vermochte.
Eurich herrschte über ein Gebiet mit einer überwiegend katholischen Bevölkerung und einer etablierten Kirchenorganisation, die wiederum auf den Grenzen und Strukturen der römischen Verwaltungseinheiten beruhte. So standen die Bischöfe ihren Gemeinden und Klerikern vor, verwalteten das stetig anwachsende Kirchenvermögen, und waren für Liturgie und karitative Aufgaben zuständig. Sie besaßen in Form des Bischofsgerichts (lat. audientia episcopalis), einer Art Schiedsgerichtsbarkeit, darüber hinaus Kompetenzen in der Rechtsprechung und wirkten an der kommunalen Selbstverwaltung ihrer Stadt mit.
Die katholischen Bischöfe besaßen somit eine große Machtfülle, die weit über die geistlichen Aufgaben hinausging. Über sie konnte die Reichsregierung mit ihrem „rechtgläubigen“ Kaiser weiterhin Einfluss auf die römische Bevölkerung in den von den arianischen, und damit „häretischen“, Goten beherrschten Gebieten nehmen. Die katholische Kirche war somit sowohl ein potentieller Kristallisationspunkt des Widerstands gegen die westgotische Herrschaft als auch ein Hort römischer Identität. Den Einfluss des katholischen Episkopats wollte Eurich beschneiden, indem er ihm unbequeme Bischöfe ins Exil schickte und die Neubesetzung vakanter Bistümer verschleppte.
Alarich II. (484-507) – seines großen Vaters glückloser Sohn?
Eurich starb Ende 484 in Arles. Die Nachfolge trat sein Sohn Alarich an, der in der Forschung nicht gut gelitten ist. Unfähig habe er das Erbe seines großen Vaters verspielt, dessen Reich doch das mächtigste im Westen der einstigen römischen Welt gewesen war. Diese Einschätzung ist von seinem tragischen Ende her gedacht, das bis heute die Erinnerung an ihn überschattet, und verkennt die Erfolge seines politischen Handelns.
Alarich II. vermochte lange Zeit erfolgreich dem Expansionsdrang seines großen Rivalen, des Frankenkönigs Chlodwig, einen Riegel vorzuschieben. Zwar konnte er nicht die Zerstörung des Reiches des Syagrius, Sohn des oben erwähnten Aegidius, nördlich der Loire um Soissons durch die Franken verhindern, erwies sich aber durchaus als fähiger Militär. Alarich unterstützte Theoderich den Großen, dessen Tochter er heiraten sollte, in Italien militärisch und verhalf ihm 490 mit seinem Sieg über Odoaker in der Schlacht an der Adda zur Herrschaft über Italien, denn Theoderichs Gegenspieler verschanzte sich fortan bis zu seinem Ende in Ravenna. In den 490er Jahren gelang es ihm mehrfach, fränkische Vorstöße in das Gebiet südlich der Loire zu parieren, sodass Chlodwig um 500 im Vertrag von Amboise die Loire als Grenze akzeptieren musste. Damals konnte Alarich auch den Sturz des Burgunderkönigs Gundobad durch dessen Bruder Godegisel verhindern, der wiederum von Chlodwig unterstützt worden war. Im Norden der Iberischen Halbinsel gelang es ihm, mehrere Aufstände niederzuwerfen und so die spanischen Territorien fester an das Westgotenreich zu binden.
Alarich vermochte das Kräftegleichgewicht in Gallien lange Zeit aufrechtzuerhalten. Innenpolitisch beschritt er den von seinem Vater gewiesenen Weg zur Konsolidierung des Reiches weiter. Er ließ von einer Kommission römischer Rechtsgelehrter die sogenannte Lex Romana Visigothorum (auch als Breviarium Alaricianum bezeichnet) erarbeiten, die fortan im Westgotenreich gültige Form des Römischen Rechts. Es handelte sich hierbei um eine Neubearbeitung des 438 publizierten Codex Theodosianus, der an die Gegebenheiten im Reich Alarichs angepasst wurde.
Gesetze, die den aktuellen Verhältnissen nicht länger entsprachen, wurden ebenso kassiert wie gegen die arianisch-homöische Kirche gerichtete Bestimmungen und ein kaiserlicher Erlass, der die Obergewalt des Bischofs von Rom in der Kirche festschrieb. Alarich wollte die katholische Kirche in seinem Reich aus der Jurisdiktion des Bischofs von Rom herauslösen und als Körperschaft eigenen Rechts legitimieren. Im Jahr 506 trat in Agde eine Synode des gallischen Episkopats aus dem Herrschaftsbereich der Westgoten zusammen, um praktische Fragen des kirchlichen Zusammenlebens zu regeln.
Die Lex Romana Visigothorum besaß Gültigkeit für den römischen Bevölkerungsteil im Tolosanischen Reich. Ihr Verhältnis zum Codex Euricianus ist in der Forschung umstritten, da nicht klar ist, ob sich die Gesetzessammlung Eurichs nur an die nichtrömischen Bevölkerungsgruppen richtete oder auch für die Römer Geltung hatte, indem sie Streitfälle zwischen beiden Bevölkerungsgruppen regeln sollte, für die im Römischen Recht keine Bestimmungen vorgesehen waren.
Die Lex Romana Visigothorum und die Synode von Agde werden von der Forschung mitunter als Zugeständnisse Alarichs an die römische, mehrheitlich katholische Bevölkerung und an den katholischen Episkopat seines Reiches gewertet. Es handle sich um den Versuch des Arianers Alarich, der Absicht Chlodwigs, der den katholischen Glauben angenommen hatte, die Spitze zu nehmen, religiöse Spannungen zwischen den Bevölkerungsteilen im Reich von Toulouse für seine Expansionspläne auszunutzen. Diese auch heute noch in der Literatur anzutreffende Ansicht dürfte aber fehlgehen, denn sowohl die Lex Romana Visigothorum als auch die Synode von Agde waren eher das Ergebnis eines längeren Entwicklungsprozesses denn eine hastige Reaktion auf die Pläne Chlodwigs – eine Entwicklung, die durch die folgende bewaffnete Auseinandersetzung mit den Franken freilich überholt wurde.
Im Jahre 507 überschritten die Truppen Chlodwigs die Loire bei Tours und vernichteten das Heer Alarichs II. nahe Poitiers in der Schlacht bei Vouillé (campus Vogladensis). Alarich fiel. Sein Schwiegervater, Theoderich der Große, der ihm militärischen Beistand zugesichert hatte, vermochte nicht rechtzeitig einzugreifen. Theoderich gelang es lediglich, einen schmalen Küstenstreifen zwischen Arles und Narbonne bzw. den Pyrenäen vor dem Zugriff der Franken zu bewahren. Alarichs Nachfolge trat sein unehelicher Sohn Gesalech an.
Der Schwerpunkt des Westgotenreiches sollte sich im 6. Jh. nach dem weitgehenden Verlust der gallischen Gebiete auf die Iberische Halbinsel verlagern, wo es bis 711 fortbestand. Über die Ursachen des westgotisch-fränkischen Konfliktes geben die Quellen nur vage und widersprüchlich Auskunft. Die überlieferten Gründe reichen von dem vermeintlichen Wunsch des „rechtgläubigen“ Chlodwig, die katholische Bevölkerung Galliens vom Joch „häretischer“ Unterdrückung zu befreien, über den schlichten Expansionsdrang der Franken bis hin zu wirtschaftlichen Ursachen. Was auch immer den Anlass für den Krieg bot, bereits den Zeitgenossen galt die Niederlage Alarichs bei Vouillé als das Ende des Tolosanischen Reiches. So heißt es in einer anonymen Quelle aus Saragossa, dass das Tolosanische Reich damals zerstört worden sei: regnum Tolosanum destructum est (Cons. Caesaraug. 88a).
Resumée – Was blieb?
Das Westgotenreich von Toulouse war im ausgehenden 5. Jh. das mächtigste unter den Nachfolgereichen im Westen der einstigen römischen Welt. Sein rascher Aufstieg vollzog sich im Windschatten der Erosion des Römischen Reiches im Westen, wobei das Westgotenreich nicht bloß Zuschauer, sondern Akteur war. Seine Macht beruhte auf der Verbindung des militärischen Potentials der Goten mit den enormen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ressourcen der mächtigen südgallischen Senatsaristokratie. Gerade das südliche Gallien mit seinen Verbindungen zum Mittelmeerhandel war auch noch im 5. und 6. Jh. wirtschaftlich stark. Zudem blieben in den Gebieten südlich der Loire und in der Provence länger als anderswo in Gallien die römischen Verwaltungs-, Sozial- und Wirtschaftsstrukturen intakt.
Das schnelle Auseinanderfallen des gallischen Westgotenreiches ist für den modernen Betrachter daher umso überraschender, wohl aber nicht für die Zeitgenossen. Bereits Theoderich der Große hegte Zweifel an der Schlagkraft des Heeres seines Schwiegersohnes, die in der Friedensdekade nach 500 nachgelassen habe (Cassiod. Var. 3.1.1). Das rasche Auseinanderbrechen des Tolosanischen Reiches infolge der Niederlage bei Vouillé mag dem Umstand geschuldet sein, dass die Verluste an Kriegern zu groß waren, um den Franken weiterhin Widerstand leisten zu können, sodass es nicht verwundert, dass sich Gesalech auf die Verteidigung befestigter Plätze verlegte. Vielleicht vermochte es der keineswegs unumstrittene Nachfolger Alarichs II. auch nicht, die westgotischen Kräfte für eine Erneuerung zu bündeln.
Was blieb vom Tolosanischen Reich im Mittelalter? Der schmale Streifen an der gallischen Mittelmeerküste, den Theoderich der Große vor dem Zugriff der Franken bewahren konnte, sollte den Namen Gothia annehmen und bis weit ins Mittelalter hinein behalten. Seine Bewohner hießen bis ins Hochmittelalter Goten (lat. Gothi). Das eigentliche Erbe des Tolosanischen Reiches ist aber im Bereich des Rechtswesens zu sehen. Der Codex Euricianus wurde zur Quelle für andere frühmittelalterliche Stammesrechte wie das der Bayern und Burgunder. Die Lex Romana Visigothorum vermittelte dem Abendland die Kenntnis des Römischen Rechts. Bis in das 8. Jh. war das Römische Recht nur in der in ihr überlieferten Form bekannt.