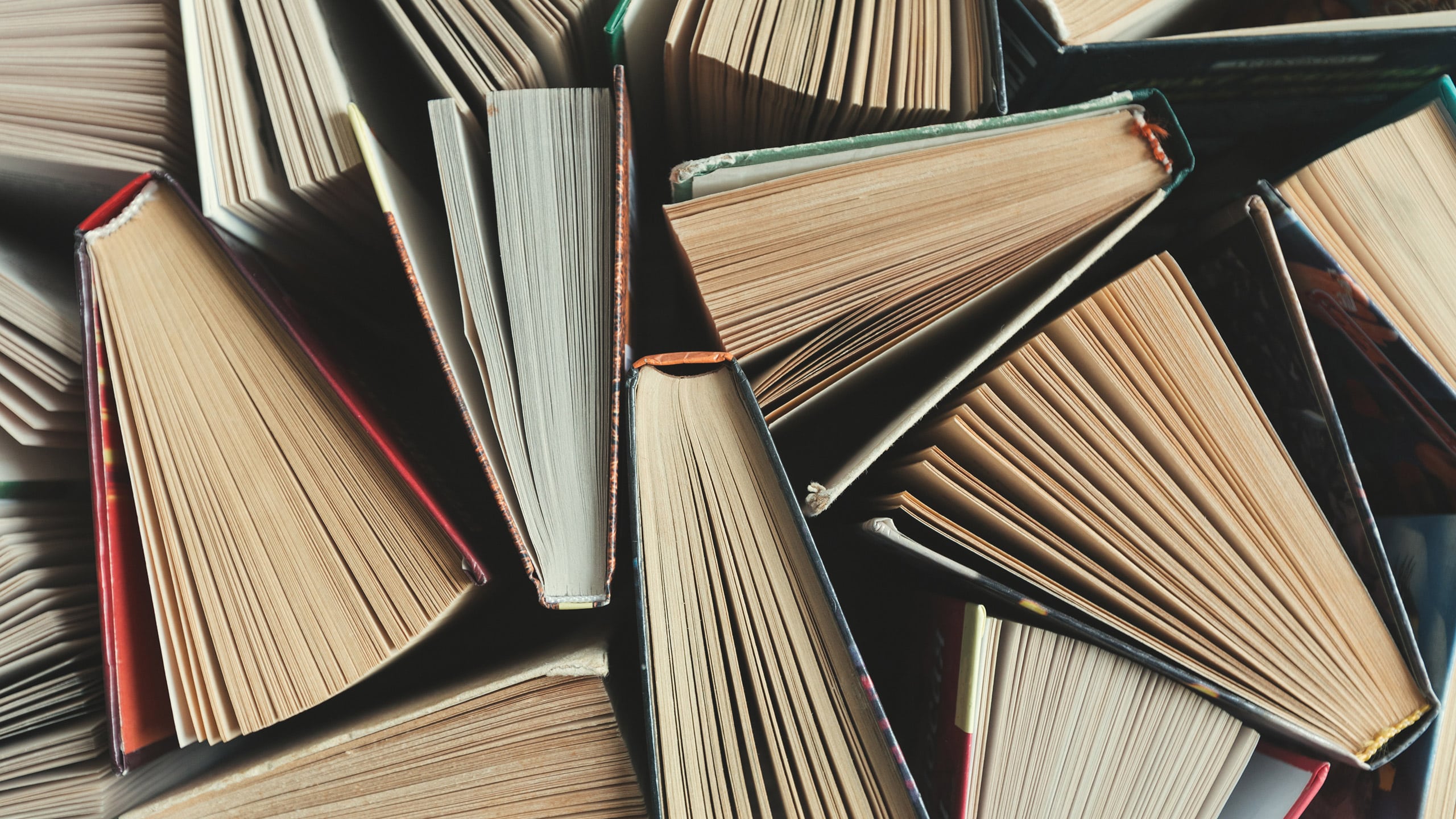Das kürzeste und vernichtendste Urteil über den literarischen Naturalismus stammt von Nietzsche und lautet „Gorgon-Zola“. Er sei „jetzt“, nämlich im Jahre 1881, als Emile Zola im Laufe mehrerer Jahre den Romanzyklus „Die Rougon-Marquart“ herausbrachte, „der geistige Nachtisch … für Viele“. „Zola: oder ‚die Freude zu stinken‘“ heißt es in der „Götzen-Dämmerung“. Die pure, krude Wirklichkeit ist hässlich, schmutzig, finster, niederdrückend. „Pessimismus in der Kunst?“ ist eine Nachlass-Aufzeichnung des Schopenhauer entwachsenen größten seiner Schüler überschrieben. Antwort: „Es gibt keine pessimistische Kunst.“ Kunst „ist wesentlich Bejahung, Segnung, Vergöttlichung des Daseins.“ Der 1978 aus der Lüneburger Heide zum Studium nach München gekommene zweiundzwanzigjährige Hans Pleschinski will, so liest man in seinem autobiographischen Roman „Bildnis eines Unsichtbaren“, „Samuel Beckett überwinden“. Er ist entschlossen, sein „Leben nicht als … Absurdität anzunehmen“, er will, ja er muss „die Auflösung besiegen“. „Man muß Geschichten erfinden, die über den Abgrund führen.“
Das ist zugleich ein literarisches und ein Lebensprogramm. Hat er es eingelöst? Die Frage drängt sich vierzig Jahre später dem Leser des überwältigend umfangreichen Werks dieses Schriftstellers auf. Natürlich hat Pleschinski nicht Beckett überwunden, für den dasselbe gilt wie für Dostojewski, den Nietzsche als „erlösend“ bezeichnet. Es geht um Aufhebung in der zwar abgedroschenen, aber doch recht brauchbaren dreifachen Bedeutung von Ungültigmachung, Aufbewahrung und Sublimierung. Aufhebung der miesen Wirklichkeit durch Kunst.
Die existiert nicht nur als Erzählung, auch als bildende. Das Bekenntnis des Zweiundzwanzigjährigen mündet in den bezeichnenden Satz: „Lieber ein fragwürdiges Versailles als sich schweigend aufhängen.“ Vier Jahre vorher war er nach der Lektüre Rimbauds nach Paris aufgebrochen. Im ersten Roman „Nach Ägyppten“ von 1984 – das doppelte p macht das Land zum Mythos – spiegelt sich diese lebensentscheidende Zäsur im leichtfüßigen Verlassen des kleinstädtischen Elternhauses seines Helden, des Abiturienten Frank. Mit einem Freund, wir sind wieder beim autobiographischen Ich, entdeckt Pleschinski Versailles. Der über einem Sumpf errichtete Palast wird zur „Offenbarung“, zum „Beweis, daß das Leben ein Fest sein konnte“. „Versailles war die Utopie, sich nicht fallenzulassen, sich – mochte das Universum unendlich und schwarz sein – in seiner Einmaligkeit wahrzunehmen.“ Von hier führt eine ziemlich gerade Linie zu den aus Rundfunksendungen hervorgegangenen Essays in dem 1997 erschienenen Band „Byzantiner und andere Falschmünzer“, aus dem Lichter auf derlei Realisierungen von verstiegenen Schönheitsträumen fallen. Versailles, seine Ludwige, der Hofstaat mit seinen Mätressen, Herzögen, Dichtern bieten ein höchstes Beispiel. Hier entspringt die kreative Liebe des Autors Pleschinski zum Barock, seiner Musik, seiner Dichtung (etwa dem Riesenwerk eines Daniel Casper von Lohenstein), hier rühren wir an den Impuls zur Übersetzung der Briefe von Madame Pompadour und des „Geheimen Tagebuchs des Herzogs von Croy“ mit dem Titel „Nie war es herrlicher zu leben“. Versailles ist Vorbild. Schon viel früher war dem Cellenser das Schloss seiner Geburtsstadt zum Inbegriff von höherer Lebensart geworden, wenig später dem an der Grenze zur DDR Aufwachsenden die barocke Hochkultur Dresdens begegnet. Dresden wurde zum Hauptanziehungspunkt seiner „Ostsucht“, das Buch mit diesem Titel kam 1995 heraus, und die gar nicht selbstverständliche Tatsache, dass nicht Augusts Sachsen, sondern Friedrichs Preußen den Kampf um die Vorherrschaft gewann, erscheint den Augen des Jugendlichen als Katastrophe, ohne die Dresdens entsetzliche Zerstörung möglicherweise unterblieben wäre. Die liebenswürdigste Huldigung eines Versailles auf deutschem Boden hat die aller instrumentellen Vernunft ins Gesicht schlagende, von vornherein dem Untergang geweihte babylonische Schlossanlage des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel in Pleschinskis Büchlein „Der Holzvulkan“ gefunden, von der schon deswegen kein Stein auf dem andern blieb, weil sie mangels vorhandener Mittel, das Territorium des Herzogs war winzig, eben nur aus einem die Marmorherrlichkeit vortäuschenden Holz gebaut werden konnte.
„Wiesenstein“ heißt Pleschinskis jüngstes großes Buch. Auch so ein Ort des ins Festliche erhobenen Daseins. Aber ist nicht der geistesfürstliche Bewohner dieser im Riesengebirge erbauten Trutzburg, ist nicht Gerhart Hauptmann der wichtigste Repräsentant der deutschen Variante des Naturalismus, sozusagen ein schlesischer Emile Zola? Das stimmt natürlich, soweit es den Dichter der „Weber“, der frühen Mitleidsdramen angeht. Aber mit „Hanneles Himmelfahrt“, mit „Und Pippa tanzt“ ist aus dem Naturalisten ein Symbolist, ja ein Mystiker geworden. Man könnte im Hinblick auf Hauptmann geradezu von einer Selbstüberwindung des Naturalismus sprechen.
Das gilt auch umgekehrt: Man kann den Realismus nur durch Realismus überwinden. „‘Wiesensten‘“, sagt Pleschinski, „sollte so wenig wie möglich Erfindung sein, das wäre Verrat am Wirklichen gewesen.“ Und so trifft man im Werk dieses Autors überall auf die Meisterschaft realistischer Erzählung. Aber dabei bleibt sie – die Meisterschaft – nicht stehen. Die Erzählung wird an einen Punkt getrieben, an dem das mythische Muster hinter der vordergründig exakt wiedergegebenen Wirklichkeit hervortritt. Und genau darin liegt ihre Aufhebung. So erscheint im Aufbau des frühen Romans „Brabant“ (1995) die Komposition der von Mozart bearbeiteten Händel-Oper „Acis und Galatea“. Und der im Grand Hotel Breidenbacher Hof zu Düsseldorf im August 1954 spielende Roman „Königsallee“ von 2013 führt den Leser zugleich in das Jahr 1816 und den Weimarer „Elephanten“; die erzählte Begegnung Klaus Heusers mit dem von seiner mittlerweile längst verwelkten Jugendblüte einst hingerissenen Thomas Mann entpuppt sich als Parallelaktion zu dessen Roman „Lotte in Weimar“. Das ist jedoch viel mehr als Anspielung, Pastiche, Intertextualität. Es ist die Aufhebung des Einmaligen im Mythischen. Sichtbar wird Zeitloses: Leiden und Größe der Meister, das Verhältnis der Kunstfigur zu ihrem Modell, das Illusionäre der Liebe, in diesem Fall der homoerotischen.
Unablässig ist die Realität am Werk, die Inszenierung der ihr abgerungenen Lebensfestlichkeit zu stören, zu zerstören. Die erste Halbzeile von Schillers „Nänie“: „Auch das Schöne muß sterben“, die erste Halbstrophe von Platens „Tristan“: „Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, / ist dem Tode schon anheimgegeben“ stehen über allen künstlerischen Versuchen, dem Trüben, Traurigen, Trostlosen eines restlos in der Wirklichkeit aufgehenden Daseins zu entrinnen. „Ich stand starr vor den Trümmern des Schlosses, der Frauenkirche, dem finsteren Gemäuer der Semperoper“, erinnert sich Pleschinki an das Dresden der Sechzigerjahre. Und er fragt: „Wieso ist solche Schönheit gepaart mit solchem Grauen?“
„Wiesenstein“ beginnt mit einem Ende: Der von Alter und Todesnähe gezeichnete Gerhart Hauptmann kehrt unter chaotischen Umständen aus dem zerstörten Dresden in sein noch immer prunkvolles Gehäuse zurück. Der Roman erzählt dann auf erschütterndste Weise den Untergang eines ganzen Landes: Schlesiens. Schönheit kann vor der Vernichtung am wenigsten gerettet werden durch Beschönigung. Aber der Held des Buches ist ein großer Dichter. In der Vergegenwärtigung weniger seiner Person als seines Werks und seiner Hingabe an dieses öffnet sich ein vielleicht nur sehr schmaler Ausweg aus dem Grauen. „In jedem Menschen schläft ein Tanz“, lautet eine der Maximen, die der Dichter nachts auf der Wand seines Schlafzimmers notiert. Diesen Tanz aus seinem Schlaf zu wecken oder wenigstens seinen Rhythmus hörbar zu machen, ist des Erzählers Hans Pleschinski magische Fähigkeit. Die zwanzig Selbstmordkandidaten in seinem Roman „Ludwigshöhe“ (2008) gewinnen im erzählenden Austausch ihrer scheinbar ausweglosen Lebensgeschichten die Basis für ein neues Hier- und Jetztsein.