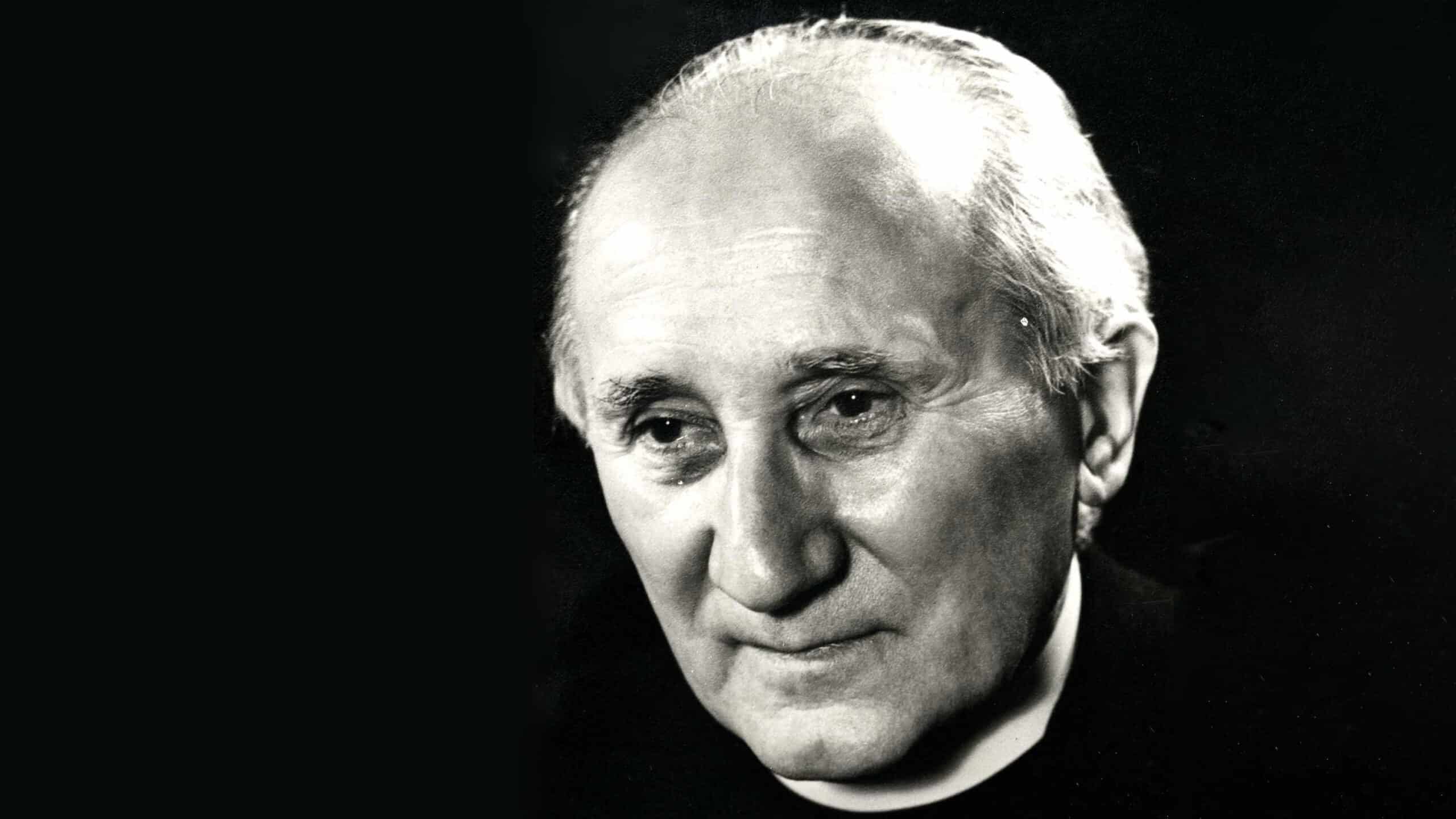Guardinis Ende der vierziger und in den fünfziger Jahren veröffentlichte Schriften kreisen um zwei thematische Schwerpunkte: das Ende der Neuzeit und die Macht. Die Verschränkung der beiden Themen spiegelt sich im Untertitel der in einem Band vereinigten Texte wider, von denen jeder einem der Brüder Guardinis gewidmet ist. The end of the modern era ist „ein Versuch zur Orientierung“ und The power der „Versuch einer Wegweisung“. Man kann diese „Versuche“ nur würdigen, wenn man ihr Genus litterarium berücksichtigt. Es sind keine theoretischen und systematische Abhandlungen, sondern, wie der Titel zweier 1957 in Würzburg gehaltener öffentlicher Vorträge nahelegt, „Zeitreden“, wozu auch die anlässlich der Verleihung des Erasmus-Preises gehaltene Rede „Warum ich ein Europäer bin?“, gehört.
Für eine philosophische Bewertung von Guardinis Ansatz ausschlaggebend ist, dass eine philosophische Analyse des vielschichtigen Phänomens der Macht mindestens vier anthropologische Begriffe ins Spiel bringt: „Macht“ (potestas), „Autorität“ (auctoritas), „Herrschaft“ (dominium) und „Gewalt“. Jeder dieser Begriffe lässt sich anhand eines Gegenbegriffs verdeutlichen: „Macht“ versus “Ohnmacht“; „Autorität“ versus “Kritik“; „Herrschaft“ versus “Knechtschaft“; „Gewalt“ versus “Gewaltlosigkeit“.
Das Ende der Neuzeit: Ist Guardini ein Wegbereiter der Postmoderne?
Guardinis Besinnung über das Ende der Neuzeit hebt mit einem kurzen Vergleich des Daseinsgefühls und des Weltbilds des Mittelalters und dem der heidnischen Antike an. „Der antike Mensch geht nicht über die Welt hinaus“ und verspürt auch kein Bedürfnis nach einer solchen Grenzüberschreitung. Ihm fehlt gleichsam der Hebel, „dessen er zu einem solchen Versuch bedürfte“ (S. 11). Obwohl seine Welt ein wohlgeordneter Kosmos ist, ist sie zugleich der Kampfplatz mythischer „Mächte und Gewalten“. Der frühe Mensch empfand „das ganze Dasein als von geheimnishaften Mächten durchwaltet“ (S. 128), denen er schutzlos und nahezu ohnmächtig ausgeliefert war, so dass sich erst allmählich neue Formen des Könnens herausbildeten, die „Macht sind und deren Ausübung Herrschaft ist“ (S. 129).
Manche Stellen in den Paulusbriefen deuten an, dass die erste Generation der Christusgläubigen sich auf einem Kampfplatz bewähren musste, auf dem sie „nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt“ (Eph 6, 12) kämpfen. Weil Christus der Pantokrator „das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht“ (Kol 2, 10b) ist, spricht der Apostel unermüdlich den Gläubigen Mut zu: „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Rm 8,38–39).
Auch wenn die Rede von den „Mächten der Finsternis, die diese Welt beherrschen“, und von den „bösen Geistern in der Himmelswelt“ in mythischen Vorstellungen wurzelt, beweisen diese Texte, dass „Macht“ kein beliebiges Thema für den christlichen Glauben ist.
Das entscheidende Motiv in Guardinis Darstellung des mittelalterlichen Weltbildes ist eine neue Freiheit, „die über die Welt hinaus zu Gott emporsteigt „um sich von Ihm her zur Welt zurückzuwenden und sie zu formen“ (S. 17). „In te supra me“: Die berühmte Formel des Heiligen Augustinus liefert uns einen Schlüssel für Guardinis Verknüpfung zweier Pole der menschlichen Existenz: der Aufblick zur Höhe des welttranszendenten Schöpfers und das Untertauchen in den abgründigen Seelengrund des Menschen. Für ihn ist die „mittelalterliche Anthropologie „im Grundlegenden wie im Ganzen gesehen, der neuzeitlichen überlegen“ (S. 21), auch wenn dem mittelalterlichen Denken der „Wille zu empirisch-exakter Wirklichkeitserkenntnis“ fehlt.
Zwar erwähnt er den Kampf zwischen Kaiser und Papst, aber seines Erachtens war er im letzten kein Streit „um äußerlich-politische Macht, sondern um die Einheit der Daseinsordnung“ (S. 22). Blickt man auf die Anstrengungen eines Wilhelm von Auvergne, eines Duns Scotus oder Wilhelms von Ockham um den Begriff der potestas zu klären, kann man sich fragen, ob das Problem der politischen und der geistigen Macht in Guardinis Darstellung des „mittelalterlichen Grundwillens“ (S. 27) nicht zu kurz kommt.
Die Besinnung über das Ende der Neuzeit war ursprünglich als Einleitung zu einem Kolleg über Blaise Pascal konzipiert, jener neuzeitliche Denker, dem Guardini sich besonders geistesverwandt fühlte, weil Pascal, im Gegensatz zu Descartes sich bereits in der Entstehungsfülle der Neuzeit kritisch mit ihr auseinandersetzte. Hüten wir uns indessen davor, Pascals missverständliches Wort vom „nutzlosen und unsicheren Descartes“ („Descartes inutile et incertain“, Fr. 78), Guardini in den Mund zu legen!
Etwas näher an den wunden Punkt rührt das anschließende Fragment Pascals: „Ich kann es Descartes nicht verzeihen: Er wäre in seiner ganzen Philosophie gerne ohne Gott ausgekommen, aber er gab ihm dennoch einen kleinen Stups, um die Welt in Bewegung zu setzen, woraufhin er nicht mehr wusste, was er mit ihm anfangen konnte.“
Dass dieser polemische Spruch dem Grundanliegen von Descartes‘ philosophischer Theologie in keiner Weise gerecht wird, hat Jean-Luc Marion in seinen Untersuchungen über Descartes‘ „weiße Theologie“ und sein „metaphysisches Prisma“ nachgewiesen.
Guardinis Analyse des neuzeitlichen Weltbildes arbeitet drei Grundelemente heraus: Die „in sich ruhende Natur“, das „autonome Persönlichkeitssubjekt“ und die „aus eigenen Normen schaffende Kultur“, sind drei innerlich zusammenhängende und sich gegenseitig bedingende Aspekte eines neuen Daseinsgefühls, das sich auf die Eigenart der modernen Wissenschaft stützt, aufgrund derer der Erkenntnistrieb sich unmittelbar der Wirklichkeit der Dinge zuwendet, sowohl die der äußeren Natur, wie die der geschichtlichen Ereignisse und der gesellschaftlichen Strukturen.
In den von Guardini betonten drei Merkmalen steht das, was Hans Blumenberg als die „Legitimität der Neuzeit“ bezeichnet, auf dem Spiel. Vergleicht man beide Ansätze miteinander fällt auf, dass Guardini, im Gegensatz zu Blumenberg oder neuerdings zu Charles Taylor, sich kaum mit dem Begriff „Säkularisierung“ befasst.
Ebenso wie für Blumenberg und für Alexandre Koyré, hat seines Erachtens die Genesis der kopernikanischen Welt so weitreichende Folgen, dass man sie nicht auf ein isoliertes Stück der neuzeitlichen Kosmologie reduzieren kann. Das kosmologische Unendlichkeitserlebnis, in dem die Welt sich für die Unendlichkeit des Universums öffnet, hat die Ortlosigkeit Gottes und die des Menschen zu Folge. Für den neuzeitlichen Menschen gibt es „keine Höhe und kein Droben mehr“ (S. 42), wodurch auch der Mensch „ins Irgendwo“ (S. 44) gerät. In dieser kritischen Situation erwachen die Uraffekte mächtiger: „die Angst, die Gewalttätigkeit, der Besitzwille, die Auflehnung gegen die Ordnung“ (S. 45).
Guardinis diesbezügliche Zeitdiagnose ist wiederum stark von Pascal inspiriert. Im selben Maße, wie der Mensch sich der Größe seiner Macht bewusst wird, wächst das Gefühl seines Elends. „Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie“ („Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich“). Die Interpreten dieses berühmten Fragmentes streiten darüber, ob Pascal diese Worte einem Ungläubigen in den Mund legt, oder ob es sich um den Stoßseufzer eines christlichen Wissenschaftlers handelt. Der Vergleich mit anderen Fragmenten bestätigt, dass Pascal das Erschrecken über das Elend des Menschen und seine Ortslosigkeit in einem stummen Universum häufig heimsuchte, was gewiss auch auf Guardini zutrifft.
Seine Analyse der neuzeitlichen Geisteshaltung rückt das Problem der Macht in den Vordergrund, sowohl die Macht der modernen Wissenschaft und Technik wie die der als „Kampf geschichtlicher Machteinheiten, Erwerb und Ordnung von Macht“ (S. 31) verstandenen Politik.
Der neuzeitliche Mensch strebt nach einer immer größeren Macht über die Natur. Hierzu befähigen ihn die moderne Wissenschaft und die eng mit dieser verknüpften Technik. Das Neue an der Neuzeit ist, dass die „Wissenschaft als rationale Erfassung der Wirklichkeit und die Technik als Inbegriff der durch die Wissenschaft ermöglichten Wirk-Anordnung dem Dasein einen neuen Charakter geben, wodurch Macht und Herrschaft einen akuten Charakter erhalten“ (S. 131).
Zum Beleg hierfür wird häufig ein Passus aus dem Discours de la méthode angeführt, in dem Descartes erläutert, welche Rolle die Physik in seinem Denkweg gespielt hat, und was man folglich von ihr erwarten kann: Im Gegensatz zur spekulativen Philosophie hat sie einen praktischen Nutzen, der darin besteht, dass die Erkenntnisse der modernen Physik uns „gleichsam zu Herrschern und Besitzern der Natur“ („nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature“) machen.
Hier muss man freilich genau lesen und das Gewicht des „gleichsam“ in der Formel „comme maîtres et possesseurs de la nature“ nicht übersehen. Descartes beansprucht keineswegs, Herrscher und Besitzer, folglich Ausbeuter der Natur zu sein. Seine Perspektive ist die des Gemeinwohls, das uns gebietet, unsere Kenntnisse nach Maßgabe des Möglichen („autant qu‘il est en nous“) in den Dienst einer besseren Lebensqualität zu stellen, wie der Hinweis auf die Arbeit des Mediziners verdeutlicht.
„Macht“: Versuch einer philosophischen Wesensbestimmung
Guardinis Wesensbestimmung der Macht fällt verhältnismäßig kurz aus.
1. „Macht“, umfassend verstanden, ist die Fähigkeit, Realität zu bewegen, ein Vermögen, das von zwei Vorbedingungen abhängt. Einmal die Existenz realer Energien, die an der Wirklichkeit der Dinge Veränderungen hervorbringen. Die Rede von den Schalthebeln der Macht, und der Vergleich der Machtzentren mit einem Schaltwerk sind keine unschuldigen Metaphern; sie spiegeln einen zentralen Aspekt des Phänomens wider. In der Wissenschaft, im kapitalistischen Wirtschaftssystem, besonders aber in der Politik ist das Streben nach Machterwerb, Machtbehauptung, Machtverwaltung und Machtsteigerung der treibende Motor. Machiavellis Il Principe und Hobbes’ Leviathan betrachten die Politik und den Staat aus derselben machtpolitischen Perspektive.
2. Das zweite, in anthropologischer Hinsicht auschlaggebende Merkmal ist ein spezifisches Machtbewusstsein, der instrumentale Wille, der Ziele setzt, und das Vermögen, die hierzu nötigen Kräfte zu mobilisieren. Macht ist niemals ein bloßer Naturvorgang. Weil es sich um ein spezifisch menschliches Phänomen handelt, spielt die „Sinngebung“ dabei eine entscheidende Rolle. „Die Initiative, welche Macht ausübt, setzt ihr selbst den Sinn“ (S. 103). Es gibt keine an sich sinn- und wertvolle, und deshalb auch keine nicht in die Verantwortung gestellte Macht.
Guardini betont die grundlegende Ambivalenz des Phänomens, das sowohl die Möglichkeit zum Guten und Positiven wie die Gefahr des Bösen und Zerstörenden in sich birgt. Jede einseitige Verherrlichung oder Verteufelung der Macht verkennt ihre Wesensart. „Der Sehfähige lacht nicht“ (S. 107), so Guardini. Er macht sich nicht über den Koloss mit tönernen Füssen lustig, denn im Umgang mit der Macht und in der Ausübung der Macht stehen zu viele ernste Dinge auf dem Spiel. Aus demselben Grunde wirft er sich nicht vor dem Machthaber wie vor einem Götzenbild nieder.
3. Das dritte Wesensmerkmal der Macht ist ihre Universalität, bzw. Ubiquität, die sich in unzähligen Erscheinungsformen äußert. In jedem Akt des Handelns und Schaffens, des Besitzens und des Genießens bekundet sich eine besondere Seinsmächtigkeit, für die der späte Heidegger den Ausdruck „Machenschaft“ prägte. Machtausübung und Machtgenuss gibt es überall und entsprechend vielfältig sind auch die Formen des Machtmissbrauchs.
Der „Entfaltung der Macht“ betitelte Abschnitt exemplifiziert diese knappe Wesensbestimmung anhand konkreter, hauptsächlich negativer Phänomene: skrupellose Ausbeutung der Ressourcen der Natur; Verwandlung des Werkzeugs in die Maschine; die Fabrik als Produktionsbereich des industriellen Zeitalters, und innerlich damit zusammenhängend die Figur des Arbeiters am Fließband, in der genialen Interpretation von Charlie Chaplins Modern Times; die zunehmende Ausdifferenzierung von Erkenntnis-, Wirk- und Erlebnisfeld, usw.
Guardini will diese mehrwiegend kritischen Analysen allerdings nicht im Sinn eines Kulturpessimismus à la Oswald Spengler verstanden wissen. Im Gegensatz zu vielen katholischen Denkern (z. B. Jacques Maritain) bestreitet er nicht die Legitimität der Neuzeit als solcher.
Um die philosophische Tragweite von Guardinis Ansatz sowohl positiv wie kritisch zu würdigen, sind drei Autoren besonders hilfreich.
1. In den fünfziger Jahren veröffentlichte Paul Ricœur, dem wir die französische Übersetzung von Guardinis Tod des Sokrates verdanken, mehrere wichtige Aufsätze zum Thema der Macht.
Ricœur zufolge ist die Gewaltlosigkeit im Sinne der Bergpredigt mehr als der Traum einer schönen Seele, der sich nicht in die Wirklichkeit übersetzen lässt. Weil die Gewalt sich in allen Phasen der Geschichte und allerorts bemerkbar macht, ist die Frage der Legitimität des Monopols der Staatsgewalt unausweichlich. In diesem Zusammenhang greift Ricœur seinerseits auf das mythische Motiv der „Mächte und Gewalten“ zurück, um daran zu erinnern, dass die Ordnung des Rechtstaats niemals selbstverständlich ist, sondern stets einer neuen rationalen Rechtfertigung bedarf.
Letzten Endes konfrontiert eine solche Besinnung uns mit dem Paradox des Politischen selbst. Die Politik stiftet zwischenmenschliche Beziehungen, die sich weder auf einen Klassenkampf noch auf ökonomische Zwänge reduzieren lassen. Der politische Gebrauch der Macht zieht spezifische Übel nach sich, die als solche diagnostiziert werden müssen, sei es auch nur, um besser zu verstehen, inwiefern das Hauptproblem des Staates das der Freiheit ist, und zwar im doppelten Sinn: Die Rationalität des Staates ermöglicht die bürgerliche Freiheit und die Freiheit leistet dem politischen Machthunger Widerstand, immer wenn es nötig ist.
2. „Immer deutlicher zeichnet sich ein Zustand ab, in welchem der Mensch die Natur aber zugleich der Mensch den Menschen, der Staat das Volk, das in sich laufende technisch-wirtschaftlich-staatliche System das Leben in der Gewalt hat“ (S. 139): Dieser Kernsatz Guardinis lenkt unseren Blick auf das Verhältnis von Macht und Gewalt, wofür Hannah Arendts 1970 publizierte, aber schon 1968, dem Todesjahr Guardinis, in Angriff genommene Schrift Macht und Gewalt, eine besonders wichtige Quelle ist. Auch sie war eine „Zeitrede“, in der Arendt sich im Blick auf die damaligen Studentenunruhen kritisch mit dem „Zauber des kollektiv gewalttätigen Handelns“ auseinandersetzte.
Arendt zufolge spielt der Hang zur Unterwerfung, der Trieb zum Gehorsam und der Schrei nach dem starken Mann in der menschlichen Psychologie eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie der von Nietzsche verherrlichte „Wille zur Macht“.
Macht entspringt der menschlichen Fähigkeit, sich handelnd mit anderen zusammenzuschließen und auf diese Weise neue Anfänge zu setzen und Initiativen zu ergreifen. Wäre der Mensch nur ein animal laborans, bzw. nur ein Werktätiger, bräuchte er sich nicht dem Problem der Macht zu stellen. Das tut er nur, insofern er ein zoon politikon, ein Gemeinschaftswesen ist.
Weil Macht, im Gegenteil zur Gewalt, zum Wesen aller staatlichen Gemeinwesen gehört, ist die Frage nach der Legitimität der damit verbundenen Sanktions-, Organisations- und Exekutivfunktionen unausweichlich und muss von jeder Generation neu gestellt werden. „Keine politische Führung“, so Arendt, „kann ungestraft Macht durch Gewalt ersetzen; und Macht kann sie einzig aus einer nicht deformierten Öffentlichkeit gewinnen. Gewalt kann zwar Macht „vernichten“, jedoch keine Macht „erzeugen“. Sobald die Macht gewalttätig wird, wird sie illegitim. „Wo Gewalt der Gewalt gegenübersteht, hat sich noch immer die Staatsgewalt als Sieger erwiesen. Aber diese an sich absolute Überlegenheit währt nur solange, als die Machtstruktur des Staates intakt ist, das heißt solange Befehle befolgt werden und Polizei und Armee bereit sind, von ihren Waffen Gebrauch zu machen.
3. Wenn wir Guardinis Satz: „der Mensch kommt mit allem, was er ist und hat, dem Zugriff der Macht zur Verfügung“ (S. 143) aus der Perspektive von Michel Foucaults Untersuchungen über die Überwachungs- und Strafmaßnahmen der modernen Gesellschaft betrachten, sind wir gezwungen uns neue, von Guardini kaum oder gar nicht erörterte Fragen zu stellen.
Foucault zufolge haben wir keinen Grund, die Macht nur im Blick auf das Monopol der legitimen Gewalt des Staates zu betrachten. Auch dort, wo keine uniformierten Ordnungshüter die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung überwachen, ist die Macht am Werk und bekundet sich in Form von technischen Möglichkeiten, im Kräftespiel der Kommunikation und der Machtverhältnisse, die gegenseitig aufeinander abgestimmt sind.
Die Macht als solche gibt es nicht. Sie ist weder eine Substanz noch ein Privileg der Herrschenden, sondern ein allgegenwärtiges plurale tantum, das sich innerhalb der unterschiedlichsten sozialen Beziehungen manifestiert. Daher die Dringlichkeit der Frage nach den konkreten Formen der Machtausübung. Nur eine „Mikrophysik der Macht“, kann ihr auf die Schliche kommen.
Im Gegensatz zur landläufigen Vorstellung ist die Macht nicht immer destruktiv; sie erfindet und schafft häufig neue Wirklichkeiten. Auch wenn Macht selten Frieden stiftet, ist sie nicht immer gewalttätig. Sie bezieht sich auf „freie“ Subjekte, denen mehrere Möglichkeiten des Handelns und mehrere Verhaltensweisen zur Verfügung stehen. Ihr wahres Wesen offenbaren nicht die zahlreichen Formen der direkten Gewaltanwendung, der Unterdrückung bzw. der Bestrafung, sondern der erfinderische Gebrauch komplexer Mechanismen der Belohnung, der Überwachung, der Bestrafung und der Disziplinierung.
Chaplins Diktator ist eine geniale Karikatur des Größenwahns, an dem manche Machtmenschen leiden. Trotzdem müssen wir uns Foucault zufolge davor hüten, den Größenwahn als das einzige Wesensmerkmal der Macht festzuhalten. Nicht immer macht die Macht wahnsinnig, ebenso wenig wie der Machtverzicht den Wissenschaftler auszeichnet. Macht produziert ihre eigene Wissensformen, ebenso wie umgekehrt Wissen eine Form der Machtausübung ist. Beide bedingen sich gegenseitig.
Foucaults Hinweise auf das komplexe und keineswegs univoke Räderwerk der Macht schärft unseren Blick für die neuen Formen der Macht im digitalen Zeitalter, von denen Guardini noch keine Ahnung haben konnte. Besonders eindrucksvolle Beispiele hierfür liefern uns die Überwachungskameras in einigen chinesischen Großstädten, die gute Bürger für ihr Verhalten belohnen und schlechte Bürger an den Rand der sozialen Existenz abdrängen. Orwells „Big Brother is watching you“ ist längst von den modernen Technologien überholt und eine handfeste und fauststarke Wirklichkeit geworden. Diese Entwicklungen sind umso bedenklicher, als wir uns im Zeitalter der „Big Data“ bereitwillig ausbeuten lassen und unsere persönlichsten Daten per Handy oder per Internet für obskure Manipulationen zur Verfügung stellen.
Das Medusenhaupt der Macht und die Sehkraft des Glaubens
Im Vergleich zu seiner verhältnismäßig kurzen Wesenskennzeichnung der Macht nimmt Guardinis anschließende theologische Betrachtung, die auf die „Sehkraft des Glaubens“ (S. 123) rekurriert, einen größeren Raum ein.
Seine „theologische Perspektive“ bringt wiederum drei Schlüsselbegriffe ins Spiel.
1. Das erste Stichwort lautet „Gottebenbildlichkeit“. In einem kurzen Kommentar zu Genesis 1 und 2 erinnert Guardini daran, dass Gott den Mensch dazu berufen hat, sich die Erde untertan zu machen und über Tiere und Pflanzen zu herrschen, nicht wie ein Diktator, sondern wie ein Gärtner und ein Hirt, der für das Gedeihen des ihm Anvertrauten verantwortlich ist.
Die Macht des Menschen betrifft nicht nur die äußere Natur, sie impliziert auch das eigene Leben des Menschen (S. 111) und damit das menschliche Selbstverständnis. Weil die Gottebenbildlichkeit ein Wesensmerkmal des Menschen ist, ist die Frage nach dem Gebrauch, den der Mensch von seiner Machtbegabung macht, unausweichlich. Seine Herrschaft kann nur als Gehorsam und Dienst verstanden werden, nämlich als Auftrag, die Menschenwelt in eine Freiheitswelt zu verwandeln, eben jene Welt, die das biblische Symbol des Gottesreiches ausdrückt.
Die Erzählung von der Erprobung und dem Sündenfall in Genesis 2 deutet an, dass der Mensch dem Auftrag, zur Herrschaft im weitesten Sinn zu gelangen „ebendadurch, dass er im Gehorsamsverhalten zu Gott bleibt und sie als Dienst versteht“ (S. 115), nicht gewachsen war, weil das durch die Schlange symbolisierte frevelhafte Begehren nach einer magischen Macht, etwa in Form des Namenszaubers, mächtiger als der Gehorsam gewesen ist.
Seitdem die Gottebenbildlichkeit mit einer Gottgleichheit verwechselt wurde, gibt es kein reines, „unschuldiges“ Verhältnis zur Macht mehr, weil die Möglichkeit des Machtmissbrauchs nicht nur wahrscheinlicher, sondern unausweichlicher als ihr rechter Gebrauch geworden ist.
2. Das zweite, für die theologische Perspektive entscheidende Stichwort entnimmt Guardini dem christologischen Hymnus im 2. Kapitel des Philipperbriefs. Es lautet: „Kenosis“. Sehr viel hängt hierbei davon ab, was man unter Erlösung versteht. Guardini übernimmt den Paulinischen Vergleich des ersten und des zweiten Adam. Für ihn, wie für Paulus, ist die Erlösung mehr als ein Flickwerk wie das eines Schusters, der einen abgetragenen Schuh neubesohlt. Der Akt der Erlösung ist ein Akt der Neuschöpfung, der sich in der Wirklichkeit des Menschen und der Dinge vollzieht.
Deshalb ist die Erlösungslehre nicht mit einer Weisheitslehre zu verwechseln, die vor der Selbstüberhebung und Selbstüberschätzung des Menschen warnt und ihn an seine unüberschreitbaren Grenzen erinnert. Die weisheitliche Forderung der Selbstbescheidung ist wesensverschieden von der christlichen Grundtugend der Demut, die nach Guardini, ganz im Gegensatz zu Nietzsche, nicht als Schwäche, bzw. als Ressentiment, sondern als Stärke interpretiert
werden muss.
3. Ihren hyperbolischen Ausdruck findet diese Einstellung im christologischen Hymnus des Philipperbriefs, der uns dazu einlädt, auch den Akt der Menschwerdung des Gottessohns als ursprünglichen Akt der Demut zu verstehen. Das hindert Guardini nicht daran, im Rückgriff auf seine Grundschrift Der Herr, das ganze Leben Jesu, seine Worte und seine Handlungen, als „ständige Übersetzung der höchsten Macht in die Form der Demut“ zu verstehen.
Die synoptischen Evangelien enthalten zahlreiche Hinweise auf die „exousia“, die seine Worte und Taten auszeichnete. Dass seine Demut die „Befreiung vom Bann der Macht aus der innersten Wurzel her“ (S. 124) impliziert, zeigt die Erzählung über die dreifache Versuchung, die Jesus am Anfang seiner Berufung siegreich besteht.
Sehen wir uns diesen Bericht näher an, fällt es nicht schwer, eine Beziehung zur Kantischen Trias der kulturell erworbenen Leidenschaften der Ehrsucht, der Herrschsucht und der Habsucht herzustellen. Weil Kant zufolge Leidenschaften „eigentlich nur auf Menschen“ gehen und folglich „auch nur durch sie befriedigt werden“, haben diese Neigungen, zu denen auch die Machtgier gehört, wohl den „Anstrich der Vernunft“, in Wirklichkeit aber handelt es sich um „Neigungen des Wahnes“ „welcher darin besteht: die bloße Meinung anderer vom Werte der Dinge dem wirklichen Werte gleich zu schätzen“.
Die Rede von einer Pathologie der Leidenschaften, an denen die Menschheit krank, darf uns freilich nicht daran hindern, uns mit Ricoeur zu fragen, ob diesen großen Süchten, in denen uns der Leidenschaftliche als ein Süchtiger erscheint nicht ein authentisches Suchen zugrunde liegt. Hinter der Pathologie („Sucht“) verstecken sich konstitutive Dimensionen („Sehnsüchte“) des Menschseins: Haben, Vermögen and Gelten, bzw. die ökonomische Sphäre des Besitzens, die politische Sphäre der Herrschafts– und Machtverhältnisse und die öffentliche Sphäre der Anerkennung. Auch wenn auf diesen Gebieten die Ausbeutung und Entfremdung nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind, bleibt ein Spielraum der Imagination übrig, die uns gleichsam ins Paradies zurückversetzen. Auch wenn der Adam des Paradiesgartens kein Großgrundbesitzer gewesen ist, war er doch Eigentümer einer Schafherde. Und auch wenn Adam und Eva sich noch nicht gegenseitig voreinander aufgespielt haben, so müssen sie doch wohl bereits einer gewissen Selbstschätzung fähig gewesen sein. Nur das Geld scheint im Paradies noch nicht im Kurs gewesen zu sein!
Lässt der entfesselte Prometheus sich noch bändigen? Ein Plädoyer für eine Ethik der Macht
Hauptbeleg für Guardinis Überzeugung, dass die Neuzeit im Wesentlichen zu Ende gegangen ist, ist unser gewandeltes Verhältnis zur Macht. Gerade weil „die Macht des Menschen … überall in unaufhaltsamem Steigen begriffen“ ist, tritt sie heute erst in ihr kritisches Stadium (S. 98). Hieraus folgert er – vielleicht etwas vorschnell –, dass „sich unser Zeitwille in seinem Wesentlichen nicht mehr auf den Machtzuwachs als solchen“ richtet. Sehr viel hängt davon ab, welche Bedeutung man mit diesem dunkeln Begriff des „Zeitwillens“ verknüpft.
Begnügen wir uns mit der nüchternen Feststellung, dass die Macht „uns fragwürdig geworden ist“, weil wir nicht mehr der Meinung sind, dass jede „Zunahme an Macht“ gleichbedeutend mit einer „Wertsteigerung des Lebens“ ist. In welcher Verkleidung die Machtmenschen auch auftreten mögen, kann man auf sie Nietzsches Wort von den gefährlichen und gefährdeten Menschen anwenden. Das neue Gefühl, „dass unsere steigende Macht uns selbst bedroht“ ist unbestreitbar. Der Hauptbeleg hierfür war für Guardini, wie für Arendt, das Menetekel der Atombombe.
Siebzig Jahre später stellt sich die Frage nach dem verantwortlichen Gebrauch der Macht mit neuer Dringlichkeit und in zahlreichen neuen Lebensbereichen. Weniger als je können wir uns um diese Frage herumdrücken. Guardinis Forderung nach einer „aus wirklicher Fühlung mit dem Phänomen aufgebauten Ethik der Macht“ (S. 148), und sein Ruf nach einer „Entscheidung des Geistes“ ist dringlicher als je, weil jede Vergrößerung der Verfügungsgewalt über die Welt uns zwingt, auf ein desto größeres Wagnis hin zu leben.
An eindringlichen Appellen zur Selbstbeschränkung der Macht herrscht kein Mangel. Vor fünfzig Jahren fragte sich Hans Jonas in seinem Prinzip Verantwortung, unter welchen Bedingungen der entfesselte Prometheus der Technik gebändigt werden kann. Die heutige Generation der Jugendlichen schenkt Greta Thunberg, dem schwedischen Gretchen am Spinnrad, Gehör. Auch die Papstenzyklika Laudato sí schreibt sich indiese Linie ein.
Heute wie früher verhält der hartgesottene Machtmensch sich wie das Rhinozeros in Eugène Ionescos Theaterstück. Er hat kein Gespür für die Verwundbarkeit der Menschen, die Verletzlichkeit der Dinge und die Gefahren, die mehr als je die Menschheit und die Umwelt bedrohen. Blicken wir auf das tatsächliche Gebaren der Machthaber in der Wirtschaft, der Politik oder in den Medien, dann haben wir allen Grund, uns zu fragen, ob diejenigen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, nicht an einer nahezu unheilbaren Schwerhörigkeit und Kurzsichtigkeit leiden. Hätten sie zur Zeit Jesu Christi gelebt, hätte er ihnen wohl ein schallendes „Ephatata“ zugerufen. „Mache Ohren und Augen auf, um zu hören und zu sehen, wie es um unsere Welt bestellt ist!“
Die „praktischen Gesichtspunkte“ (S. 181), die Guardini am Ende seiner Besinnung in Form eines vierfachen: „Wir müssen wieder…“ („etwas von dem verwirklichen, was kontemplative Haltung heißt“; „wieder die elementare Frage nach dem Wesen der Dinge stellen“; „wieder lernen, dass die Herrschaft über die Welt die Herrschaft über uns selbst voraussetzt“; „wieder im Ernst die Frage nach dem letzten Beziehungspunkt unserer Existenz, nach Gott stellen“; „die jeweilige Sache so zu tun, wie sie ihrer Wahrheit nach getan werden sein will“) ins Feld führt, gleiten an den Machthabern ab wie das Wasser am Gefieder einer Ente, weil diese Empfehlungen für sie nur die frommen Wünsche einer schönen Seele sind.
Am Schluss meiner Erwägungen möchte ich Guardinis praktische Anregungen durch ein fünftes „Wir müssen wieder…“ ergänzen. Ich formuliere es in Anspielung auf das Grimmsche Märchen Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ob es uns gefällt oder nicht: Wir müssen wieder das Fürchten lernen, nicht ein Fürchten, das kopflos macht, sondern ein Fürchten, das unser Gespür für das weckt, was im Umgang mit der Macht auf dem Spiel steht.
„Das Bedenklichste in dieser unserer bedenklichen Zeit ist, dass wir immer noch nicht denken“, heißt es in Heideggers letzter Vorlesung: Was heißt Denken?. Diesen Spruch können wir im Blick auf Guardinis Plädoyer für eine „Ethik der Macht“ und das Jonas‘sche „Prinzip Verantwortung“ folgendermaßen abwandeln: „Das Bedenklichste in dieser unserer mehr und mehr bedenklichen Zeit ist, dass wir immer noch nicht fähig sind, die Gefahr vorauszudenken und die Macht in ihre Schranken zu verweisen.“