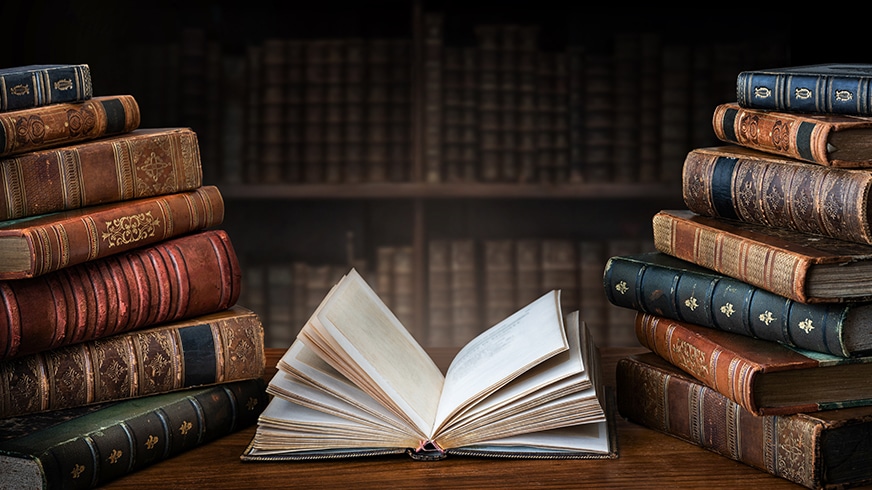Historische Rahmenbedingungen
Die ostgotische Ethnogenese war Teil eines viel umfassenderen Wandlungsprozesses zweier Großreiche. Zum einen war sie eine Folge weiträumiger Migrationsbewegungen heterogener Gewaltgemeinschaften während und nach dem Zerfall des Hunnenreiches Mitte des 5. Jahrhunderts. Zum anderen gehörte sie zu jenem langfristigen Prozess, welcher in der Forschung „Transformation des Imperium Romanum“ genannt wird. Der Begriff „Völkerwanderung“ hingegen zur Bezeichnung der Migrationsvorgänge vom 4.-6. Jahrhundert ist seit längerer Zeit obsolet, weil es sich nicht um Wanderungen ethnisch oder konfessionell einheitlicher Großformationen handelte.
Eine umfassende politische, wirtschaftliche und soziale Transformation zwischen Spätantike und Mittelalter prägte die politische Landkarte nicht nur West- und Mitteleuropas dauerhaft. Der Begriff der Transformation lenkt den Blick auch auf die langfristigen Kontinuitäten, die uns mit der christlichen griechisch-lateinischen Spätantike verbinden. Er weist darauf hin, in welchem Maße das römische Reich multiethnisch und offen war für Veränderungen, wie es Zuwanderer verschiedenster Herkunft zu integrieren und zu assimilieren verstand, so dass noch das heutige Europa die Frucht damaliger Akkulturationsprozesse ist.
Was geschah in diesen Jahrhunderten? Das Imperium war seit dem Ende des 2. Jahrhunderts aufgrund seiner wirtschaftlichen und kulturellen Überlegenheit Ziel von Beute- und Eroberungszügen ethnisch heterogener Gruppen, die als aristokratische Clangesellschaften hierarchisch strukturiert waren. Es gestattete seit dem Ende des 4. Jahrhunderts verschiedenen zugewanderten Gruppen, die es militärisch nicht mehr bezwingen konnte, auf der Basis von Verträgen auf seinem Territorium zu siedeln. Gegen die Leistung von Waffenhilfe für das Imperium wurde diesen als Föderaten bezeichneten Gruppen erlaubt, de facto selbständige Königreiche unter gotischer, burgundischer, vandalischer, langobardischer und fränkischer Ägide zu bilden.
Gab es außer den Migrationen weitere Gründe für die schleichende Parzellierung und Ruralisierung des westlichen Imperium Romanum? Hier sind vor allem die Militarisierung des Kaisertums und die zunehmende Abhängigkeit Roms von gentilen Verbänden zu nennen, die unter eigenen Anführern kämpften und nur bedingt bereit waren, gegen Ihresgleichen vorzugehen. Vorwiegend im Westen des Reiches ereigneten sich daher häufig Usurpationen ehrgeiziger Militärs. Die jeweiligen gentilen Heeresverbände hoben in sicherer Distanz zur Zentralregierung jeweils vor Ort die ihnen genehmen Heerführer auf den Schild und versuchten, ihnen das Kaisertum zu verschaffen. Das Reich wurde vor allem durch solche Bürgerkriege geschwächt, in denen immer neue Koalitionen von Römern und „Barbaren“ um das Kaisertum kämpften.
Im Kontakt mit Rom kam es freilich langfristig zur Akkulturation der Zuwanderer. Sie organisierten sich monarchisch unter Heerkönigen und gerade die Führungsschichten imitierten römische Lebensweisen. Die Kultur des Imperiums blieb ohnehin in den neuen regna tonangebend, denn die Zuwanderer stellten im Mittelmeerraum maximal zwei Prozent der Bevölkerung, bildeten also nur einen hauchdünnen Firnis über der römischen Provinzialbevölkerung.
Als weiterer Faktor der Parzellierung des Imperiums sind die politischen Sprengkräfte der christologischen Glaubensvarianten anzusehen, die damals existierten und für die Zeitgenossen unmittelbar heilsbedrohend erschienen. Ein Großteil der Zuwanderer, z.B. die Goten und die Vandalen, hatte das Christentum in der homöischen Form angenommen, das heißt, sie glaubten, dass Christus lediglich wesensähnlich, aber nicht wesensgleich mit dem Gottvater sei. Der berühmte Streit um ein Iota. (homoousios-homoiousios) Zwischen Romanen und Zuwanderern konnte sich unter diesen Bedingungen noch kein religiöses Band der Einheit entwickeln.
Als weiteres Hindernis für die Reichseinheit erwies sich das entstehende Papsttum, welches sich seit dem ausgehenden 5. Jahrhundert mit dem Anspruch auf plenitudo potestatis (Fülle der Amtsgewalt), auf einen Lehr-und Jurisdiktionsprimat in der Kirche zu Wort meldete. Vor allem infolge der Vakanz des weströmischen Kaisertums konnte dieser Machtanspruch langfristig auch im politischen Bereich Wirkung entfalten.
Auch die sprachliche Einheit des Reiches zerbrach: seit dem 6. Jahrhundert sprach man im Osten nur noch griechisch, die Gesetzesnovellen Kaiser Justinians sind schon zweisprachig ergangen. Die Einführung der Tetrarchie im Zuge der Reformen Diokletians und Konstantins hatte diese Entwicklung vorbereitet.
Soweit zur politischen Großwetterlage, innerhalb derer die gotischen Gruppen agierten.
Zur gotischen Ethnogenese im 5. Jahrhundert
Bedroht vom Hunnenzug nach Westen hatten die Goten Ende des 4. Jahrhunderts nur die Wahl, sich dem Imperium Romanum oder dem Reitervolk zu unterwerfen. Aus der Gruppe, die sich für das Imperium entschied, entstanden die Goten Alarichs und aus diesen die Westgoten. Aus den Goten unter hunnischer Oberhoheit entstanden die Goten Valamirs und seiner beiden Brüder, Thiudimir und Vidimir, aus deren jahrzehntelangen Rivalitäten um die Führung der gesamten gens schließlich die Gruppe um Theoderich, des Sohnes von Thiudimir, letztlich zufällig als Sieger hervorging. Doch der Reihe nach.
Nach dem Fehlschlag ihres Gallien-Feldzuges und dem plötzlichen Tod König Attilas 453 ließ die Macht der Hunnen auf dem Balkan nach, so dass verschiedene gentile Gruppen es 454 wagten, um ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Am Fluss Nedao in Pannonien kam es zur Schlacht, in der ostgotische Gruppen auf Seiten der Unterlegenen kämpften. Sie mussten Zuflucht im Imperium Romanum suchen, und das heißt bei Ostrom, denn Ravenna hatte sich seit der Mitte des 5. Jh. aus diesem Gebiet zurückgezogen. Kaiser Markian gestattete König Valamir die Ansiedlung seiner Gruppe in Pannonien als römische Föderaten. Sie erhielten die pannonischen Provinzen zwischen Sirmium und Vindobona und waren für die Bewachung der Grenze zwischen ost- und weströmischem Machtbereich zuständig – eine heikle Aufgabe, bei der man leicht zwischen die Fronten geraten konnte.
Die Goten siedelten entsprechend ihrer gentilen Dreigliederung in drei Bereichen: im Westen siedelte Thiudimir, in der Mitte der jüngste Bruder Vidimir, im Osten Valamir als der tatkräftigste, der den am meisten bedrohten Grenzabschnitt überwachte. Insgesamt dürften die drei über etwa 18.000 Krieger verfügt haben. Sie wurden aber nicht in diesem Gebiet sesshaft. Denn die Zuwanderer in den Mittelmeerraum, ob sie nun Goten, Vandalen oder Franken hießen, blieben davon abhängig, Sold und Subsidien als Existenzgrundlage zu erhalten, da sie nicht bäuerlich leben wollten, sondern von den Reichtümern, die das Imperium auch in der Spätantike noch produzierte, zu profitieren gedachten. Dafür war die Situation auf dem Balkan, gleichsam in der Mühle zwischen den Ansprüchen von Ost- und Westreich, aber denkbar ungeeignet.
Während der westliche Reichsfeldherr Rikimer die gens aus Noricum zu verdrängen suchte, verfolgte Konstantinopel die Strategie, sich mit den außerhalb des Imperiums siedelnden Föderaten gegen die Goten zu verbünden. Eine unübersichtliche und stets prekäre politische Gemengelage war die Folge, in der ethnisch heterogene Gefolgschaftsgruppen einzelner gentiler Fürsten vom Ostkaiser phasenweise gegen Zahlungen in Dienst genommen und anschließend wieder bekriegt wurden.
Als Reaktion auf diesen Wankelmut unterstrichen die gotischen Föderaten ihre Forderungen nach Subsidien 460 mit Raubzügen nach Ostillyrien. Unter diesem Druck schloss Kaiser Leo I. umgehend mit dem Amalerkönig Valamir ein Bündnis, welches mit der Vergeiselung seines Neffen Theoderich, des späteren Großen, bekräftigt wurde, der in der Folge zehn prägende Jahre in der politischen und kulturellen Weltmetropole Konstantinopel verbrachte. Im Gegenzug halfen die gotischen Föderaten dem Ostreich sogar im Jahr 469, den Sohn Attilas, Dengizich, zu besiegen und zu töten.
Die Hilfe für Konstantinopel hielt die Goten jedoch nicht davon ab, weiterhin eigene Plünderungszüge auf dem Balkan zu unternehmen und Skiren, Sueben, versprengte Hunnen, Gepiden, Rugier, Sarmaten und andere zu bekriegen. Die Kaiser reagierten meist mit Zugeständnissen auf solche Gewaltausbrüche: Kaiser Leo I. schickte 471 die inzwischen 18jährige Vertragsgeisel Theoderich an die gens zurück. Dieser übernahm das Gebiet seines inzwischen gefallenen Onkels Valamir, während sein Vater Thiudimir König aller pannonischen Goten wurde.
Der Sohn jedoch profilierte sich in der Folge, ohne den Vater einzuweihen, durch eigene Kriegszüge gegen die Sarmaten, er eroberte Singidunum, das heutige Belgrad, ohne es an Konstantinopel zurückzugeben: „suae subdedit dicioni“ heißt es bei Jordanes. Damit brachte sich Theoderich als potentieller Kandidat für das Königtum der gesamten gens ins Spiel. Von diesem Zeitpunkt an datierte er später auch den Beginn seiner eigenständigen Königsherrschaft, so bei der Feier der Tricennalien im Jahr 500.
Warum jedoch verließen die Goten zwei Jahre später Pannonien und spalteten sich auf? Mehrere Gründe sind zu erschließen: Theoderichs Verwandter Strabon war 471 magister militum per Thracias und wurde 473, nachdem ihn seine Gefolgsleute zum König erhoben hatten, vom Kaiser als König aller Goten anerkannt und sollte jährlich 2000 Goldpfund Subsidien bekommen, ein Vielfaches von dem Betrag, der für die pannonischen Goten üblich war. Damit ging wohl die Einstellung der Zahlungen des Kaisers an die pannonischen Goten einher. Doch so weit muss man nicht gehen: Jordanes berichtet, dass die Goten Theoderichs, des Sohnes von Thiudimir, aus Mangel an Beutemöglichkeiten in ihrem Umfeld und aus Friedensmüdigkeit („hominibus, quibus dudum bella alimonia prestitissent, pax coepit esse contraria“) Thiudimir „cum magno clamore“ aufgesucht und gefordert hätten, er möge sie wohin auch immer in den Krieg führen.
Nach Rücksprache mit seinem Bruder und dessen gleichnamigem Sohn Vidimir und einem Losentscheid wurde Vidimir in den Westen geschickt, während sich Thiudimir in Selbsteinschätzung als der mächtigere in Richtung des mächtigeren Ostreichs im wahrsten Sinne des Wortes orientieren sollte, so Jordanes in seiner Getica, Kap. 283. Während Vidimir vom Westkaiser Glycerius aus Italien mit Geschenken in das umkämpfte Gallien hinauskomplimentiert wurde, bis er sich den Westgoten anschloss, konnte sich der ältere Thiudimir mit seinem Sohn an „undique prospera“ delektieren. Sie nahmen Naissus und Stobi ein und marschierten ins Illyricum, wo sie Heraclea und Larissa plünderten.
Theoderichs Erfolge waren so ebenfalls eine Gefahr insbesondere für seine Verwandten. Es ging den Brüdern darum, sich eigenes Land zu sichern, das ihnen und ihren Leuten Unabhängigkeit von kaiserlichen Zahlungen brachte. Die Anführer rivalisierten um die Gunst des Kaisers, der sie wiederum gegeneinander auszuspielen versuchte. Die Eifersucht auf die Erfolge Strabons veranlasste jetzt Theoderich und seine Gruppe, weiter ins Zentrum des Reiches zu marschieren, um eine gotische Monopolstellung Strabons zu verhindern. Mit Plünderungszügen und einem Angriff auf Thessaloniki konnten Thiudimir und sein Sohn immerhin erreichen, dass sich der Kaiser zu besseren Vertragsbedingungen bereitfand.
Die Gruppe konnte einen freilich kurzlebigen Einflussbereich um Kyrrhos an der Via Egnatia errichten, bevor Theoderichs Vater 474 starb. Nachdem Theoderich von einer Versammlung der Goten einer Designation des Vaters folgend zum König erhoben wurde, starb auch Kaiser Leo I. Dessen Nachfolger Zenon ließ Strabon fallen. Dieser rächte sich und unterstützte den Usurpator Basiliskos, der ihn dafür zum obersten Heermeister und damit Vorgesetzten auch Theoderichs machte.
Das konnte dieser nicht auf sich sitzen lassen. Er verbündete sich mit Zenon, beide stürzten den Usurpator, und Zenon zeigte sich 476 erkenntlich: Theoderich wurde zum amicus populi Romani, zum Waffensohn des Kaisers und patricius ernannt und avancierte zum obersten Heermeister des Ostreichs. Dennoch gab Strabon nicht auf, und auch Zenon taktierte. Er verweigerte Theoderichs Forderung, sich nie wieder mit Strabon auszusöhnen und ließ sogar die Versorgung der Gefolgschaft Theoderichs aussetzen. Nachdem sich beide Gruppen als Teil einer perfiden kaiserlichen Strategie unerwartet bewaffnet gegenüberstanden, eröffneten sie aber nicht das Gefecht gegeneinander, sondern verbündeten sich gegen den Kaiser. Die gentile Solidarität überwog.
Gefechte, Scharmützel und diplomatische Lösungsversuche brachten in den Jahren 479-481 keine durchschlagende Veränderung, so dass Zenon schließlich sogar die Bulgaren gegen den erfolgreichen Strabon zu mobilisieren versuchte. Der Gote schlug sie zurück und marschierte Richtung Konstantinopel. Strabon war kurz vor dem Ziel, alleiniger Gotenkönig zu werden – wenn nicht, ja wenn nicht 481 ein Reitunfall sein Leben jäh beendet hätte. Er wurde von einem noch nicht zugerittenen Pferd aus dem Sattel geschleudert und stürzte im Fallen so unglücklich auf eine Lanzenspitze, dass er kurz darauf seinen Verletzungen erlag.
Theoderich und die zunächst in Pannonien und dann in Mösien siedelnden Goten waren die Gewinner dieses Unglücks. Der überlebende Theoderich band die Gefolgsleute seines toten Gegners an sich und ermordete höchst selbst den Sohn seines Rivalen, Rekitach, und zwar mit Wissen des Kaisers. Er durchbohrte ihn, als dieser nichtsahnend vom Bad in der Vorstadt Bonophatianae zu einem Fest ging, eigenhändig mit dem Schwert. Anschließend startete er eine Eroberungsaktion in Griechenland, deren Verwüstungen Zenon dazu zwangen, ihm endlich die gewünschten Vertragsbedingungen zu gewähren. Er wurde wieder magister militum and patricius, zum Konsul für das Jahr 484 designiert sowie mit Uferdakien und Teilen Mösiens ausgestattet.
Das wechselseitige Misstrauen zwischen gotischem Heerführer und Kaiser war damit keineswegs ausgeräumt. In den Jahren 486 und 487 kam es zum offenen Schlagabtausch: Zenon stachelte erneut die Bulgaren gegen die Goten auf, Theoderich marschierte auf Konstantinopel, besetzte wichtige Vororte und unterbrach die Wasserversorgung der Stadt, deren Topographie er aus der Zeit seiner Geiselhaft bestens kannte. Zenon musste ihm daraufhin die immer noch in Geiselhaft gehaltene Schwester Amalafrida zurückgeben und er zog nach Thrakien ab.
Doch ihm war klar, dass er im Ostreich keine sichere Perspektive für sich und seine Leute hatte, da der Kaiser keine militärische Dominanz der Goten im Ostreich dulden würde. Als der Konflikt zwischen Zenon und dem italischen Königreich unter dem Skiren Odoaker einsetzte, ergriff Theoderich daher die Chance, sich vertraglich als Stellvertreter des Kaisers nach Italien entsenden zu lassen, um dort „praeregnare“, die Herrschaft auszuüben, bis der Kaiser selbst in diese Region kommen würde.
Der Bericht über die Ereignisse auf dem Balkan hat gezeigt, wie sehr interne Bürgerkriege im Imperium Romanum sich stets mit den Rivalitäten unter den verschiedenen gotischen Stammesgruppen verquickten.
Was bedeutet „Herrschaft? Vergleich der ostgotischen Ethnogenese mit dem Frankenreich
Doch was verrät uns diese Narration über die Frage, welche Veränderungen Ende des 5. Jahrhunderts hinsichtlich der Begründung und Legitimation dessen, was wir „Herrschaft“ nennen, beobachtbar sind. Um diese Frage zu beantworten, erhoffe ich mir zusätzliche Erkenntnisse aus dem Vergleich der Karriere Theoderichs mit dem fast gleichzeitig vom Heermeister zum König avancierenden Chlodwig, dem König des Frankenreiches.
Warum habe ich gerade Ostgoten und Franken für einen Vergleich ausgewählt? Deren Reiche in Gallien bzw. später in Italien repräsentierten zwei Typen der Bildung neuer politischer Einheiten, die im Fall der Franken auf Integration und Assimilation heterogener Bevölkerungsteile, im Fall der Ostgoten auf Separation von Goten und Römern beruhten. Die dritte Variante, das Eroberungsmodell, welches in erster Linie auf Gewalt, Vertreibung und Enteignung basierte, nenne ich hier nur. Es war wenig erfolgreich und wurde von den Vandalen in Nordafrika und später den Langobarden in Italien praktiziert. Das Vandalenreich wurde 534 vom Imperium Romanum zurückerobert und das Langobardenreich schließlich von Karl dem Großen 774 einem neuen fränkischen Imperium einverleibt.
Wirtschaftliche Gründe standen am Beginn auch der gotischen und fränkischen Landnahmen. in Gallien. Nicht erst der spätere König Chlodwig und seine Gefolgsleute erhofften sich Gewinne aus dem wirtschaftlich höher entwickelten Land westlich des Rheins. Schon seit dem 3. Jahrhundert hatten Franken Plünderungszüge ohne Eroberungsabsicht in die linksrheinischen Gebiete unternommen und versuchten im 4. Jh. bereits, auch Territorium zu annektieren. Als sich Mitte des 5. Jahrhunderts die römische Armee aus Nordostgallien zurückzog, hinterließ sie ein Machtvakuum, dessen Sog allmählich eine Migration auslöste.
Auch bei den Franken bildeten Verträge die Basis. Die führende Sippe der Salfranken, der Chlodwigs Vater Childerich angehörte, verbündete sich mit Aegidius, dem römischen Heermeister (456/7-464), 463 gegen die Westgoten, und sie wurden als Föderaten anerkannt. Sie siedelten schon lange verstreut in enger Nachbarschaft mit den Gallorömern. Die Einbindung in das römische System der Verwaltungs- und vor allem der Heeresorganisation war der Ausgangspunkt auch der fränkischen Machtentfaltung. Das Heermeisteramt war der Steigbügel zu eigener Machtstellung, sowohl bei Theoderich wie bei schon bei Chlodwigs Vater Childerich. Die Nachfolge in der Provinzialverwaltung leitete bei Rhein- und Salfranken die Entwicklung zu großräumigeren politischen Formationen ein, welche Chlodwig lediglich abschloss. In der Folge kam es zu einer Symbiose von Franken und Romanen, eine Mischzivilisation mit engem Kulturaustausch fand statt.
Doch eines ist klar: Ohne den Substanzverlust imperialer Autorität im 5. Jahrhundert wären Chlodwigs und Theoderichs neue militärische und politische Karrieren kaum vorstellbar gewesen. In den beständigen Bürgerkriegen, die sich in der Regel um erfolgreiche Heerführer als potentielle Kaiserkandidaten und deren Anhänger abspielten, erforderte der Aufbau von Herrschaft als wechselseitiger sozialer Beziehung, die zur Herstellung und dauerhaften Bewahrung der gesellschaftlichen Ordnung in politischen Verbänden dient, zuerst militärische Fähigkeiten. Doch es bedurfte in der politischen Interaktion mit dem Imperium auch einer Legitimation der mit Gewalt errungenen Stellung. Hier kommen die Verträge ins Spiel, welche eine neue Form rechtlich-politischer Legitimation der Gewaltgemeinschaften einleiteten, die sich nach dem Sesshaftwerden im italischen regnum Theoderichs intensivierte. Auf der Basis von Recht und Konsens mit und unter den Beherrschten, insbesondere den Führungsschichten, konnte der innere Zusammenhalt des neuen ethnisch und konfessionell heterogenen politischen Gebildes gefördert werden.
Welche Qualifikationen waren erforderlich, um in dieser Transformationsphase des Imperiums Führungsfunktionen erreichen und bewahren zu können? Militärische Bewährung stand an erster Stelle, wie wir gesehen haben, aber es kamen römische Formen der politischen und gesellschaftlichen Anerkennung hinzu. Kaiser Zenon benutzte sowohl gentile Traditionen, um die herausgehobene Stellung seines Heermeisters zu demonstrieren, er ernannte ihn zum Waffensohn, als auch römische Formen der Auszeichnung wie den Patriziat und den Ehrentitel des amicus populi Romani, der seit alters her für die Bundesgenossen der Römer üblich war. Die Verleihung des Konsulats schließlich bezeugte, dass römische Formen der Karriere, des republikanischen cursus honorum, weiterhin sozialen Aufstieg begründen konnten. Das war für Theoderich umso wichtiger als er sich nicht auf ethnische Merkmale als Voraussetzung politischer Loyalität verlassen konnte und wollte.
Wie funktionierte also Theoderichs Herrschaft, die alles andere war als unser heutiges, von Max Weber geprägtes Verständnis nahelegt. Es war gerade nicht die Einbahnstraße von Befehl und Gehorsam, die ihn und seine Gotengruppe zusammenschweißte. In Theoderichs Tagen auf dem Balkan ging es vielmehr um ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis: Loyalität konnte der vielversprechendste Feldherr erwarten, der seine Leute durch Beute und Vertrag verantwortlich zu versorgen und zu unterhalten verstand. Wenn wir also danach fragen, was diese Kriegergruppen zusammenhielt, bieten sich in erster Linie Theorieansätze der Sozialpsychologie an.
Der „leadership“-Forschungszweig der Sozialpsychologie ist hier m.E. weiterführend. Führung wird nicht als Zwang, sondern als Form sozialen Einflusses definiert, durch welchen eine Person die Hilfe anderer zum Erreichen eines gemeinsamen Zieles gewinnt. Um effektiv zu sein, müsse Führung Integration nach innen und Anpassung nach außen, zwei eigentlich widersprüchliche Ziele, gleichzeitig verwirklichen. Das stimmt exakt mit den historischen Gegebenheiten überein, denen sich Theoderich und auch Chlodwig gegenüber sahen. Es kam darauf an, die eigenen Gefolgsleute – in unseren Fällen durch Aussicht auf Ruhm und Beute – an sich zu binden und zusammenzuschweißen, später aber auch durch eine Art Anpassungsleistung an die romanische Provinzialbevölkerung deren compliance zu gewinnen. Diese Balance zu halten oder anders ausgedrückt, diesen Zielkonflikt in konstruktiver Weise zu bewältigen, gelang Theoderich und Chlodwig auf teils ähnliche, teils unterschiedliche Weise. Beide besaßen die von der Sozialpsychologie als zentrale Elemente von Führung benannten Qualitäten des image management, relationship development und resource deployment.
Beginnen wir mit der für die Motivation so zentralen Ressourcenverteilung. Die gefolgschaftlich organisierten Gewaltgemeinschaften, die Chlodwig und Theoderich anführten, praktizierten während der Migration eine Raubwirtschaft, die nicht oder jedenfalls nicht berechenbar und stetig, ihren Bedarf deckte. Der Kaiser zahlte nur unregelmäßig Subsidien, Beute, Schutz- und Lösegelder waren stets prekär. Nur die Zuweisung eigenen Siedlungslandes für die jeweiligen Gefolgsleute konnte dieses Problem dauerhaft lösen und die Verbände damit pazifizieren. Die Franken erreichten dies durch föderierte Ansiedlung und allmähliches weiteres Einsickern in kleinen Gruppen nach Nordgallien meist mit Billigung ihrer Nachbarn. Den Goten gelang dies erst in Italien.
Beide Anführer übernahmen durch militärische Eroberungen früheres römisches Fiskalland in großem Umfang, das über Land und Steuereinkünfte die Basis ihrer Versorgung darstellte: das Syagriusreich und das Land der Westgoten im Falle Chlodwigs, Theoderich in Italien das Land Odoakers und Teile der praedia senatorischer Latifundienbesitzer. Durch Verjährung nach 30 Jahren wurden etliche Goten sogar zu Eigentümern der ihnen übertragenen Güter.
Die römische Steuerverwaltung funktionierte andererseits in beiden Regionen weiter und generierte Einnahmen, die jetzt den Königen zuflossen. Die expansive Dynamik beider Anführer blieb vor allem aufgrund des inhärenten Zwanges, die Beuteansprüche der Gefolgsleute zu befriedigen, erhalten und setzte sich bei den fränkischen Nachfolgern Chlodwigs fort. Vor allem bei dem Geschichtsschreiber Jordanes erscheint Theoderich sogar oft als Getriebener („coactus“) seiner Leute.
Kommen wir zum zweiten Aspekt erfolgreicher Führung, dem image management der Könige. Dazu gehören in erster Linie die Herstellung von Legitimität, von Zusammenhalt innerhalb der eigenen Gruppe (integration) und die Anpassung nach außen (accomodation). In unseren Fällen beruhte Legitimität auf dem Beweis der kriegerischen Führungsfähigkeit nach innen und der vertraglichen Anerkennung beider Könige durch den Kaiser.
Kommen wir zum nächsten Aspekt des Führens, dem relationship development. Beziehungen zu ihren kriegerischen Gefolgsleuten hatten beide Könige von frühester Jugend an. Die agonale Gesellschaft dieser Zeit folgte in der Expansionsphase dem vielversprechendsten Feldherrn. So gelang es Theoderich und Chlodwig, mit ihren Siegen über interne gentile Rivalen und auswärtige Feinde auch deren engstes Gefolge an sich zu ziehen.
Während sich Theoderich in Italien vorwiegend an römische Formen der Machtausübung im politischen und kulturellen Sektor anpasste und als Homöer neutral blieb und den religiösen Konflikt vermied, konnte es sich Chlodwig aufgrund des höheren Bevölkerungsanteils der Franken in Gallien und aufgrund seiner Konversion zur Mehrheitskonfession gleichsam als Trendsetter leisten, eine Neudefinition des Elitestatus und der damit verbundenen sozialen Normen und Werte vorzunehmen.
Wichtig war im Gegensatz zur Arbeitsteilung zwischen gotischer Militär- und romanischer Zivilverwaltung in Italien die Beteiligung der Romanen am Militärdienst im Frankenreich. Diese Kampfgemeinschaft mag einen weiteren Impuls zum Zusammenwachsen beider Gruppen gegeben haben, denn rekrutiert wurden Romanen sogar außerhalb der fränkischen Siedlungsgebiete!
Theoderich hingegen trennte seinen Verband von den Romanen, um den inneren Zusammenhalt zu stärken. Keine Eheschließungen mit Romanen, auch wenn es einzelne Beispiele vor allem in der Führungsschicht gab, konzentrierte Siedlung an strategisch wichtigen Punkten, keine Romanen im Heer in führenden Positionen – jedenfalls bis in die Gotenkriege gegen Justinian hinein.
Abschließende Würdigung
- Chlodwigs und Theoderichs Karrieren weisen wichtige Gemeinsamkeiten auf: beide waren als Erben ihrer Väter fähige militärische Anführer von gewaltbereiten Gefolgschaftsverbänden, denen es über lange Zeiträume gelang, die Loyalität wachsender ethnisch und konfessionell heterogener Gruppen zu sichern. Beide waren Parteien in einem römischen Bürgerkrieg, die wechselnde Bündnisse eingingen. Beide handelten primär aus wirtschaftlichen Motiven und wendeten Gewalt an, um den Unterhalt ihrer Gefolgsleute zu sichern und nach Möglichkeit auf Dauer zu stellen. Beide strebten zunächst nach mobilen Schätzen, später nach unabhängigen Siedlungsgebieten und Landeigentum zur agrarischen Nutzung. Sekundär, in der Konsolidierungsphase ihrer Machtausübung nach der Anerkennung durch den Kaiser, kamen über die Promulgation von Gesetzessammlungen für Zuwanderer und Romanen sowie im Falle Chlodwigs über die Gewinnung bischöflicher Eliten legitimierende und konsensstiftende Regierungsmaßnahmen in traditionellen römischen Formen hinzu.(adventus mit Akklamationen in Rom und Tours)
- Beide waren mit nur geringem Widerstand aus der romanischen Bevölkerung konfrontiert, weil sie bereits tiefgehend romanisiert waren, weil sie Gewalt androhten, im Rahmen der Kontraktualisierung politischer Beziehungen in dieser Zeit auch auf der Basis von foedera den Konsens mit den romanischen Eliten fanden und deren vor allem wirtschaftliche und politische Interessen bis zu einem gewissen Grad respektierten. Während Chlodwig eher mit den Bischöfen kooperierte, setzte Theoderich in Italien vor allem auf die Mitwirkung der senatorischen Latifundienbesitzer.
- Beiden gelang es, eine militärisch begründete Machtposition wirtschaftlich zu nutzen und in politische Macht umzuwandeln, die sich in der Folge zusätzlich ideologisch begründete. Chlodwig begann mit einer Sakralisierung der Macht (Konzil von Orléans), Theoderich hingegen setzte, inspiriert durch seinen Spin-Doktor Cassiodor, in Italien eher die Friedens- und Kulturmission des Imperiums fort.
- Die Ergebnisse der Politik Chlodwigs und Theoderichs unterschieden sich erheblich: in Italien kam es zur überwiegend friedlichen Koexistenz separierter Gruppen von Goten und Romanen bei allmählicher Machtübernahme der gotischen Militärs. In Gallien hingegen, wo die fränkische Zuwanderung zahlreicher und stetiger war, kam es zum Zusammenwachsen einer gemischten Elite aus Romanen und Franken in der Zeit vom 4.-6. Jahrhundert. Während wir für Italien daher von einem partiellen Elitenwechsel sprechen können, entstand in Gallien nach einer lang währenden Massenmigration eine neue Führungsschicht.
Chlodwig war gegenüber Theoderich beim Aufbau eines regnum insofern im Vorteil, als er an der Peripherie des Imperiums in einem Machtvakuum ein legitimierendes römisches Amt in Gestalt der Sprengelkommandantur übernahm, mit seinen Leuten bereits länger in Gallien akkulturiert war, und die Franken einen höheren Bevölkerungsanteil stellten. Er und seine Leute waren die „wave of advance“ einer Massenmigration. Aber die Randlage des Frankenreichs ließ dort leichter ein neues Machtzentrum gedeihen als in der stets umzingelten Zentralität Italiens, in der sich Theoderich behaupten musste. Beide Könige waren gerade in der Konsolidierungsphase ihrer Regierung fähige Kommunikatoren und Vermittler, die über Verträge, Rechtssammlungen, politische Kompromisse mit den Eliten und religiöse bzw. traditionell römische Legitimationsstrategien die Basis neuer Königreiche legten.