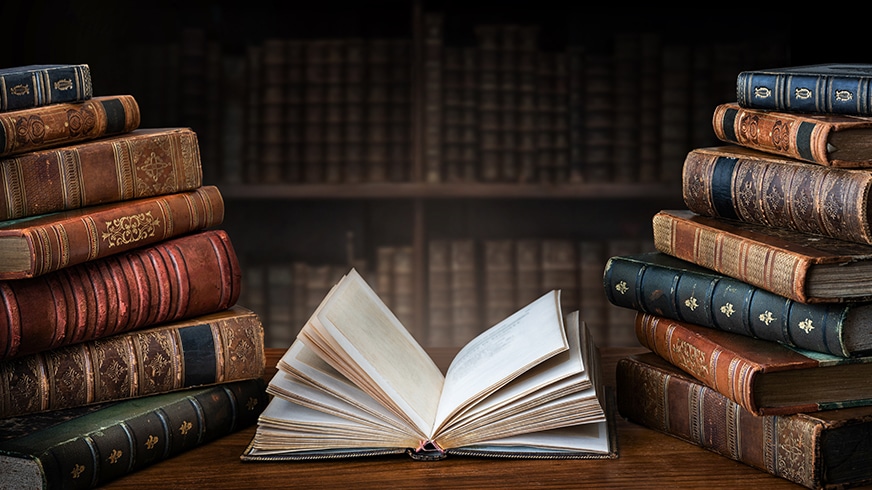I.
München leuchtete – so lässt Thomas Mann seine 1902 veröffentlichte Erzählung Gladius Dei beginnen. Er spielt dabei vor allem auf die bildende Kunst an, nicht zuletzt vor der Kulisse der prachtvollen Ludwigstraße oder etwa der Feldherrnhalle, die doch stark an die Loggia dei Lanzi in Florenz erinnert. München war in der Tat eine südliche Stadt, die nicht wenige architektonische Anleihen im Renaissance-Italien, aber auch am antiken Griechenland nahm. Und Ludwig I. formulierte selbst seine Begeisterung für das antike Griechenland:
Eine Welt des Schönen ist gewesen,
Wie wir es in alten Schriften lesen,
Doch von Allem, was zu ihr gehört,
Ach! Wie Wenges übrig ist geblieben,
Von der steten Macht der Zeit zerrieben,
Mehr noch durch der Menschen Hand zerstört.
Jene Welt ist hin, sie ist verschwunden,
Wird nicht mehr gesehn, wird nur empfunden,
Ewig hin ist ihre Herrlichkeit;
Traurig niederschlagender Gedanke,
Der gemacht, damit der Entschluß wanke,
Großes zu vollbringen in der Zeit.
Doch der Mensch darf sich nicht darum kümmern,
Ob auch seine Werke einst zertrümmern,
Wirken soll er für die Ewigkeit.
Was er Würdges kann, das soll er zeigen,
Trachten das, was möglich, zu erreichen,
Von der Angst vor Künftigem befreyt.
Säulen sollen schlank und kräftig ragen,
Hallen edler Marmorbilder tragen,
Mit der Schönheit eine sich die Pracht.
Tempel sollen heilig sich erheben,
Ihre Himmel gegen Himmel streben,
Und der Herzen Gluth wird angefacht.
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die Bedeutung König Ludwigs I. mehr in seinen architektonischen Visionen als in seinen eigenen lyrischen Versuchen liegt. Nichts desto trotz soll es hier um die Bedeutung der Wittelsbacher für die Dichtkunst gehen. Die Rolle der Wittelsbacher liegt dabei weniger in der eigenen dichterischen Produktion, als vielmehr in der Förderung der Dichtkunst konkret im Mäzenatentum. Als Förderer der Dichtkunst folgen die Wittelsbacher freilich schon älteren Vorbildern in Bayern. So zeigt sich schon im Frühmittelalter eine Literaturpolitik der Agilolfinger. Diese ließen repräsentative lateinische Codices anlegen, um ihren Herrschaftsanspruch auf Pergament zu dokumentieren. Dies erweist beispielsweise der sogenannte Psalter von Montpellier. Die Prachthandschrift des 8. Jahrhunderts war für den letzten Agilolfinger Herrscher Tassilo III. bestimmt. Dieser bedeutende Herzog ließ zahlreiche repräsentative Handschriften herstellen, und dies in einer Zeit als die antike Schreibkunst in Europa weitgehend zum Erliegen gekommen war und lange vor der sogenannten karolingischen Renaissance unter Karl dem Großen.
Die nächste Dynastie, welche als bedeutsam für das literarische Leben anzusehen ist, residierte vornehmlich in Regensburg. Es handelt sich dabei um die Welfen. Mit Heinrich dem Löwen wird im Regelfall ein bedeutendes Epos in Zusammenhang gebracht:
Das Rolandslied wurde aufgrund einer altfranzösischen Vorlage in Regensburg durch den Pfaffen Konrad ins Mittelhochdeutsche übersetzt. Die Welfen wollten sich damit als Beschützer der Christen gegen die vordringenden Moslems zeigen. Letztlich ein Dokument aus der Zeit der Kreuzzüge.
II.
Als aber die Wittelsbacher nach der Absetzung des Welfen Heinrichs des Löwen Herzöge von Bayern wurden, übernahmen sie die welfische Mäzenatenrolle für die höfische Literatur. Sie taten dies zunächst in der Gattung Minnesang, denn als enge Vertraute der Staufer hatten die Wittelsbacher die europäische Liebesdichtung kennengelernt. So etwas wollten sie auch an ihrem Hof haben.
Bote, nu sage dem liepgenaemen wîbe
Daz ze wunsche gât sô wol mîn schîbe
dû sage ze Landeshuote
wir leben alle in hôhem muote
niht unvruote
Die Strophe stammt aus der Feder des Minnesängers Neidhart. Dieser sehnt sich aus der Ferne nach dem Hof in Landshut. Tatsächlich waren es städtische Höfe, welche die Wittelsbacher als Städtegründer (so auch das Thema der Bayerischen Landesausstellung 2020 in Aichach und Friedberg) bevorzugten. Denn höfische Feste feierte man ungern auf zugigen Ritterburgen, sondern lieber in komfortablen Residenzstädten, wo es große Säle, und ebensolche Weinkeller gab. Von den Wittelsbachern bevorzugt wurde daher vor allem Landshut als Literaturort. Dort wirkte unter anderem Wolfram von Eschenbach. Neben Landshut genoss der bayerische Adel Literatur im hohen Mittelalter in mittelhochdeutscher Sprache daneben in Regensburg. Und der Burggraf von Regensburg aus dem Geschlecht der Riedenburger verfasste bedeutende Minnelieder des sogenannten Donauländischen Minnesangs. Eine weitere Donaustadt beherbergte das bedeutendste Buchepos des hohen Mittelalters:
Von Pazowe der biscof Pilgerîn
Durh liebe der neven sîn
hiez scrîben ditze maere
wie ez ergangen waere,
in latînischen buochstaben,
daz manz für wâr solde haben,
swerz dar nâh erfunde,
von der alrêrsten stunde,
wie ez sih huob und ouh began,
und wie ez ende gewan
umbe der guoten knehte nôt,
und wie si alle gelâgen tôt.
Daz hiez er allez schrîben.
Ern liez es niht belîben,
wand im seit der videlaere
diu kuntlîchen maere,
wie e zergie und gescah;
wand erz hôrte unde sach,
er und manec ander man.
Daz maere prieven dô began
Sîn schrîber, meister Kuonrât.
Getihtet man ez sît hât
dicke in tiuscher zungen.
‚Bischof Pilgrim von Passau befahl aus Zuneigung zu seinen jungen Verwandten, diese Geschichte aufzuschreiben, nämlich, wie es sich ereignete, sogar in lateinischer Sprache, damit man es für wahr hielte, wer immer später darauf stieße, und zwar von Anfang an, wie alles begann und wie es zu Ende ging wegen der Kampfesnot der guten Krieger und wie sie am Ende alle tot dalagen. Das befahl er alles aufzuschreiben. Er ließ nicht davon ab, denn der Fiedler berichtete ihm die bemerkenswerten Geschichten, wie alles sich zutrug und geschah, denn er selbst hörte und sah es, er und viele andere Kämpfer. Die Geschichte verschriftlichte darauf der bischöfliche Notar, Magister Konrad. Später wurde sie oft in deutscher Sprache weitergedichtet.‘
Die Passage ist der sogenannten Nibelungenklage entnommen, welche als Fortsetzung des gesungenen Nibelungenlieds im Hohen Mittelalter als Kommentar stets ebenfalls rezipiert wurde. Beide Werke aber entstanden in Passau. Der eben genannte Bischof Pilgrim von Passau lebte dort wirklich. Hinter ihm verbirgt sich jedoch um 1200 der adelige Wolfger von Erla, der als Bischof von Passau und Patriarch von Aquileia nicht nur ein bedeutender Kirchenfürst war, sondern auch reichspolitisch als Vermittler zwischen Staufern und Welfen agierte. Dieser Wolfger von Erla war aber nicht nur Urheber des mittelhochdeutschen Nibelungenlieds, sondern auch Förderer Walthers von der Vogelweide: Walthero cantori de Vogelweide pro pelliceo quinque solidos longos
Dieses lateinische Zitat ist aus der Buchführung Wolfgers von Erla entnommen. Es besagt, dass im Jahre 1203 dem Sänger Walther von der Vogelweide eine größere Geldsumme für einen Pelzmantel überreicht wurde. In einem späteren Lied bedankt sich Walther bei dem biderben Patriarken also beim rechtschaffenen Kirchenfürsten.
Walther von der Vogelweide kam bekanntlich weit herum, nur nach München führte ihn sein Weg nicht. München wird erst mit Ludwig dem Bayern zum Hof, an dem Literatur gepflegt wird. Und Ludwig der Bayer zog zwar einerseits als Reisekaiser noch von Reichsstadt zu Reichsstadt, andererseits aber versammelte er am Alten Hof in München die geistige Elite Europas mit Marsilius von Padua oder William von Ockham um sich. William von Ockham taucht übrigens als William von Baskerville in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose wieder auf.
Der Roman nimmt historisch Bezug auf die Auseinandersetzungen zwischen Ludwig dem Bayern und dem Papsttum in Avignon. Der Wittelsbacher wurde dabei von franziskanischen Kreisen unterstützt. Die kaiserliche Partei unter den Geistlichen sah sich durch die päpstliche Inquisition bedroht und suchte am Hof in München Schutz. Dort also waren die bedeutendsten Intellektuellen Europas versammelt, die mit ihren lateinischen Traktaten für den römisch-deutschen König und ab 1328 quasi vom römischen Volk gekrönten Kaiser fochten. Der Papst in Südfrankreich, der nicht zuletzt auf Betreiben des französischen Königs agierte, während Ludwig der Bayer am Vorabend des Hundertjährigen Krieges ein Bündnis mit England eingegangen war, wollte Ludwig IV., den er selbst als Bavarus schmähte, was an Barbarus anknüpfte, bestrafen.
Für den Papst in Avignon war Ludwig also nur ein bayerischer Barbar. Und die Barbaren im Reich wollte der Papst bestrafen, indem er das Interdikt über das Reich verhängte. So war dann die Spendung der Eucharistie weitgehend verboten. Es kam aber nur teilweise zur Befolgung des Interdikts. Und die mangelnde Interdikt-Observanz erkaufte sich Ludwig der Bayer geschickt, indem er an die Reichsstädte, die ihn auch finanziell unterstützten, großzügige Privilegien verteilte. Diese Privilegienerteilung erfolgte durch deutschsprachige Urkunden.
Ludwig der Bayer ließ als erster König geradezu massenhaft deutschsprachige anstatt lateinischer Urkunden ausstellen. Darin leistete er wohl auch einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Zur Erforschung dieses für die Germanistik neuen Sachverhalts veranstalte ich im nächsten Jahr eine internationale Tagung zu europäischen Kanzleisprachen.
Doch zurück zur eher spärlichen Interdikt-Observanz im Reich: Sogar Geistliche und Klosterfrauen verweigerten die Befolgung des päpstlichen Interdikts aus Südfrankreich. Berühmtes Beispiel hierfür ist die selige Margarete Ebner, welche selbst aus dem Patriziat stammend, quasi adelig war und in einer mystischen Vision Ludwig den Bayern rechtfertigte:
Item mir wart mit grozzer begirde geben aines tagez, daz ich Ihesum min kint frageti von kaiser Ludwige von Baiern umb die arbait, diu im uf fiel von dem künige. Do wart mir geantwurt: „ich wil in nimer verlazzen weder hie noch dort, wan er hat die minne zuo mir, die nieman waiz denne ich und er, und daz enbuit ime von mir“.
Dies lässt sich folgendermaßen paraphrasieren: Margarete Ebner hatte offenbar eine Audition, als sie das göttliche Jesuskind über Kaiser Ludwig und die Mühe, die Ludwig wegen des Gegenkönigs Karls IV. aus dem Hause Luxemburg hatte, befragte. Das Jesuskind antwortete ihr nämlich wörtlich: „Ich werde ihn, also Ludwig, niemals im Stich lassen, weder hier auf Erden noch dort im Himmel, denn Ludwig hat die wahre Minne zu mir, die niemand kennt, außer ich selbst und er. Richte ihm das bitte von mir aus!“
Es gelang also Ludwig dem Bayern, der von 1314 bis 1347 über eine Generation lang geschickt regierte, durchaus die besten Kräfte an sich zu binden. Davon profitierte nicht zuletzt der Münchener Hof auch literarisch. Nach Ludwigs Tod auf der Jagd, verblasste allerdings der literarische Nimbus des Münchener Hofs. Und seine Söhne traten bis auf die Förderung Hadamars von Laber und seiner Minneallegorie Die Jagd eher wenig als Literaturförderer auf.
Einen nächsten Höhepunkt erreicht die Literaturpflege in München im 15. Jahrhundert unter den Herzögen Albrecht III. und Albrecht IV. Hier sind es (wie schon im 14. Jahrhundert bei Ludwig dem Bayern) auch die pragmatischen Gattungen, die neben einer Wolfram-Imitation und Ritternostalgie auffallen. Die Ritternostalgie am Münchner Hof im ausgehenden 15. Jahrhundert ist hier keineswegs isoliert zu sehen, sondern fügt sich zum Habsburger Kaiser Maximilian I., dem „letzten Ritter“, mit seinen entsprechend rückwärtsgewandten frühneuhochdeutschen Epen oder dem Ambraser Heldenbuch.
Neben solch konservativer Literaturpflege setzte sich schließlich in München auch ein neuer akademisch gebildeter Dichtertyp durch: Als geradezu universaler Autor in den Diensten Albrechts III. hat der Arzt Johannes Hartlieb zu gelten, der aufgrund seiner universitären Studien in Wien und Italien einen neuen gelehrten Autorentyp verkörpert. Seine dem wittelsbachischen Herrscherhaus gewidmeten Werke umfassen ein breites Spektrum zwischen Unterhaltungsliteratur (Verdeutschung von De amore des Andreas Capellanus) und Fachprosa, wobei sein Alexanderroman nicht zuletzt als Fürstenspiegel gelesen werden konnte. Von der geistlichen Erbauung bis zur (als Bekämpfung von superstitio getarnten) Mantik bediente er alle literarischen Bedürfnisse am Hof.
Johannes Hartlieb war demnach als schriftstellender Arzt dem wittelsbachischen Hof in München aufs engste verbunden, wie beispielsweise folgende Widmung zeigt: Seyd nu das puch von dem grossen Alexander gar vil unzalperlicher stuck und capitel inne helt da durch ein furst groß adenliche tugent und manhait hören lassen und auch erlangen mag So hat der hochgebornn durchleuchtiger fürst hertzog Albrecht herzog in Bairen pfaltzgraffe bey rein und graue zu voburg auch seine allerdurchleuchtigste gemahel fraw anna von prawnschweigk gepornn nicht unpillich an mich maister Iohannsen doctor in ertzney und in naturlichen kunsten irem undertan begert und gepotten das puch des grossen alexanders zu teuschen machnn […]
Diese Vorrede zeigt die Widmung von Dr. Johannes Hartlieb an Herzog Albrecht III. und seine Gemahlin Anna von Braunschweig. Er soll also eine lateinische Biographie Alexanders des Großen ins Deutsche übersetzen. Der fürstenspiegelartige Text fügt sich ebenso wie die der Herzogin gewidmete Brandan-Legende in ein Prosakorpus mit erbaulich-belehrender Literatur. Auch Hartliebs medizinische Werke, etwa für Herzog Sigmund von Bayern-München, dienen dem wittelsbachischen Herrscherhaus.
Dazu zählte im Sinne der Belehrung für den wittelsbachischen Hof auch der fachlich und literarisch ambitionierte Reisebericht des aus altbayerischem Adel stammenden Hans von Schiltberg, der das Osmanische Reich und das Tatarische Reich durchstreift hatte. Seit 1427 stand dieser bayerische „Marco Polo“ in Diensten Albrechts III. Das Werk unterrichtet beispielsweise über die Biographie des Propheten Mohammed.
Noch wichtiger für die Literaturgeschichte der Residenzstadt München sowie den Herrschaftsbereich der Wittelsbacher ist freilich ein anderer Autor, der ob seiner Gelehrsamkeit und hohen schriftstellerischen Produktivität zu Recht den Titel praeceptor Bavariae führen müsste: Bei Johannes von Indersdorf nämlich ist an einen prägenden Einfluss im Sinne der spätmittelalterlichen Frömmigkeitstheologie zu denken, da er nicht nur als Beichtvater der Wittelsbacher fungierte – berühmt ist seine Rolle bei der Versöhnung Albrechts III. mit seinem Vater im Gefolge der tragischen Begebenheiten um Agnes Bernauer –, sondern seine zahlreichen und umfänglichen frühneuhochdeutschen katechetischen Werke im gesamten wittelsbachischen Herrschaftsgebiet verbreiten konnte. Dabei kam ihm zur Hilfe, dass er auf das Reformnetzwerk der Augustinerchorherren vertrauen konnte. Als Probst von Indersdorf stand er zudem einem dem Hause Wittelsbach eng verbundenen Augustinerchorherrenstift vor, das zu Recht als Hauskloster der Dynastie gelten darf.
III.
Der vielseitigste Schriftsteller, ja Künstler – im Vergleich zu den bislang Genannten gebührt eigentlich nur ihm dieser Titel – im wittelsbachischen München dieser Zeit war aber Ulrich Fuetrer, der als angesehener Maler in der Münchener Residenz arbeitete. Als Maler wirkte er an geistlichen Spielen mit, doch er fungierte auch als Hofdichter, wo er insbesondere in der Geschichtsschreibung und in der durchaus nostalgischen Ritterliteratur glänzte. Seinen Lanzelot-Roman legte er in Prosa wie in Titurelstrophen vor. In dieser kunstvollen Form verfasste er sein umfängliches Buch der Abenteuer, das dem Grals- und Artus-Stoff Raum bot, darunter Wolframs Parzival, Hartmanns Iwein, Pleiers Meleranz, Konrads von Würzburg Trojanischer Krieg, Wigalois, Persibein, Lanzelot und Merlin.
Diese absorbierte Stofffülle inspirierte ihn wohl auch zu seiner phantasievollen baierischen Geschichte, die der Humanist Aventin als lautter merl (alles nur Märchen!) abtat. Danach – so Fuetrer – lebte einst in Armenien ain junger fürst, der von grossem muet, auch hochem herzen war. Er machte sich auf und zog in diese landt, ietz Barien genant, und bewzang das mit gewaltiger hand unter sein hershaft. Nach der Eroberung, als er nun die land gewaltigklich herscht, da nannt er das land Bayrland; wan er hiess selb Bayr oder zu latein Bavarus. Darumb nannt auch er es nach seinem aigen namen.
Im Gegensatz zu dieser höfischen, um nicht zu sagen staatstragenden Literatur des Wahlmünchners Ulrich Fuetrer standen die eher stadtbürgerlichen Münchner Meistersinger, deren Bedeutung aber keineswegs mit den Meistersingern von Nürnberg vergleichbar war.
Dennoch aber war München im spätmittelalterlichen 15. Jahrhundert unbestritten zu einem wichtigen Zentrum deutschsprachiger Literatur geworden. Bedeutendere Autoren begegneten in der Residenzstadt freilich zunächst in lateinischer Sprache erst wieder während der Frühen Neuzeit im Zeitalter der Gegenreformation.
Die Wittelsbacher waren nämlich zu energischen Verteidigern der katholischen Glaubenslehre geworden und bedienten sich des jungen Jesuitenordens für die literarische Propaganda. Jesuitische Literatur wie die teilweise noch im 16. Jahrhundert begonnenen Dramen des Jacob Bidermann erfreuten sich großer Beliebtheit. Noch 1666 wurden seine Dramata sacra gedruckt, 1640 seine satirisch romanhafte Utopia. Bidermanns Gattungsspektrum umfasste etwa Comico-Tragoedia, Staatsaktion, Märtyrerdrama, Mirakelspiel oder Märchenallegorie. Jacob Bidermann, dessen Lehrjahre und erste dramatische Versuche ihn nach Augsburg, Dillingen, Ingolstadt und Landsberg führten, machte literaturgeschichtlich besonders mit seinem lange nachwirkenden Theaterereignis Cenodoxus (1602 Uraufführung in Augsburg) Furore, das stellvertretend für viele weitere Bühnenwerke wie etwa seine geistliche Verwechslungskomödie Philemon Martyr stehen soll.
Cenodoxus, ein Pariser Gelehrter des Hochmittelalters, ringt (durchaus faustisch) mit himmlischen und höllischen Mächten um sein Seelenheil, das er am Ende verlieren soll. Der barocke Antagonismus von Gut und Böse, Diesseits und Jenseits findet seine Entsprechung in der Personenkonstellation, wo dem Gelehrten sein dramaturgisch effektvoll konzipierter gewitzter Diener gegenübersteht, aber auch in konträren allegorischen Figuren oder Personifikationen. Vom Cenodoxus gab es auch eine populäre deutsche Version (Knittelversversion 1635 durch Joachim Meichel, der 1637 in München verstarb). Eine Münchner Perioche von 1609 brachte Bidermanns großen Wurf auf den Punkt:
Zu Pariß in Franckreich / war ein berühmter / hochgelehrter / vnd wie man vermainte ein sehr frommer vnd Gottseeliger Doctor. Nach dem er nun von disem Leben abgeschiden / vnnd auff bestimbten Tag die Besingnknuß zuhalten / in die Kirchen getragen: Richtet er sich in der Baar zu drey vnderschidlichen tägen auf: Ersten Tags bekennt er offentlich / wie daß er vor dem erschrecklichen Richterstuel Gottes seye angeklagt: Deß andern Tags / wie er verurthailt: Drittens / daß er aus gerechtem Vrthail verdambt sey worden. Auß disem erbärmlichen Spectackel wirdt Bruno / der selbiger Zeit zugegen / vnnd dieser trawrigen Besingknuß beygewohnt / dermassen bewegt / daß er alle weltliche Vppigkeit hindan gesetzt / vnnd den Orden der Cartheuser angehebt hat. Weil vns aber dises Doctoris Namen vnbewust / ist er in obgenanter Comoedi Cenodoxus genant worden / welches ein ruhmsichtiger / ehrgeitziger vnd hoffertiger verdeutscht wirdt: nicht darumben daz es bekant / daß er wegen seines Ehrgeitz / dises erschröckliche Vrthail außgestanden / sonder weil die sach an jhr selber bequemmer nicht hat können außgeführt werden / begeren jm deßwegen mit nichten nachthailich zusein. Dann wann er also gelebt wie es beschriben / geschicht jhm nicht vnrecht / wann aber dem nicht also / so haben wir eines anderen Leben / vnnd dises Todt beschriben.
In München wirkte Bidermann von 1606 bis 1614 als Lehrer am Jesuitenkolleg, ab 1615 war er als Professor der Theologie und Philosophie in Dillingen tätig. 1626 wurde er als Zensor seines Ordens nach Rom berufen, wo er bis zu seinem Tod 13 Jahre später blieb. Dennoch kann seine Bedeutung für die Wittelsbacher Residenz München kaum überschätzt werden.
Doch nicht nur die Residenzstadt München bringt Dichtkunst hervor. Zu nennen sind auch dichtende Adelige, wie etwa im 18. Jahrhundert Joseph August Graf von Törring. Für die Gattung des seinerzeit viel gespielten Ritterdramas ist (neben zahlreichen weiteren Vertretern) zuvorderst Joseph August Graf von Törring zu nennen, etwa mit Agnes Bernauerinn. Ein vaterländisches Trauerspiel, das ein ungeheurer Erfolg war und in Mannheim, Hamburg und Berlin inszeniert wurde. Der historische Stoff um den Wittelsbacher Albrecht III. verbindet geschichtliche Fundierung mit dem damals (1780) modernen Schema des bürgerlichen Trauerspiels, das in seinen besseren Vertretern (bei Lessings Emilia Galotti und Schillers Kabale und Liebe) tragisch endet, während die zahlreicheren Vertreter der Massengattung den gattungsinhärenten Standeskonflikt am Ende meist harmonisch auflösen. Interessanterweise folgt Törrings Bernauerinn dem tragischen Zug, wie auch in einem längeren Monolog der unglücklich liebenden Agnes Bernauer deutlich wird:
Ich war ja zufrieden mit meinem Stande; ich wollte ja nicht lieben; ich wäre ja nie unglücklich gewesen an meines Vaters Seite; mußt ich ihn sehen den Herzog? – Ja ich mußte, ich sollte: nur mein Albrecht konnte ausfüllen das Leere meines Herzens; nur er wars, bei dem das sehnende Klopfen des jungen Busens stockte: Er war des Mädchens Mann; – – und ich sein Mädchen. […] Allmächtiger! Tödte, oder gieb du mich dem Manne, den ich lieben, anbeten muß; oder nie gesehen haben sollte! – Verbrecherinn? – Du schufst mich ja? Du webtest in mein Innerstes das – nennt sich das, was mich in Albrechts Arme warf? – Du machtest ihn zum Sohn eines großen Fürsten, mich zur armen Burgerstochter. – Ich bin auch ein Mensch! Du bists auch, Albrecht! Ich bin unschuldig an deiner Würde. – Sollt ichs jemals büssen dich geliebt zu haben, weil du auch Herzog bist? […]
Mit dem bürgerlichen Trauerspiel – und bei Agnes Bernauer handelte es sich ja tatsächlich um eine Bürgerliche, die adelig werden wollte – des Grafen von Törring fassen wir eine Leitgattung des 18. Jahrhunderts.
IV.
Im 19. Jahrhundert lassen sich literaturgeschichtlich für die Residenzstadt München zwei größere literarische Strömungen unter der Ägide des wittelsbachischen Herrscherhauses dingfest machen. Unter Ludwig I. und Ludwig II. blühte eine im weiteren Sinne romantische Dichtung. Ludwig I. förderte nämlich die katholischen Dichter und auch den Sprachwissenschaftler und zeitweiligen Poeten Johann Andreas Schmeller. Unter Ludwig II. erfuhr Richard Wagner mit seinem romantischen Gesamtkunstwerk umfängliche Subventionierung, welche das Missfallen der missgünstigen Münchener Ministerialbürokratie erregte.
Eine ganz andere Literatur blühte unter König Maximilian II. Dieser berief viele sogenannte Nordlichter nach München. Der Dichter Heyse brachte es immerhin später zum Nobelpreis. Von daher kann man Maximilian II. als wirklich erfolgreichen Kulturpolitiker bezeichnen.
Um 1900 und in der sogenannten Prinzregentenzeit war München dann tatsächlich die bedeutendste deutsche Literaturstadt. Denn während im wilhelminischen Berlin die Zensur wütete, konnte in München sogar das seinerzeit bedeutendste Satiremagazin erscheinen: Im Simplicissimus und in anderen literarischen Zeitschriften wirkten bedeutende Schriftsteller, die sich auch in den Lokalen Schwabings trafen. Zu nennen sind Hermann Hesse und Ludwig Thoma. Heinrich und Thomas Mann. Heinrich George und Rainer Maria Rilke. Aber auch viele bedeutende Schriftstellerinnen. Diese literarische Blütezeit im toleranten München unter Prinzregent Luitpold fand ihr jähes Ende mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Damals glaubten viele Dichter wie Ludwig Thoma, Ludwig Ganghofer, Lena Christ, aber auch Thomas Mann, sie müssten nun einen propagandistischen Waffendienst mit Worten verrichten. Und mit dem Ende der Monarchie, der Räterepublik und den unruhigen Jahren bis zum Hitlerputsch 1923 bestimmte die Tagespolitik auch das literarische Geschehen. Doch dies ist eine ganz andere Literaturgeschichte.