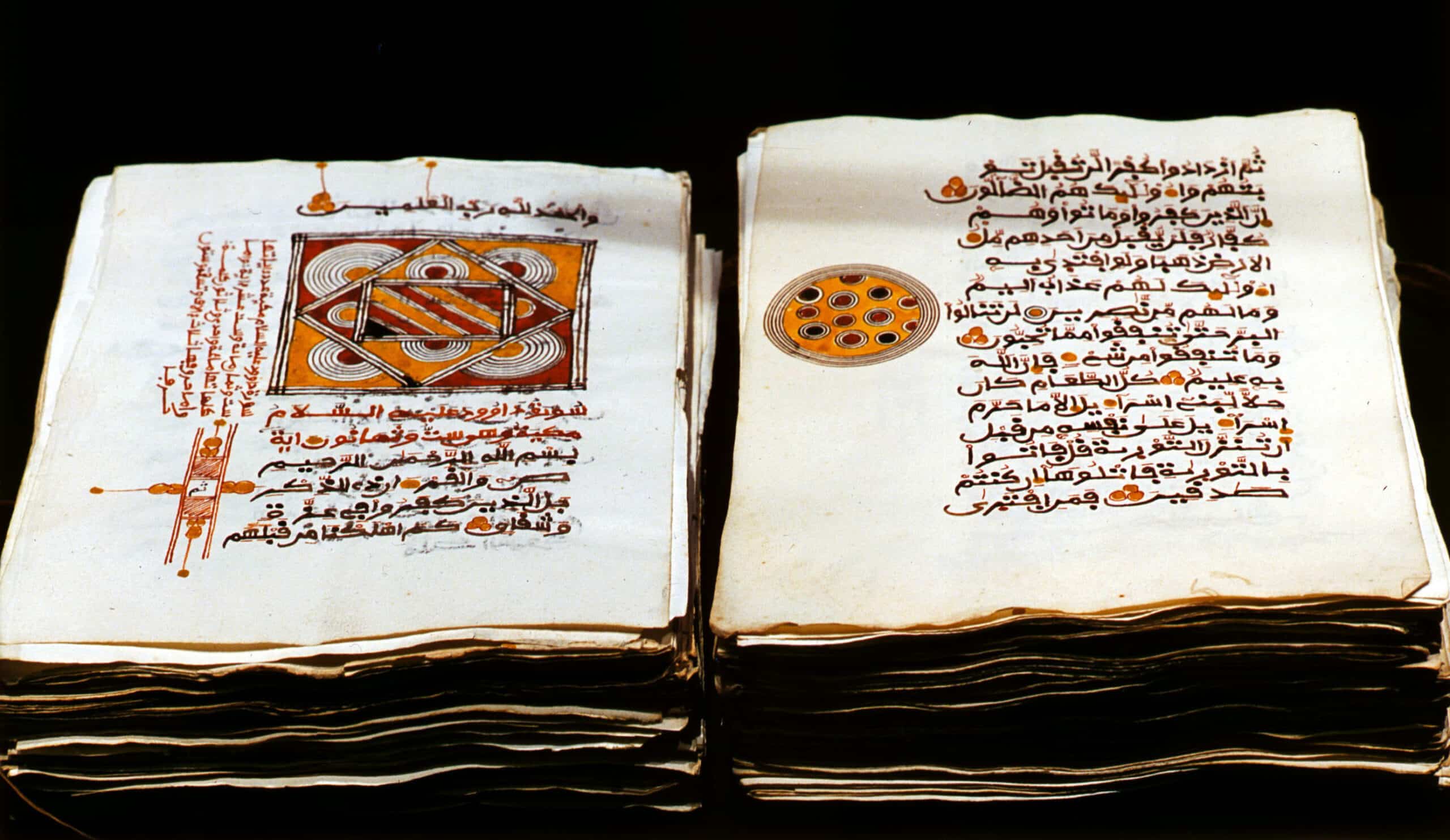Die Beschäftigung mit dem Koran in Europa stand lange Zeit unter dem Druck politischer und militärischer Konfrontation mit muslimischen Staaten und Heeren. Als das religiöse Buch von Feinden, die die Existenz der Christenheit ernsthaft gefährden, aufgefasst, wurde er nicht nur in polemischen Werken meistens als ein Teufelswerk voll sinnentstellten Seltsamkeiten verworfen. Selbst das Interesse an seiner Übersetzung rührte aus der Absicht, ihn zu widerlegen und seine Aussagen als falsch zu entlarven. Ein bekanntes Beispiel für einen solchen Umgang mit dem heiligen Buch des Islam bietet Nikolaus von Kues, der sich im Winter 1460/61 mit dem Koran unter dem Schock beschäftigte, der durch den Fall Konstantinopels sieben Jahre zuvor die damalige Christenheit erfasst hatte. In seiner Papst Pius II. gewidmeten „Sichtung des Korans“ (Cribratio Alkorani) bemüht sich Cusanus, „das Gesetzbuch der Araber“ zu verstehen. Ihm liegt die 1143 – also kurz vor dem zweiten Kreuzzug 1147-1149 – von Robert von Ketton im Auftrag von Petrus Venerabilis besorgte lateinische Übersetzung des Korans vor. Von christlichem Glaubenseifer motiviert, siebt Cusanus den Koran, den er als ein heterogenes Amalgam aus jüdischen, häretisch-christlichen und heidnischen Überlieferungen betrachtet, um Elemente herauszufiltern, die ihm helfen sollten, die christliche Lehre zu verteidigen. Dieser liegt eine weitere Absicht nahe: Muslime zum wahren, nämlich dem christlichen Glauben hinzuführen. Nikolaus von Kues gehörte zu einer langen, schon im 8. Jahrhundert begonnenen, im christlichen Osten und Westen betriebenen Tradition der Polemik und Apologetik gegen den Islam, seinen Propheten und vor allem sein Buch.
Anfänge der deutschsprachigen Koranrezeption
Also auch als Folge der damaligen politischen Großwetterlage erschien 1772 in Frankfurt am Main die erste deutsche Koranübersetzung aus dem Arabischen von David Friedrich Megerlin unter dem Titel „Die türkische Bibel“. Das Islambild hierzulande wurde damals von den Türkenkriegen geprägt.
Goethe, der diese Übersetzung als „elende Produktion“ bezeichnete, schilderte 1819 in den „Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-östlichen Divans“ seine komplexe Haltung zum Koran. Demnach sei dieser ein Buch, „das uns, so oft wir auch daran gehen, immer von neuem anwidert, dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnötigt.“ Diese Aussage markiert eine neue Phase der Wahrnehmung des Korans im deutschsprachigen Raum, die nun immer weniger religiöse Polemik und Apologetik in den Vordergrund stellt und stattdessen eher ästhetische wie auch religionshistorische Interessen verfolgt. Zu diesem Perspektivenwechsel trug sicherlich bei, dass ab etwa Mitte des 17. Jahrhunderts an europäischen Universitäten die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Orient, seinen Sprachen und Religionen ansetzte. Diese Beschäftigung erhielt später durchaus romantisierende Züge, nicht zuletzt im Werk des Dichters und Orientalisten Friedrich Rückert, der während seiner Tätigkeit an der Universität Erlangen von 1826 bis 1841 umfangreiche Teile des Korans dichterisch ins Deutsche übertrug.
Mit seinem bahnbrechenden Werk Geschichte des Qorans von 1860 etablierte Theodor Nöldeke die historisch-kritische Methode der Koranforschung. Die zweite Auflage des Werkes in drei Teilen, von Friedrich Schwally und anderen Schülern Nöldekes bearbeitet, in 1909, 1919 und 1938 sukzessive erschienen, gilt nach wie vor als das solide Fundament der modernen Koranhermeneutik. Inzwischen genießt der Koran in Europa und Nordamerika vielfältiges Interesse von Wissenschaftlern, die seine Entstehung im Kontext, seine Intertextualität mit den beiden Testamenten der Bibel sowie mit jüdischen und christlichen Werken der Spätantike behandeln und auch hellenistische Bilder und Gedanken in diesem arabischen Buch aufdecken. Neue Forschungsprojekte, wissenschaftliche Gesellschaften und Zeitschriften widmen sich dem Koran. Die Ergebnisse neuerer Forschung werden in zahlreichen Publikationen dokumentiert. Auch sind in den letzten Jahren nicht wenige neue Koranübersetzungen erschienen. Aus divergenten Motiven heraus läuft die Beschäftigung mit dem Koran gegenwärtig auf Hochtouren. So bringt z.B. der versöhnliche Eifer eine renommierte Stimme auf dem Gebiet dazu, den Koran als ein europäisches Buch zu deklarieren. Eine andere provozierende Stimme will dagegen dem Koran eine syrisch-aramäische Version des Textes zugrunde legen. Im Zeitalter betonter Diversität richten sich Blicke aus vielen unterschiedlichen Fachrichtungen auf den Koran; und er hat der Forschung noch reichlich viel zu bieten.
Entstehungsgeschichte des Koran
In einem arabischen, ideengeschichtlich heterogenen Kontext entstanden, in dem neben paganen – arabischen und persischen – auch jüdische und christliche Überlieferungen unterschiedlicher Prägung kursierten, ist der Koran alles andere als ein monolithisches Werk – weder sprachlich noch inhaltlich. Die recht frühen, in Mekka verkündeten Suren unterscheiden sich im Stil und Inhalt so sehr von den späteren in Medina entstandenen Suren, dass man mehrere Autoren hinter diesen Texten vermuten würde, würde man den Koran nicht als eine Offenbarung, sondern als ein Menschenwerk auffassen. Diese Diskussion ist aber nicht Thema der gegenwärtigen Betrachtung.
Bei den folgenden Überlegungen gehe ich von der hermeneutischen Grundannahme aus, dass der Koran eine arabische Verkündigung aus der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts ist, in der weitgehend auf die Bibel und die darauf basierende religiöse Literatur des östlichen Christentums und Judentums rekurriert wird. Nach islamischem Glauben wurde der Koran vom Propheten Muhammad verkündet; dieser soll ab dem Jahre 610 bis zu seinem Tod in 632 vom Engel Gabriel göttliche Offenbarungen mündlich empfangen haben, die er seinem Umfeld ebenfalls mündlich mitteilte. Die verkündeten Passagen variieren stark in Länge und Inhalt; sie wurden wiederholt rezitiert und mündlich tradiert. Nicht zufällig heißt dieses Werk qur’ān, ein aus dem Syrisch-Aramäischen abgeleitetes Wort im Sinne von Rezitation. Im Koran selbst wird dieser Begriff hauptsächlich in drei Bedeutungen verwendet. Diese sind: der Akt der Rezitation (wie z. B. in Q 75:17-18), der partielle Gegenstand der Rezitation (Q 84:21) und schließlich die Gesamtheit der rezitierten Passagen (Q 9:111).
Damit gelangen wir zum Thema der Vielstimmigkeit des Korans. Sie begleitet ihn von Beginn an. Der große Korangelehrte as-Suyūṭī (gest. 1505 in Kairo) stellt in seinem summarischen Kompendium der Koranwissenschaften al-Itqān fī ʿulūm al-qur’ān (Die Beherrschung der Koranwissenschaften) fest, dass Muhammad die Offenbarungen unter Glockengeläut, durch Inspiration des Heiligen Geistes in sein Herz, durch Gabriel in Menschengestalt oder unmittelbar von Gott im Traum oder im Wachzustand erhalten hat. Die Genese des Korans ist also schon auf der allerersten Ebene der ursprünglichen Mitteilung der Offenbarungen durch Vielstimmigkeit gekennzeichnet. Daher kann Muhammad mit Recht als der erste Interpret der offenbarten Mitteilungen betrachtet werden: Er nahm sie wahr, entdeckte ihren Sinn und vermittelte sie seinen Zuhörern auf eine sinnvolle Art und Weise. Dass dies der traditionell-islamischen Auffassung widerspricht, Muhammad sei bloß ein passives Medium der Offenbarung und Analphabet gewesen, sei im gegenwärtigen Zusammenhang dahingestellt. Doch welche Stimmen lässt der Korantext selbst vernehmen?
Die Stimme des Sprechers
Zuallererst ist die Stimme des koranischen Sprechers, die Stimme Gottes – dem Glauben nach – zu hören. In den gemäß der Tradition erstoffenbarten Versen fordert diese Stimme einen ungenannten Mann (der Überlieferung nach: Muhammad) auf, zu lesen, d.h. nach damaliger Gewohnheit laut zu lesen bzw. vorzutragen: „Trag vor im Namen deines Herrn, der schuf, den Menschen aus Geronnenem schuf! Trag vor! Denn dein Herr istʼs, der hochgeehrte der mit dem Schreibrohr lehrte, den Menschen, was er nicht wusste, lehrte.“ (Q 96:1-5). (Wenn nicht anders angegeben, so stammen die Koranzitate aus: Hartmut Bobzin, Der Koran. München: C.H. Beck, 2. Auflage 2017.) Der koranische Sprecher befiehlt einem Menschen, zu sprechen. Dem traditionellen Bericht zufolge verneinte Muhammad, dass er lesen könne. Er hatte Recht: unabhängig davon, ob er des Lesens mächtig war oder nicht, verfügte er noch über keine Mitteilungen, die er hätte vorlesen können.
Folgenden Befehl soll der koranische Sprecher nach einer Weile Muhammad erteilt haben: „Du Eingehüllter! Steh auf und warne, und deinen Herrn, den preise, und deine Kleider, die reinige, und Unreinheit, die meide, und sei nicht mildtätig, auf Gegengaben hoffend, und harre deines Herrn!“ (Q 74:1-7). Der sich aus Angst und Ehrfurcht verhüllende Muhammad wird nun aufgefordert, seine prophetische Aufgabe wahrzunehmen. Dazu gehören innere Reinheit und Standhaftigkeit. Dem Befehl, den er als göttlich wahrnimmt, leistet er unverzüglich Folge.
Im Laufe der Verkündigung erteilt der koranische Sprecher dem Propheten direkt Befehle mittels des Imperativs „qul“, „sprich, sage“, der im Koran 332 Mal vorkommt. An all diesen Stellen wird ihm wörtlich mitgeteilt, was er sagen soll. Ein berühmtes Beispiel ist Sure 112, al-Iḫlāṣ, ein Titel, der so viel wie das reine Glaubensbekenntnis der Einheit Gottes bedeutet:
„Sprich: Gott ist Einer, Ein ewig reiner, Hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner, Und nicht ihm gleich ist einer.“ (Q 112 in der Übersetzung von Friedrich Rückert).
Die Betonung der Einheit Gottes, der niemanden zeugte noch gezeugt wurde und dem niemand gleich ist, dürfte weniger eine Zurückweisung der heidnischen Vielgötterei als eine Ablehnung der christlichen Lehre von der Göttlichkeit Jesu Christi sein, der nach dem Nicaenum von Gott dem Vater gezeugt wurde, mit dem er eines Wesens ist (ὁμοούσιον τῷ Πατρί).
An vielen Stellen legt der koranische Sprecher dem Propheten in den Mund, was er in Antwort auf praktische Fragen und theologische Argumente sagen soll. An einer markanten Stelle äußert sich der koranische Sprecher kritisch gegen Muhammad, der einen ihn suchenden Blinden vernachlässigend abwies und stattdessen seine Aufmerksamkeit einem reichen Mann schenkte:
„Er blickte finster drein und wandte sich ab, dass der Blinde sich an ihn gewandt. Was lässt dich wissen, ob er sich vielleicht noch läutere oder sich mahnen lasse, dass ihm die Mahnung nütze? Wer aber sich auf seinen Reichtum stützt, dem schenkst du Beachtung, und es stört dich nicht, dass er sich nicht läutert. Der aber, der eilends zu dir kommt und der Gott fürchtet, dem schenkst du keine Aufmerksamkeit.“ (Q 80:1-10).
Der koranische Sprecher tritt nicht nur erzählend und befehlend auf. In frühen Suren spricht er Schwüre aus. Während Gott im Buch Genesis 22:16 bei sich selbst schwört, „da er bei keinem Größeren schwören konnte“, wie es später im Brief an die Hebräer 6:11 heißt, schwört der koranische Sprecher bei Naturphänomenen wie der Nacht, dem Morgen, der Sonne, dem Mond, aber auch bei den Feigen- und Ölbäumen, bei aufwirbelnd laufenden Pferden, beim Himmel und beim Gestirn, beim Tag der Auferstehung, dem Koran selbst und beim Herrn des Ostens und des Westens. Solche Schwüre könnten eine Fortsetzung des Brauchtums vorislamisch-arabischer Wahrsager sein, die der Überlieferung nach ähnliche Schwurformeln verwendet haben, damit ihre Aussagen glaubwürdig klingen. Sich dem Prinzip verpflichtend, die Menschen derart zu adressieren, dass sie geäußerte Aussagen verstehen können, eignet sich der koranische Sprecher offenkundig diese heidnische Praxis an, die in seinem Kontext geachtet und mit divinatorischen Fähigkeiten verbunden war, um seinen Zuhörern Glauben an seinen Aussagen abzugewinnen. Muhammad predigte zwar in der Wüste, er wusste jedoch genau, wie er sein Publikum ansprechen sollte. Sein Erfolg beruht zum Teil darauf.
Die Stimme des Gegners
Neben dem koranischen Sprecher und dem Verkünder seiner Mitteilungen sprechen auch die Gegner in der unmittelbaren Umgebung der Verkündigung. Sie werden zitiert und widerlegt, wie die folgende Passage veranschaulicht:
„Doch manche Menschen sagen: ‚Wir glauben an Gott und an den Jüngsten Tag.‘ Sie glauben aber nicht. Sie suchen Gott zu betrügen und jene, welche glauben, betrügen aber nur sich selbst, ohne es zu merken. Eine Krankheit ist in ihren Herzen, ja, Gott lässt die Krankheit schlimmer werden. Schmerzhafte Strafe ist ihnen bestimmt – dafür, dass sie gelogen haben. Sagt man zu ihnen: ‚Richtet auf der Erde kein Unheil an!‘, dann sagen sie: ‚Wir sind es doch, die Heil bewirken!‘ Doch sind nicht sie die Unheilstifter, ohne es zu merken? Sagt man zu ihnen: ‚Glaubt, wie die anderen glauben!‘, so sagen sie ‚Sollen wir denn wie die Toren glauben?‘ Doch sind nicht sie die Toren, ohne es zu wissen? Und wenn sie jene treffen, welche glauben, so sagen sie ‚Wir glauben!‘ Doch wenn sie dann mit ihren Satanen alleine sind, so sagen sie: ‚Wir sind auf eurer Seite! Wir sind ja doch nur Spötter!‘ Doch Gott wird seinen Spott mit ihnen treiben und sie in ihrem Aufruhr verblendet taumeln lassen. Die da den Irrweg kauften statt der Leitung, so dass ihr Handel kein Gewinn war und sie nicht rechtgeleitet waren.“ (Q 2:8-16).
Muhammads Gegner glaubten nicht, dass Menschen göttliche Boten sein könnten. Sie akzeptierten offensichtlich die Möglichkeit, von den Göttern Nachrichten zu erhalten, verbanden ein solches Ereignis jedoch mit göttlichen Erscheinungen, die Muhammad nicht anbieten konnte. Darin sahen sie einen Beweis dafür, dass seine Verkündigung nicht von Gott, sondern das Werk eines Dichters, eines Besessenen oder eines fremden Informanten sei. Sie wollten einem aus ihren eigenen Reihen keinen Glauben schenken. Sie sprachen: „Einem Menschen einem einzigen von uns, sollten wir folgen.“ (Q 54:24). Muhammad wird ebenfalls aus diesem Grund mit Ablehnung konfrontiert: „‘Wir werden dir nicht eher glauben, als bis du aus der Erde eine Quelle für uns sprudeln lässt oder bis du einen Garten hast mit Dattelpalmen und Weinstöcken und dann bewirkst, dass zwischen ihnen Bäche sprudeln; oder bis du den Himmel – wie du behauptet hast – in Stücken über uns fallen lässt oder bis du Gott und die Engel beibringst als Bürgen oder bis du ein Haus hast voller Prunk oder gar in den Himmel aufsteigst. Und deinem Aufstieg werden wir nicht eher Glauben schenken, bis du ein Buch zu uns herniedersendest, das wir lesen können.‘ Sprich: ‚Preis sei Gott! Bin ich etwas anderes als ein menschlicher Gesandter?‘ Es hinderte die Menschen nichts daran zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, als dass sie sagten: ‚Hat Gott uns etwa einen Menschen als Gesandten hergeschickt?‘“ (Q 17:90-94). Darin ähnelten Muhammads Gegner früheren Zweiflern: „Dies deshalb, weil zu ihnen ihre Gesandten mit den Beweisen kamen. Sie aber sprachen: ‚Soll denn ein Mensch uns führen?‘ Da wurden sie ungläubig und wandten sich ab. Doch Gott ist sich selbst genug. Gott ist auf keinen angewiesen, er ist hoch zu rühmen.“ (Q 64:6). Muhammads Antwort darauf lautet: „Sprich: ‚Ich sage nicht zu euch: ‚Gottes Vorratskammern sind bei mir!‘ Auch das Verborgene kenne ich nicht. Und ich sage nicht zu euch: ‚Ich bin ein Engel!‘ Ich folge nur dem, was mir eingegeben wird.‘ Sprich: ‚Stehen der Blinde und der Sehende auf einer Stufe?‘ Denkt ihr denn nicht nach?“ (Q 6:50).
Die ungläubigen Araber werden im Koran zitiert:
„Sie sagen: ‚Es gibt nichts anderes als unser Leben hier in dieser Welt. Wir sterben, und wir leben. Es ist allein die Zeit, die uns zugrunde richtet.‘ Doch haben sie kein Wissen darüber, sie gehen allein Vermutungen nach. Wenn ihnen unsere Verse als Beweise vorgetragen werden, dann ist ihr einziges Argument: ‚Bringt unsere Väter herbei, wenn ihr wahrhaftig seid.‘“ (Q 45:24-25). Sie bekunden an dieser Stelle ihre Überzeugung, dass es nur dieses Leben gibt und dass die schicksalhafte endlose Zeit die Quelle des Todes und allen Unheils ist, eine im vorislamischen Arabien offensichtlich verbreitete Auffassung, die wiederum eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der koranischen Konzeption der menschlichen Willensfreiheit und göttlichen Prädestination spielt.
Auch die „Buchbesitzer“, das sind im Koran die Juden und die Christen, die über Offenbarungsbücher verfügen, kommen im Koran zu Wort. Mit ihnen wird debattiert; in diesem argumentativen Zusammenhang werden die theologischen Lehren des Korans entwickelt:
„Sprich: ‚Ihr Buchbesitzer! Kommt her zu einem Wort zwischen uns und euch auf gleicher Ebene! Dass wir keinem dienen außer Gott, dass wir ihm nichts beigesellen und dass wir uns nicht untereinander zu Herren nehmen neben Gott.‘ Und wenn sie sich abwenden, sprecht: ‚Bezeugt, dass wir ergeben sind!‘“ (Q 3:64). Und weiter heißt es:
„Ihr Buchbesitzer! Geht nicht zu weit in eurer Religion, und sagt nur die Wahrheit über Gott! Siehe, Christus Jesus, Marias Sohn, ist der Gesandte Gottes und sein Wort, das er an Maria richtete, und ist Geist von ihm. So glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt nicht: ‚Drei!‘ Hört auf damit, es wäre für euch besser. Denn siehe. Gott ist ein Gott; fern sei es, dass er einen Sohn habe. Sein ist, was in den Himmeln und auf Erden ist. Gott genügt als Anwalt.“ (Q 4:171).
Die Stimme der Zeiten
Gleichsam bedeutend wie die Auseinandersetzung mit aktuellen Gesprächspartnern in der Gegenwart der Verkündigung ist die Erzählung von Geschichten aus altarabischen Traditionen sowie aus dem biblischen und postbiblischen Repertoire des Judentums und Christentums. Die Geschichten folgen einer bestimmten Typologie: Gott sendet einer Volksgemeinschaft einen Gesandten aus ihrer Mitte, er findet unter seinen Mitmenschen keine Zustimmung und wird sogar verfolgt, Gott interveniert und setzt schließlich seine Botschaft durch. Diese Geschichten machen einen Großteil des Korantextes aus. Bis auf die Geschichte Josephs, die nur einmal vollständig in Sure 12 erzählt wird, werden die Geschichten früherer biblischer und arabischer Propheten bruchstückhaft und zum Teil mit Wiederholungen erzählt. Der koranische Sprecher fungiert als Geschichtenerzähler, der für die Bildung Muhammads die Narrationen als Teil der Offenbarung mitteilt (Q 12:3). Vergangene Personen und Ereignisse werden narrativ in die aktuelle Gegenwart der Verkündigung eingebunden; Muhammad wird aufgefordert, sich ihrer zu erinnern (Q 19:2, 16). Der koranische Geschichtenerzähler berichtet nicht ausschließlich über vergangene Geschehen, sondern lässt seine Figuren direkt selbst sprechen; es entstehen lebhafte Dialoge, die die vergangenen Ereignisse als gegenwärtige darstellen. Die Stimmen aus der Vergangenheit werden lebendig, präsent. Ihre Rede fließt in die Verkündigung mit ein. Ihre Präsenz ist nicht nur literarischer Natur; sie soll bewirken, dass Muhammads Verkündigung bei den Zuhörern an Authentizität und Autorität gewinnt. Die Referenzfiguren werden deshalb in den meisten Fällen nicht in der dritten Person in Abwesenheit behandelt, sondern in die Präsenz geholt und kommen selbst zu Wort. Mit ihnen wird die vorausgegangene Heilsgeschichte Teil der Gegenwart Muhammads, der sich dadurch in die Reihe der Propheten einordnen kann. Aus lebhafter Erinnerung kann er in Bedrängnis Kraft schöpfen. Die Stimmen seiner männlichen Vorgänger und Mariä sollen seiner Stimme Macht verleihen, indem sie in seiner Verkündigung mit erklingen. Der Koran bezeichnet sich selbst als eine „ermahnende Erinnerung“ (Q 74:54). Die Erinnerung ist im koranischen Menschenbild essenziell, da die Ursünde des Menschen aus koranischer Sicht darin bestand, Gottes Gebot vergessen zu haben: „Wir hatten früher schon mit Adam einen Bund geschlossen, doch er vergaß ihn; wir fanden bei ihm keinen festen Willen.“ (Q 20:115).
Unter den prophetischen Stimmen vor Muhammad ragen die von Noah, Abraham, Mose und Jesus besonders heraus. Noah ist derjenige, der von seinem Volk ausgelacht und verschmäht wird, weil er den Befehl Gottes standhaft durchführt (Q 11:38). Abraham glaubt an den einen Gott, zerschmettert die Götzen seines Volkes und wandert aus (Q 21:51-69). Muhammad beansprucht, den reinen Monotheismus Abrahams wiederherzustellen und sieht sich ihm am nächsten. Der meisterwähnte Prophet im Koran ist aber Moses. Er führt sein Volk in die Freiheit und erhält von Gott ein Buch, die Thora (Q 2:53-54). Ein anderes Offenbarungsbuch, das Evangelium, ist Jesus gegeben worden. Im Koran spricht er in der Wiege und ist der einzige Mensch, der Heilungswunder vollbrachte und Tote erweckte. Der Koran lässt ihn jedoch jede göttliche Charakterisierung von sich ablegen und bekräftigen, er sei nur ein Mensch und treuer Knecht Gottes:
„Damals, als Gott sprach: ‚Jesus, Marias Sohn! Gedenke meiner Gnade, die ich dir und deiner Mutter erwies! Damals, als ich dich stärkte mit dem Heiligen Geist, als du zu den Menschen sprechen solltest – in der Wiege und im Mannesalter. Damals, als ich dich lehrte – das Buch, die Weisheit, das Gesetz und das Evangelium. Und damals, als du aus Ton etwas schufst, was die Gestalt von Vögeln hatte, mit meiner Erlaubnis, es dann anbliesest, so dass es wirklich Vögel wurden, mit meiner Erlaubnis, und Blinde heiltest und Aussätzige, mit meiner Erlaubnis, und damals, als du die Toten herausbrachtest, mit meiner Erlaubnis. Damals, als ich die Kinder Israel von dir fernhielt, als du mit den Beweisen zu ihnen kamst, da sprachen die Ungläubigen unter ihnen: ‚Das ist doch nichts als klarer Zauber!‘“ (Q 5:110).
„Und damals, als Gott sprach: ‚O Jesus, Sohn Marias, hast du den Menschen denn gesagt: ‚Nehmt mich und meine Mutter zu Göttern neben Gott‘?‘ Er sprach: ‚Gepriesen seist du! Mir steht nicht zu, dass ich etwas sage, wozu ich nicht berechtigt bin. Und hätte ich es gesagt, so weißt du es; du weißt ja, was in meinem Inneren ist, doch ich weiß nicht, was in deinem Inneren ist. Siehe, du bist es, der die Verborgenheiten am besten kennt.‘“ (Q 5:116).
Genauso wie Vergangenes vergegenwärtigt wird, wird im Koran auch Künftiges, insbesondere Apokalyptisches und Eschatologisches, prognostiziert. An vielen Stellen verwendet der Koran bei der Beschreibung solcher Szenen den prophetischen Perfekt. Dadurch wird bewirkt, dass futurische Ereignisse als bereits geschehen geschildert werden. Auch hier erheben sich Stimmen. Neben der Stimme Gottes, des allmächtigen allwissenden Richters, sprechen am Jüngsten Tag die Menschen, die zur Rechenschaft gezogen werden: „Am Tag, an dem die Ungläubigen dem Feuer vorgeführt werden: ‚Ist das nicht die Wahrheit?‘ Sie sprechen: ‚O ja, bei unserem Herrn!‘ Er spricht: ‚So schmeckt die Strafe dafür, dass ihr ungläubig wart!‘“ (Q 46:34). In der Hölle sprechen die Sünder; sie stellen eindrucksvoll die unermesslichen Qualen, die sie erleiden müssen, dar:
„Die nicht glauben, führt man zur Hölle hin in Scharen. Sind sie dort angekommen, werden ihre Pforten aufgetan, und die Wärter sagen dort zu ihnen: ‚Kamen denn keine Gesandten zu euch von euren eigenen Leuten, um euch die Verse eures Herrn vorzutragen und euch zu warnen vor der Begegnung mit diesem eurem Tag?‘ Sie werden sprechen: ‚Ja doch!‘ Doch für die Ungläubigen ist das Wort der Strafe wahr geworden.“ (Q 39:71).
Im Paradies sprechen die belohnten Gläubigen, die triumphierend ihren erstrebenwerten Wohlstand beschreiben:
„Die ihren Herrn fürchten, führt man zum Paradiesesgarten hin in Scharen. Sind sie dort angekommen, werden seine Pforten aufgetan, und die Wärter sagen dort zu ihnen: ‚Friede sei mit euch! Es soll euch wohlergehen! So betretet ihn für ewig!‘ Sie werden sagen ‚Lobpreis sei Gott, der sein Versprechen an uns wahr gemacht und uns die Erde erben ließ. Nun können wir im Paradiesesgarten weilen, wo wir wollen.‘ Wie schön ist doch der Lohn derer, die Gutes tun!“ (Q 39:73-74).
Verglichen mit dem Neuen Testament beschreibt der Koran reichlich solche Szenen. Die Beschreibungen sind sinnlich, fassbar, eindrucksvoll. Sie sollen auf die unmittelbaren Rezipienten der Verkündigung massiv einwirken, indem die betroffenen Personen selber ihre Lage beschreiben.
Nicht nur die Engel sprechen im Koran: „Damals, als dein Herr zu den Engeln sprach: ‚Siehe, einen Nachfolger will ich einsetzen auf der Erde!‘ Da sprachen sie: ‚Willst du jemanden auf ihr einsetzen, der Unheil auf ihr anrichtet und Blut vergießt – wo wir dir Lobpreis singen und dich heiligen?‘ Er sprach: ‚Siehe, ich weiß, was ihr nicht wisst.‘“ (Q 2:30). Auch die Dämonen (Dschinnen) kommen zu Wort, um seine wundersame Natur zu bestätigen: „Sprich: ‚Bedeutet wurde mir, dass eine Schar von Dschinnen lauschte. Sie sprachen: ‚Wir hörten einen wundersamen Vortrag, der auf den rechten Weg führt. An ihn glauben wir und werden unserem Herrn keinen beigesellen!‘“ (Q 72:1-2). Satan wird als einer von ihnen vorgestellt: „Damals, als wir zu den Engeln sprachen: ‚Fallt vor Adam nieder!‘ Da fielen alle nieder, außer Iblis, der zu den Dschinnen zählte und sich dem Geheiß seines Herrn verweigerte. Wollt ihr euch denn ihn und seine Sippschaft statt meiner zu Freunden nehmen – wo sie euch doch feind sind? Welch schlechter Tausch ist das wohl für die Frevler!“ (Q 18:50). Im Gespräch mit Gott begründet er quasi naturwissenschaftlich, warum er vor dem neugeschaffenen Adam nicht in die Knie geht. Danach verspricht er, die Menschen vielfältig zu verführen:
„Wir erschufen euch, dann gestalteten wir euch. Dann sprachen wir zu den Engeln: ‚Werft euch vor Adam nieder!‘ Da warfen sie sich nieder, außer Iblis – er gehörte nicht zu denen, die sich niederwarfen. Er sprach: ‚Was hielt dich davon ab, niederzufallen, da ich es dir befahl?‘ Er sprach: ‚Ich bin besser als er. Mich schufst du aus Feuer, ihn schufst du aus Lehm.‘ Er sprach: ‚Steige herab aus ihm! Es steht dir nicht an, dich in ihm hochmütig zu zeigen. So geh hinaus! Siehe, du bist einer der Geringgeachteten.‘“ (Q 7:11-18).
Der Reiz der Mehrstimmigkeit
Dem traditionellen islamischen Glauben nach ist der Koran die Rede Gottes, herabgesandt auf den Propheten Muhammad, der sie ohne eigenes Zutun verkündete. Die oben angeführte Darstellung macht allerdings deutlich, dass die in der ersten Person Singular und Plural sprechende göttliche Stimme nicht die einzige im Koran vernehmbare ist. Eine Fülle von anderen Stimmen kommt dort ebenfalls zur Sprache. Der koranische Sprecher baut ihre Reden in seine Rede ein. Diese ist nicht einstimmig, sondern mehrstimmig; sie ist nicht monologisch, sondern dialogisch. Ihre Dialogizität besteht nicht nur in den Dialogen, die der koranische Sprecher mit menschlichen Gesprächspartnern – auch mit Muhammed, wie etwa in Q 33:1,28,45,50-52 – führt. Viel gewichtiger in diesem Zusammenhang sind die Gespräche, die andere Sprecher – das sind Engel, Dämonen und Menschen: Propheten, Gläubige, Frevler, Zweifler, Gerettete, Verdammte – miteinander führen und die als Bestandteil der Offenbarung verkündet werden. Es wird nicht nur über sie geredet, sondern sie selber äußern sich, sie werden zitiert, ihre Worte werden wiedergegeben, wenn sie in der Vergangenheit gesagt wurden, und vorweggenommen, wenn sie in der antizipierten Zukunft gesprochen werden. Vergangenes und Künftiges gleichermaßen sind Gegenstand des umfassenden göttlichen Wissens. Denn alle Zeiten sind im Blick Gottes erfasst. Doch das ist hier nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist vielmehr, dass sich all diese Stimmen äußern und dass ihre Äußerungen als Teil der göttlichen Rede gelten – mit dem islamischen Glauben gesprochen. Dass solche Äußerungen in den biblischen Büchern vorkommen, wundert nicht, denn diese sind von Menschen verfasst worden, die über vergangene Geschehnisse berichteten, also auch über Gespräche, die im Rahmen dieser Geschehnisse stattgefunden hatten. Dem Koran wird im Islam ein anderer Status zugeschrieben: er ist Gottes verbale Rede. Darin liegt der Reiz seiner Mehrstimmigkeit. Der koranische Sprecher, d.h. die Stimme Gottes nach dem Glauben des Islam, integriert andere Stimmen, selbst die satanische, in seine Rede. Seine Rede gestaltet sich damit zu einem polyphonen Ensemble von unterschiedlichen Tönen und Inhalten. An manch einer Stelle gleicht die Rede dem Operngesang. Solosänger und Chöre erheben ihre Stimmen: einmal nacheinander, dann wieder gleichzeitig; die Stimmen folgen einander einmal langsam, ein anderes Mal im raschen Rhythmus; hier sind sie hoch, dort plötzlich sind sie leise; sie können einzeln zu hören sein, dann gehen sie ineinander über und bilden ein polyphones Tableau, in dem es nicht mehr leicht fällt, die einzelnen Wörter noch voneinander zu unterscheiden. Vielstimmigkeit kann Ambiguität erzeugen.
Ähnlich verhält es sich mit dem koranischen Text. Er enthält mehrdeutige Ausdrücke, unklare Stellen und vielschichtige Passagen. Es ist eine echte Herausforderung, sich mit dem Koran hermeneutisch zu befassen. Die umfangreiche koranexegetische Tradition mit zahlreichen, meistens mehrbändigen Werken hervorragender Kommentatoren von frühislamischer Zeit bis in die Gegenwart – genauso wie die Bemühungen moderner Wissenschaftler in Ost und West um ein besseres Verständnis seines Textes – bezeugen diese Tatsache. Dem Korantext wohnt die Diversität inne. Viele Sprecher bilden sein Gefüge. Sie äußern sich zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Intentionen und unterschiedlichen Worten. Ihre Reden auszulegen und in Verhältnis zueinander zu setzen, erfordert umfangreiches philologisches, literarisches, historisches, religionswissenschaftliches und theologisches Wissen sowie starke analytische Fähigkeiten.
Nimmt man die Vielstimmigkeit des Korans zum Ansatzpunkt der Betrachtung, erscheint er als dichtes Kommunikationsnetzwerk. Daran beteiligen sich die göttliche Stimme sowie Menschen und Geister. Ihre Kommunikationen bilden die Gesamtheit des Koran. Er ist nicht nur die Rede einer einzigen, sondern vieler aufeinander bezogener Stimmen. Sie kommen alle zur Sprache, sie artikulieren ihre Absichten und Interessen, als Performanten von Sprechakten nehmen sie am Offenbarungstext teil. Der koranische Sprecher unterdrückt sie nicht, sondern nimmt sie in seine Rede als voll integrierte Kommunikationen auf.
Die Wahrnehmung der immanenten Mehrstimmigkeit des Korans ist von gewichtiger Bedeutung für die weitere Entwicklung einer Koranhermeneutik, die mit modernen wissenschaftlichen Mitteln die diversen Artikulationen, Stimmen und Stimmlagen der Kommunikationspartner im Koran analysiert und den tiefen Sinn seiner Aussagen interpretiert. Aufgrund der inneren Diversität koranischer Rede muss eine solche Koranhermeneutik auf Interdisziplinarität hin ausgerichtet sein. Der Koran selbst lädt zu einem solchen Unternehmen ein. Denn ein von diskursiver Vielfalt geprägter Text muss natürlich für unterschiedliche Herangehensweisen in der Wissenschaft offen sein.
Das Potenzial der Diversität
Zum Schluss möchte ich hervorheben, dass die Wahrnehmung des Korans als ein vielstimmiges Kommunikationsnetzwerk bedeutende Implikationen für die interreligiösen Beziehungen mit sich bringt. Denn Teil des vielfältigen Korangefüges sind nicht nur die Stimmen von Juden und Christen, sondern auch von Polytheisten, Ungläubigen und sogar Verdammten. Sie kommen alle gleichermaßen zur Sprache und dürfen sich äußern, auch wenn ihre Ansichten nicht im Sinne Gottes sind und als falsch zurückgewiesen oder verurteilt werden. Ihre Stimmen werden trotzdem nicht unterdrückt oder zum Schweigen gebracht. Ganz im Gegenteil. Sie sind Bestandteil einer Göttlichkeit beanspruchenden Rede. Sie beteiligen sich an einem diskursiven Kommunikationsnetzwerk, in dessen Rahmen Argumente ausgetauscht werden. Dass immer Gott und seine Gesandten die besseren Argumente liefern, liegt freilich in der Natur des religiösen Diskurses. Dass im Diskurs aber die göttliche Stimme und ihr Gegenteil gleichermaßen aufrechterhalten bleiben, birgt großes Potenzial für eine bessere Verständigung zwischen den Muslimen und anderen Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen. Denn der von Diversität charakterisierte Koran ist von seinem Wesen her offen für die Andersheit. Er ist ein polyphones Gefüge, eine vielstimmige Rede, ein diskursives Werk mit mehreren Sprechakteuren, die sich zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich äußern. Eben diese diskursive Flexibilität ermöglicht es, den Koran als interpretationsoffenes Werk aufzufassen, das für interreligiöse Diskurse gut geeignet ist. Von einem gläubig islamischen Standpunkt aus kann die diskursive Vielstimmigkeit des Korans sogar als Pendent für die menschliche Vielfalt verstanden werden, die von Gott gewollt wird, damit die Menschen einander kennenlernen: „Ihr Menschen! Siehe, wir erschufen euch als Mann und Frau und machten euch zu Völkern und zu Stämmen, damit ihr einander kennenlernt. Siehe, der gilt bei Gott als edelster von euch, der Gott am meisten fürchtet. Siehe, Gott ist wissend, kundig.“ (Q 49:13). Ohne Kommunikation könnte dieser Zweck nicht erfüllt werden.