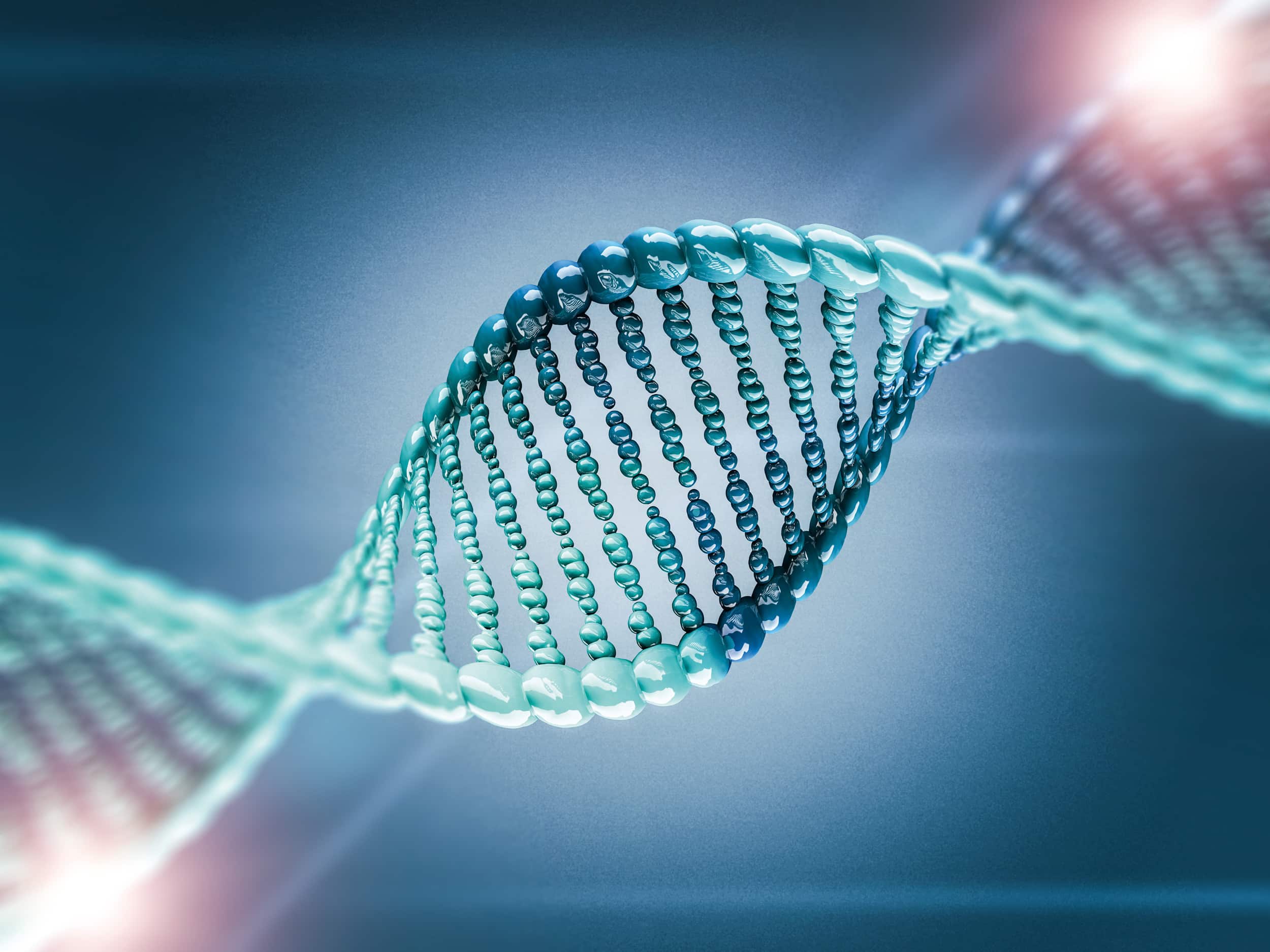Bereits Wilhelm von Humboldt plädierte für geschlechtlich offenes Denken. In seinem Aufsatz Über die männliche und weibliche Form, der 1795 in der Zeitschrift Die Horen erschien, führte er aus: „reine Männlichkeit und Weiblichkeit auch nur aufzufinden, ist unendlich schwer, und in der Erfahrung schlechterdings unmöglich“. An späterer Stelle setzte er fort, wiederum bezogen auf Geschlecht: „Von diesen beiden charakteristischen Merkmalen der menschlichen Gestalt, deren eigentümliche Verschiedenheit in der Einheit des Ideals verschwindet, herrscht in jedem Geschlecht eins vorzugsweise, indes das andere nicht vermisst wird.“ Humboldt entwickelte Idealtypen im Sinne „reiner Weiblichkeit“ und „reiner Männlichkeit“ – und kam zu dem Schluss, dass diese Idealtypen beim Menschen nie in dieser „Reinform“ auftreten würden. Menschen wären stets eine geschlechtliche Mischung.
Dass jeder Mensch „weiblich-und-männlich“ zugleich sei, wurde zu einer bedeutenden Denkrichtung in den modernen Wissenschaften. Biologen und Biologinnen leiteten diese Geschlechtermischung aus einer gemeinsamen geschlechtlichen Anlage ab. Jeder Embryo habe zunächst das Potenzial, sich in jegliche geschlechtliche Richtung zu entwickeln. Diese individuellen Ausprägungsmöglichkeiten und die genetischen, hormonellen und weiteren Faktoren, die daran beteiligt sind, interessieren die Biologie. Und Biolog:innen gehen heute deutlich weniger wertend vor: Die Merkmalsausprägungen werden zunehmend einfach beschrieben und nicht sogleich als „Störung“ oder „Abweichung“ bewertet.
Einige Beispiele solcher Variationen:
Bei als „männlich“ betrachtetem Genital kann ein „Hoden“ im Körperinneren verbleiben und undifferenziertes Keimdrüsengewebe beinhalten; ein Scheideneingang kann angelegt sein; Spermien können gebildet werden oder auch nicht; die Harnröhrenöffnung kann an der Spitze oder am Schaft des Penis liegen usw. Auf genetischer Ebene sieht es ähnlich aus: Es gibt XY-Frauen, also Menschen mit einem als typisch weiblich betrachteten Erscheinungsbild und einem als typisch männlich betrachteten Chromosomenbestand, ebenso wie XX-Männer, also äußerlich „typische“ Männer, die einen „typisch“ weiblichen Chromosomenbestand aufweisen. Es zeigt sich immer klarer, dass verschiedene Gene bzw. Genprodukte komplex zusammenwirken und auf Einflussfaktoren der Zelle, des Organismus und der Umwelt reagieren.
Über die wichtigsten Uneindeutigkeiten der biologischen Geschlechtlichkeit sollen die folgenden Ausführungen einen Überblick verleihen. Denn die aktuellen biologischen Forschungen stoßen mittlerweile auf dermaßen viele Schwierigkeiten, ihre Ergebnisse in ein binäres Geschlechterschema zu pressen, dass ein Perspektivwechsel nahezu unausweichlich erscheint – weg von zwei Geschlechtern, hin zu geschlechtlicher Vielfalt. Und weg von einer klaren genetischen Präformation, hin zu Epigenese.
Fortpflanzung der Gattung und des Individuums
Zunächst aber ein paar grundsätzliche Gedanken zur Fortpflanzung als biologischer „Sinn“ der Geschlechtlichkeit. Fortpflanzung ist unabdingbar für die Erhaltung der menschlichen Art. Die menschlichen Keimstoffe werden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als Ei- und Samenzelle beschrieben; sie müssen zur Fortpflanzung verschmelzen und bilden damit die Grundlage für die Entwicklung des Embryos.
Wer damit bereits die Problematik für geklärt hält, sollte sich für ein paar weitere Argumente öffnen: Fortpflanzung betrifft nur einige Menschen in der jetzigen Gesellschaft. Zwar setzen wir – aus unserem gesellschaftlich Erlernten heraus – bei der Betrachtung und Einordnung von Menschen auch deren Fortpflanzungsfähigkeit voraus, nicht selten ist diese aber nicht einmal organisch gegeben. So führte das Bundesland Sachsen die im Jahr 2004 bundesweit abgeschaffte Bezuschussung der künstlichen Befruchtung wieder ein, weil „Experten-Schätzungen“ ergaben, dass 15 Prozent der heterosexuellen Paare ungewollt kinderlos seien und noch eine „hohe Dunkelziffer“ hinzuzurechnen sei. 15 Prozent + X ist durchaus ein hoher Wert, zumal wenn man davon ausgeht, dass nur einige der Paare medizinischen Rat wegen länger ausbleibenden Fortpflanzungserfolgs suchen. Und es sei auch darauf hingewiesen: Künstliche Befruchtung ist nur in den wenigsten Fällen erfolgreich, und auch die Risiken sind für die Frau nicht unbeträchtlich; häufig wird ein anderer Eindruck erweckt. Aus etwa 35 bis 40 Millionen Befruchtungen bis zum Jahr 2002 resultierten etwa eine Millionen Kinder; seit der erneuten Einführung der Bezuschussung künstlicher Befruchtung im Bundesland Sachsen im März 2009 wurden dort bis Juni 2010 552 Behandlungen vorgenommen, die zu 112 Kindern führten.
Es wird deutlich, dass die Problematik „Fortpflanzung“ unter zwei Perspektiven zu betrachten ist: Einerseits ist die Fortpflanzung zur Erhaltung der Art Mensch erforderlich, sie ist eine „Gattungseigenschaft“. Hierfür ist es notwendig, dass zwei Individuen der Art zusammenfinden, dass Ei- und Samenzelle zusammenkommen, dass sich ein Embryo entwickelt, geboren und anschließend betreut wird. Es ist allerdings wohl ausreichend, wenn sich, bei guter Gesundheitsversorgung und guten Möglichkeiten gesellschaftlicher Betreuung, sagen wir zehn oder 20 Prozent der Menschen zuweilen fortpflanzen, damit sich die Größe der Population erhält (sofern dies überhaupt als Maßstab gelten kann). Von dieser „Gattungseigenschaft“ kann deshalb nicht auf die individuellen Eigenschaften eines konkreten Menschen geschlossen werden. So muss sich ein Mensch keineswegs fortpflanzen können und wollen, um Mensch zu sein.
Gerade bei der Ausbildung von Genitalien werden in der Embryonalentwicklung vielfältige Möglichkeiten gegeben sein, weil sie – im Gegensatz beispielsweise zu Herz, Leber, Lunge – nicht lebensnotwendig sind. Führen zahlreiche Entwicklungen des Herzens dazu, dass dieses nicht funktionstüchtig ist und bereits der Embryo deshalb zu Grunde geht oder aber dass der Mensch früh stirbt, so hat ein Genitaltrakt, dem organisch nur die Fähigkeit zur Fortpflanzung fehlt, keineswegs vergleichbare negative Auswirkungen.
Die Ausbildung des Genitaltrakts in der Embryonalentwicklung
In frühen Phasen der Embryonalentwicklung werden die Embryonen nicht geschlechtlich unterschieden, sondern besitzen gemeinsame geschlechtliche Anlagen: Keimdrüse, Wolffscher Gang und Müllerscher Gang sind zunächst bei allen Embryonen vorhanden; Granulosa- und Sertoli-Zellen sowie Theka- und Leydig-Zellen zeigen sich als einander homolog, sie gehen also auf den gleichen embryonalen Ursprung zurück. Auch die Bildung von Androgenen geschieht in allen Embryonen, sie werden lediglich in unterschiedlicher Quantität in Östrogene umgebildet. Es liegt also nahe, dass der jeweilige Pool an Faktoren, der Zeitpunkt und die Quantität ihrer Bereitstellung von Individuum zu Individuum variieren können. Hinzu kommt die Erkenntnis, wie stark verzahnt die Entwicklung des Embryos mit aus dem elterlichen Organismus einwirkenden Faktoren ist. Für eine detaillierte Darstellung der embryonalen Entwicklung in ihrer ganzen Bandbreite sei auf den Vortrag von Ursula Rosen verwiesen.
In Summe zeigt sich, dass die Ausbildung des Genitaltrakts mit als „männlich“ und als „weiblich“ geltenden Kennzeichen zwar bipolar ist, aber nicht binär. Es gibt nicht nur das „Entweder-Oder“ bezüglich der Entwicklung der Keimdrüsen (entweder Hoden- oder Eierstockentwicklung). Schon gar nicht muss es dieses „Entweder-Oder“ bei der Ausbildung der übrigen Teile des Genitaltraktes geben. Vielmehr stehen wir immer wieder vor dem Befund, dass sich auch ein „Sowohl-als-Auch“ ergeben kann, wenn zum Beispiel einige Faktoren lediglich auf einen Teil eines sich ausbildenden Gewebes wirken oder wenn Rezeptoren für Androgene oder Östrogene in unterschiedlichem Maße von den Zellen ausgebildet werden etc.
Es zeigt sich also ein differenziertes Bild mit der Möglichkeit der vielfältig variablen Entwicklung des Genitaltraktes; es ist daher methodisch angezeigt, eine neue Einordnung der vorliegenden Ergebnisse vorzunehmen, bei der nicht schon Zweigeschlechtlichkeit vorausgesetzt ist. Dabei gilt es, aus einer Denkweise auszubrechen, die Variabilität als „Störung“ und „Abweichung“ von einer „Norm“ disqualifiziert. Vielmehr kann man gerade mit einer neuen Einordnung zu einer besseren und vorübergehend überzeugenderen Beschreibung der sich tatsächlich darstellenden Vielfalt von geschlechtlichen Ausprägungen gelangen.
Biosynthese und die Wirkung der Hormone
Häufig werden Androgene und Östrogene als zueinander gegensätzlich dargestellt. Während die Ersteren eine vermännlichende Wirkung hätten, seien die Letzteren insbesondere für eine verweiblichende Wirkung bedeutsam. Ebenso häufig wird einfach ausgeführt, dass Hoden Androgene bilden würden, Eierstöcke hingegen Östrogene. Hier lohnt eine genauere Betrachtung: Androgene und Östrogene basieren auf einem weitreichend gleichen Biosynthese-Weg. Als Steroidhormone gehen sie auf Cholesterin zurück. Androgene leiten sich vom Pregnenolon bzw. von seinem Umwandlungsprodukt Progesteron ab; diese werden zu den Androgenen Androstendion und Androstendiol modifiziert, woraus schließlich das Androgen Testosteron gebildet wird. Die Androgene können – insbesondere abhängig von dem Enzym Aromatase – in Östrogene überführt werden. Auf diese Weise wird aus Androstendion das Östrogen Östron gebildet, aus Testosteron entsteht so Östradiol. Es zeigt sich also, dass zunächst stets „Androgene“ gebildet und diese dann gegebenenfalls zu „Östrogenen“ umgebildet werden.
Die Biosynthese von Androgenen und Östrogenen geschieht vornehmlich, aber keineswegs ausschließlich, in den Keimdrüsen. Androgene werden beispielsweise auch in der Nebennierenrinde gebildet, Östrogene auch in der Plazenta. In weiteren Geweben findet die Produktion in geringen Mengen statt. Hohe Konzentrationen an Androgenen können ihre Umwandlung zu Östrogenen im Fettgewebe bewirken.
Wird Androgenen und Östrogenen im populären Verständnis häufig eine Bedeutung bei der Ausbildung (primärer und) sekundärer Geschlechtsmerkmale zugeschrieben, so werden dabei ihre übrigen Wirkungen vernachlässigt. Östrogene scheinen für die Funktionstüchtigkeit des Herzens, das Knochenwachstum und für die Ausbildung der männlichen Spermien wichtig zu sein. Testosterone scheinen unter anderem einen Einfluss auf das Kreislaufsystem, die Blutzellen, die Leber, die Fett- und Kohlehydratverbrennung zu haben. Also sowohl Östrogene als auch Testosterone sind für „Frauen“ wie „Männer“ bedeutsam – Anne Fausto-Sterling schlug entsprechend vor, sie eher als „Wachstumshormone“ einzuordnen, als durch die Bezeichnung „Geschlechtshormone“ den ganzen Umfang ihrer Wirkungen zu verschleiern.
Es scheint also die Quantität der Hormone und ihr Verhältnis zueinander bedeutsam zu sein; die verschiedenen Zellen der sich ausbildenden Keimdrüsen wirken zusammen, reagieren auf eingehende Stimuli, sofern sie über die entsprechenden Rezeptoren verfügen. Es sind Enzyme/Enzym-Komplexe bzw. weitere Protein-Komplexe notwendig, damit Androgene und Östrogene gebildet werden, deren Wirkungen sich schließlich auch nur dann entfalten können, wenn entsprechende Rezeptoren an Zellen vorhanden sind, an die sie binden und dadurch Reaktionen in Gang setzen können. Deutlich wird damit, dass sich ihre Wirkungen – je nach den individuellen Gegebenheiten und umgebenden Einflüssen – unterschiedlich gestalten.
Entsprechend wird auch klar, dass „hohe Konzentrationen“ an Androgenen nicht unbedingt mit einem männlichen Erscheinungsbild einhergehen müssen. Sind beispielsweise keine Androgenrezeptoren vorhanden oder werden größere Mengen an Aromatase erzeugt, die wirksam werden, dann kann sich auch bei hohen Androgen-Konzentrationen ein als „weiblich“ betrachtetes Erscheinungsbild einstellen. Problematisch ist hier nicht das sich ausbildende Erscheinungsbild, sondern die gesellschaftliche Pathologisierung, die mit den unterschiedlichen Konzentrationen an Hormonen einhergeht. So werden beispielsweise fünf bis 15 Prozent der Frauen im „gebärfähigen Alter“ als krank beschrieben, nur weil sie „zu viele“ als „männlich“ geltende Hormone bilden.
Ein langer Weg und krumme Pfade von der DNA zum Geschlecht
Wie bereits ersichtlich wurde, weitet sich in der Biologie mittlerweile auch bei Theorien zur Geschlechtsentwicklung das Verständnis. Es wird nun begonnen, nicht mehr nur ein Gen oder wenige Gene als bedeutsam für die Ausbildung des Genitaltraktes zu beschreiben, sondern man orientiert auf komplexe Interaktionen: Mehrere Gene und ihre Produkte können in komplexen Netzwerken zusammenwirken. Gerade wo aber viele Faktoren wirken und besonders, wenn auch die Quantität ihrer Expression eine Rolle spielt, wird es im Sinne „handwerklich guter“ Forschung notwendig zu erwägen, dass aus ihrem Zusammenspiel nicht nur zwei Möglichkeiten der Ausbildung des Genitaltraktes resultieren müssen. Vielmehr könnten durch das Wechselwirken zahlreicher Faktoren vielfältige, unterschiedliche, mehr oder weniger für Fortpflanzung taugliche Ausbildungsformen des Genitaltraktes entstehen; bzw. selbst wenn man bei der Ausbildung des Genitaltraktes jeweils auf Ähnlichkeiten zwischen zwei Individuen stieße, müssten sich diese keinesfalls aus gleichen Entwicklungswegen herleiten.
Den Blick auf Komplexität gilt es aber noch bedeutend zu erweitern. Bisher waren wir fast ausschließlich auf der Ebene der „Erbsubstanz“, der DNA (engl. deoxyribonucleic acid; dt. Desoxyribonukleinsäure [DNS]). Die DNA stellt nun aber keineswegs bereits den in der Zelle tatsächlich wirkenden Faktor dar; vielmehr sind mehrere, stark durch die Zelle regulierte Schritte erforderlich, damit das schließlich in der Zelle wirksam werdende Produkt gebildet wird – meist handelt es sich dabei um ein Protein, aber es kann auch bereits als Folge eines früheren Schrittes ein in der Zelle wirksames Produkt entstehen.
Zunächst geht ein „Signal“ ein, das anregt, einen bestimmten DNA-Bereich „abzulesen“. Bei einem solchen Signal kann es sich beispielsweise um einen der oben beschriebenen „Transkriptionsfaktoren“ handeln, aber auch Gradienten chemischer Moleküle, ein starker Hitzereiz etc. können in einigen Fällen auslösend sein. DNA-Bereiche der Chromosomen, die nicht exprimiert werden, sind in der Regel sehr dicht gepackt – man spricht von so genanntem „Chromatin“. In dieser Form ist ein „Ablesen“ der DNA in aller Regel nicht möglich, so dass diese dichte Packung zunächst gelockert werden muss, damit der nächste Schritt – die Transkription (vgl. nachfolgend) – erfolgen kann. Auch angelagerte chemische Gruppen (hier: „Methylierungen“) können bedeutsam dafür sein, ob ein DNA-Bereich abgelesen werden kann oder nicht. Die Lockerung der Chromatin-Struktur erfolgt durch komplexe zelluläre Prozesse.
Anschließend kann die Transkription stattfinden. Diese bedeutet ein „Umschreiben“ der DNA-Sequenz in ein anderes großes Molekül, das wie die DNA ebenfalls eine Nukleinsäure ist, die RNA (RNA, engl. ribonucleic acid; dt. Ribonukleinsäure [RNS]). Sowohl bei der DNA als auch bei der RNA handelt es sich um einen langen Strang aufeinander folgender „Basen“, die das Grundgerüst der Nukleinsäuren darstellen. Dabei gehen jeweils zwei ganz bestimmte „Basen“ eine Bindung miteinander ein. Auf Grund dieser sehr spezifischen Basenpaarung kann die RNA nun „komplementär“ – quasi spiegelbildlich – zur DNA-Sequenz erstellt werden; der DNA-Strang heißt „Matrize“. Auch hierbei handelt es sich um einen komplexen Prozess, bei dem zahlreiche Faktoren zusammenspielen müssen, damit spezifisch reguliert wird, ob eine Transkription stattfinden soll, sie schließlich eingeleitet („Initiation“), mit ihr fortgefahren („Elongation“) und sie dann beendet („Termination“) wird. Das Umschreiben erfolgt dabei nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit – beispielsweise kann eine nicht-komplementäre „Base“ eingebaut werden. Eine spezifische Genauigkeit (und Ungenauigkeit) wird über „Reparaturmechanismen“ – wiederum mit zahlreichen beteiligten Faktoren der Zelle – erreicht.
Auf diese Weise entsteht eine RNA, die aber noch nicht „fertig“ ist, eine pre-mRNA (bzw. dt. prä-mRNS). Vielmehr finden nach der Transkription („posttranskriptional“) noch verschiedene Veränderungen des Moleküls statt, bis dann eine reife RNA vorliegt.
Die dann vorliegende mRNA wird nun aus dem Zellkern ins Zellplasma transportiert. Auch der Transport erfolgt nicht „einfach so“, sondern als regulierter Prozess. Erst im Zellplasma kann die mRNA der Translation zur Verfügung stehen. Allerdings muss keine Translation stattfinden, sondern die mRNA kann rasch abgebaut werden. Gewebespezifisch überdauert die mRNA wenige Minuten bis viele Stunden – es können dabei viele, eine oder auch gar keine Translationen stattfinden.
Und auch an der Translation, bei der die mRNA-Sequenz in eine Aminosäuresequenz – diese ist dann der Grundbaustein des Proteins – umgeschrieben wird, sind zahlreiche Faktoren beteiligt. Auch hier wird genau reguliert, ob die Translation erfolgen soll, wird sie initiiert, aufrechterhalten und beendet. Damit liegt dann die Aminosäuresequenz vor, die den Grundbaustein der Proteine darstellt – aber noch keineswegs das fertige, in der Zelle wirksame Produkt. So erfolgen nach der Translation („posttranslational“) noch chemische Veränderungen, die erst dazu führen, dass ein Produkt mit spezifischer Aktivität, Reaktivität und Lokalisation in der Zelle entsteht. Es können Teile der Aminosäuresequenz spezifisch entfernt werden, oder es werden zusätzliche Aminosäuren an die existierende Sequenz angelagert oder zwischen Aminosäuren der Sequenz eingebaut. Es können chemische Gruppen – wie Eiweiße, Zucker, Fette, Proteine – angebaut werden, und es können neue chemische Bindungen eingefügt werden. Erst jetzt entsteht ein spezifisches Produkt, mit einer definierten räumlich-geometrischen Form, das ganz charakteristische chemische und physikalische Eigenschaften aufweist.
Als Fazit ist festzuhalten: DNA bzw. „Gene“ enthalten keine Informationen, die dann nur umgesetzt werden müssten; vielmehr wird erst durch vielfältige Prozesse der Zelle, in spezifischer Reaktion auf umgebende Einflüsse – aus der Zelle, dem elterlichen Organismus, der Umwelt – die spezifische, aktuell notwendige Information eines Gens erzeugt. Aus einem einzigen Gen (DNA) können zahlreiche unterschiedliche Produkte entstehen, die dann in der Zelle unterschiedlich lokalisiert sind und unterschiedliche Aktivitäten entfalten. Auf allen Ebenen findet Regulation statt. Das heißt also, es kommt auf die Umgebungsbedingungen an, also auf die Zelle und gegebenenfalls den elterlichen Organismus, und das auch nicht etwa in der Weise eines (passiven) Materiallagers, sondern als (aktiver) „Reaktionsraum“, in dem zahlreiche Reaktionen ablaufen und Einflüsse aus Zelle, Organismus und Umgebung wirksam werden. Erst dieser „Reaktionsraum“ und die dort wirkenden Einflüsse führen zu konkreten Produkten, die gebildet werden und zu deren Ausbildung DNA als einer der Bestandteile dient.
Um es noch einmal anders zu sagen: Die präformistische Annahme einer DNA, die alles bestimme, ist falsch – und widerlegt. Vielmehr sind die Prozesse der Embryonalentwicklung weiter und komplexer zu denken. Die DNA stellt einen der beteiligten Faktoren in der Zelle dar. Aus ihr wird erst durch zelluläre Prozesse die Information gewonnen, die zu dem konkreten Zeitpunkt in der Zelle benötigt wird. Dabei sind viele zelluläre Faktoren – wie verschiedene Proteine – involviert, die sich zusammenlagern und interagieren müssen, damit aus einer DNA-Sequenz das „benötigte“ Produkt gebildet wird.
Prozessdenken in der chromosomalen Geschlechtsentwicklung
Solche integrierten, systemischen Betrachtungen fanden und finden durchaus statt, allerdings blieben sie gegenüber der Genetik im Hintertreffen, die lediglich die DNA fokussierte und diese mit der so weitreichenden Bedeutung auflud, dass sie bereits alle Information zum Aufbau eines Organismus enthielte und diese nur gelesen werden müssten. Schon die Theorien von Goldschmidt und Kammerer zeigten integrierte und systemische Betrachtungen; seit den 1940er Jahren wurden solche Auffassungen vielfach unter dem Begriff „Epigenetik“ gefasst. Conrad Hall Waddington thematisierte seit den 1940er Jahren als „Epigenetik“ Faktoren des Zellplasmas, die zur Umsetzung der „Informationen“ der Gene beitragen sollten. Gene waren bei ihm durchaus dominant gesetzt, allerdings seien sie auf weitere Bestandteile der Zelle angewiesen – und diese sollten untersucht werden. Heute könnten die Betrachtungen weiter reichen, und die dominante Stellung von DNA wäre berechtigt in Zweifel zu ziehen. Es könnten unter „Epigenetik“ die Betrachtungen eingeordnet werden, die hier zur Umgestaltung der Chromatinstruktur, zu Transkription und Translation und daran anknüpfende weitere chemische Veränderungen, beschrieben wurden. Es könnten zudem einwirkende Faktoren aus dem elterlichen Organismus in den Blick genommen werden, ebenso wie etwa die Auswirkung von Ernährung und Stress – denen mittlerweile durchaus dominant eine Bedeutung bei Entwicklungsvorgängen zugeschrieben wird.
Für die Geschlechtsentwicklung bedeuten die vielen beteiligten Faktoren und die Prozesshaftigkeit, die stets für Regulation offen ist, dass sie nicht nach einem starren und einfachen Muster „weiblich“ oder „männlich“ abläuft, dass sich die Entwicklung des Genitaltraktes vielmehr nach den sich individuell darstellenden Bedingungen und einwirkenden Einflüssen vollzieht. So leuchtet unmittelbar ein, dass zahlreiche Ausprägungsformen des Genitaltraktes möglich sind. Diese stellen sich in der Realität tatsächlich auch dar, nur sind sie im Allgemeinen ohnehin durch die Kleidung verdeckt, und sie gelangen – wohl zum Glück – nicht in den Blick der Medizin. Bei den Menschen, die auffallen, weil sie nicht in die derzeitigen Normen von „weiblich“ oder „männlich“ passen, wird noch immer und oft äußerst rücksichtslos und gewaltsam ein eindeutiges Erscheinungsbild „weiblich“ oder „männlich“ hergestellt; oder es wird Menschen nahegelegt, sich selbst als „krank“ anzusehen, nur weil sie sich nicht fortpflanzen können, weil sie nicht die als „typisch“ angesehenen Chromosomenbestände oder Hormonspiegel aufweisen. Die Frage ist doch aber, wenn man die vielfältigen Faktoren betrachtet, die an der Geschlechtsentwicklung Anteil haben: Was ist typisch? Ist der Chromosomensatz das Entscheidende? Sind es die einzelnen Gene und die vielen daraus gebildeten Produkte? Von welcher Quantität eines gebildeten Produkts an gilt ein Mensch als „weiblich“, wann als „männlich“? Sind es die Keimdrüsen, die eindeutig sein sollen – oder müssen sie auch Keimzellen produzieren (können)? Muss ein „Mann“ über funktionsfähige Samenzellen verfügen, und muss eine „Frau“ neben der Möglichkeit, Eizellen zu produzieren, auch die „inneren Genitalien“ aufweisen, einen Embryo entwickeln und austragen können? Oder ist doch schlicht das äußere Erscheinungsbild der Genitalien – insbesondere mit Penis, Hoden und Vagina das Typische? Alle diese Merkmale zusammen werden bei keinem einzigen Menschen in eine „eindeutige“ Richtung „weiblich“ oder „männlich“ zusammenspielen.
Geschlechtliche Vielfalt und kirchliche Tradition
Blickt man historisch zurück, so ist die rigorose Einordnung von Geschlecht historisch neu. Bis etwa um 1500 reagierten Gesellschaft und – damals insbesondere in Europa relevant – die Kirchengerichtsbarkeit relativ unaufgeregt, wenn ein Mensch nicht klar einem der beiden sozialen Geschlechter „Mann“ oder „Frau“ zugerechnet werden konnte. Kam ein Zweifel auf, wie es bei Fragen der Eheschließung, des Erbens und Vererbens der Fall sein konnte, so urteilte das angerufene Kirchengericht, dass der Mensch wählen solle, sich entweder zu diesem oder zu jenem Geschlecht zu verhalten und von der getroffenen Entscheidung zeitlebens nicht abweichen sollte. Christof Rolker hat in seinem Aufsatz Der Hermaphrodit und seine Frau: Körper, Sexualität und Geschlecht im Spätmittelalter (2013) nuanciert diesen vergleichsweise „unaufgeregten“ Umgang mit „untypischem“ Geschlecht beleuchtet und erkennt eine Veränderung etwa ab 1530: Ab dem frühen 16. Jahrhundert würden scharfe Urteile wie das Verbrennen getroffen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, die darauf zielen, geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung zu ermöglichen und zu befördern sowie gewaltvolle gesellschaftliche Umgangsweisen mit „Abweichungen von der Norm“ abzustellen, könnte es günstig sein, die katholische Kirche bezöge sich mehr auf die eigene – offenere – Tradition. Geschlechter im Sinne einer Schöpfung Gottes zu verstehen, kann gerade bedeuten, die Vielfalt der konkret vorhanden Menschen anzuerkennen. Diese Anerkennung tut darüber hinaus Not: Transgeschlechtliche und intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche (aber auch Erwachsene) berichten von vielen gewaltvollen Erfahrungen und viel zu oft von daraus erwachsenen temporären Suizidabsichten. Hier ist Seelsorge in der Pflicht, anzuerkennen und zu unterstützen; schließlich sollte gerade Seelsorge ein Ort sein, der unterstützt, anstatt Menschen zu bedrängen und ihnen den letzten Lebensmut zu rauben. Konkret ergeben sich die folgenden Themen und Aufgaben im Hinblick auf die katholische Kirche und ihre Seelsorge:
- Annehmen der Schöpfung – auch wenn sie vielfältig ist und nicht in den Bahnen beschränkter menschlicher gesellschaftlicher Ordnung verläuft.
- Wahrnehmen des ganzen Menschen – ganzheitlich, inklusive der sexuellen und geschlechtlichen Dimensionen.
- Ernstnehmen von Unterstützungsbedarfen: seelische bzw. psychische Gesundheit fördern, statt bei Menschen Leid und – im Extrem – Suizidgedanken zu erzeugen.
- Anschließen an die eigene Tradition größerer Offenheit.