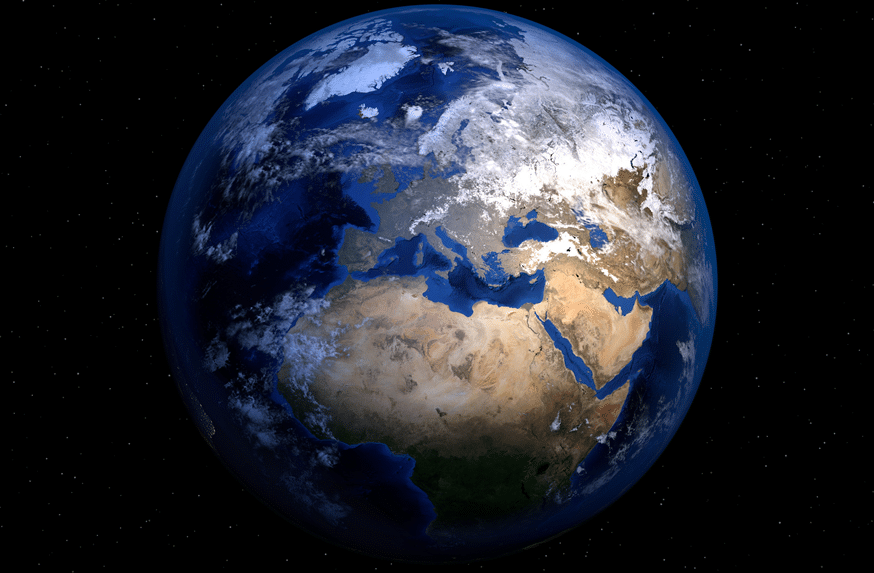Wenn man sich in der Welt umblickt, dann sieht man allerorten Ungerechtigkeiten. Hunderte Millionen Menschen sind bitterarm, und viele davon haben so wenig zum Leben, dass ihnen die nötigste Nahrung, Kleidung und Unterkunft fehlen. Millionen Menschen sterben jedes Jahr an vermeidbaren Krankheiten, weil sie verunreinigtes Trinkwasser trinken müssen oder keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Dazu kommen massenhafter Tod und Leid durch Krieg, Terror, Ausbeutung und Gewalt. Sich dieses Leid vorzustellen, ist nicht möglich, es kann vielleicht in Statistiken gepackt und rational erfasst werden, aber es kann nicht wirklich nachvollzogen oder gar mitgefühlt werden. Das würde uns alle sicherlich überfordern.
Es gibt aber nicht nur diese „großen“ Ungerechtigkeiten, die sich weit weg von unseren Städten und Siedlungen in anderen Ländern abspielen. Es gibt auch viele „kleinere“ Ungerechtigkeiten, viel Leid und Entbehrung hier in den reichen Ländern Europas, in Deutschland oder Österreich. Die obdachlosen Menschen, an denen wir in unseren Metropolen täglich vorbeilaufen, die Kinder, deren miserable Lebenslage man nicht öffentlich sieht, weil sie sich verstecken und die in kleinen und schimmligen und im Winter kalten Wohnungen hausen müssen und deren Mütter – meistens sind es die Mütter – zum Sozialmarkt oder zur Tafel gehen, um günstiges Essen zu holen, weil sie sich den Einkauf im normalen Supermarkt nicht leisten können.
Es ist sicher so: Man muss keine Philosophin sein, um die Ungerechtigkeiten in dieser Welt benennen zu können. Jede, die hinsehen will, wird sie erkennen. Nachrichten in Fernsehen, Zeitungen und Internet transportieren Ausschnitte und Bruchstücke des Elends dieser Welt jeden Tag auf unsere Bildschirme. In regelmäßigen Abständen wird über Armut in der Welt und hier berichtet, wobei sich die Botschaften immer wieder gleichen: vielen geht es schlecht, viele haben wenig bis gar nichts; einige wenige haben übermäßig viel.
Wir brauchen die philosophische Reflexion, um globale Ungerechtigkeiten besser zu verstehen
Der unmittelbare Eindruck, dass in dieser Welt gehörig viel falsch läuft, kann die philosophische Reflexion aber nicht ersetzen. Die Philosophie kann und soll helfen, unsere moralischen Intuitionen und Überzeugungen zu reflektieren, zu sortieren und auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Philosophie soll auch unsere Erfahrungen und Meinungen korrigieren, sie soll versuchen, Kohärenz und Einsicht zu stiften, gerade dort, wo die Eindrücke von Leid und Ausbeutung sowie von Ohnmacht und Resignation angesichts der Lage der Welt – vielleicht auch der eigenen – uns zu überwältigen drohen. Anstatt das Unrecht und die Ungerechtigkeit wegzuschieben, sollen sie intellektuell durchdrungen werden. Die Philosophie, wenn sie etwas über globale Gerechtigkeit zu sagen hat, wird auch unangenehm sein – für uns hier, die wir gut situiert sind, weil sie unseren Anteil an der Verantwortung zu spezifizieren versuchen wird.
Erstens gibt es doch gravierende Unterschiede darin, was Menschen als ungerecht empfinden. Für mich persönlich und viele Menschen, die ich kenne, ist es eine klare Ungerechtigkeit, wenn die reichen Staaten Europas nicht viel mehr Flüchtlinge aufnehmen als sie bereits tun und diese ordentlich versorgen. Wir wissen, viele unserer Mitbürgerinnen sehen das aber anders. Für diese ist es ok, ja sogar nötig und richtig, die Grenzen dicht zu machen, Menschen in griechische oder türkische Lager zu pferchen und ihnen jede Chance auf ein besseres Leben in Europa vorzuenthalten. Das ist Ausdruck der in den letzten Jahren beobachtbaren politischen und moralischen Polarisierung in unserer Gesellschaft und vielen anderen Staaten Europas. Der Streit um die richtige politische Moral, also darum, was gerecht ist und mithin auch, was global gerecht ist, wird privat, öffentlich und politisch heftig geführt.
Zweitens ist es nicht genug, auf empfundene Ungerechtigkeiten zu zeigen, sondern sie sollten auch verstanden werden. So verstanden, dass man gute Gründe dafür vorbringen kann, warum etwas ungerecht ist. Nicht alles Leid auf dieser Welt ist ungerecht, manches ist tragisch, manches sogar verdient. Worin liegt der Unterschied, ob jemand leidet, weil für seine Krankheit noch kein Heilmittel gefunden wurde und ob jemand leidet, weil sie schlicht keinen Zugang zu vorhandenen Medikamenten hat, die ihr Leid gut und effektiv lindern könnten? Wir sind auf der Suche nach moralisch relevanten Unterschieden, also solchen, die es erlauben, Situationen der Ungerechtigkeit auszuzeichnen. Ein relevanter Unterschied könnte sein, dass es anderen möglich wäre, das Leid zu lindern und zu helfen. Vermeidbares Leid ist ungerechtes Leid. Aber was ist vermeidbar? Könnte es eine Welt geben, in der niemand hungern muss? Ein anderer relevanter Unterschied könnte sein, dass andere Menschen unverdienterweise mehr haben, zum Beispiel mehr Geld, mehr Besitz, mehr Bildung.
Wahrscheinlich wäre es möglich, viele der herrschenden Ungerechtigkeiten zu beseitigen, aber, drittens, wer könnte dafür verantwortlich sein, eine solche Welt einzurichten und die Verhältnisse so umzustürzen, dass wir dorthin kommen? Die einzelne Mitbürgerin in Deutschland oder Österreich wird mit einigem Recht sagen, dass sie alleine den Hunger und die Armut dieser Welt nicht beseitigen kann; dass sie nicht dafür verantwortlich ist, hier zu helfen, weil sie keine Schuld trägt. Wie können wir aber diejenigen erreichen, die etwas tun könnten?
Die Mächtigen dieser Welt – die reichen Staaten und ihre politischen Entscheidungsträger*innen, die Superreichen, die sogar jetzt während der COVID-19-Pandemie noch reicher wurden und hunderte Milliarden Euros in Aktien, Firmen, Immobilien und auf ihren Bankkonten parken? Diese Diffusion von Verantwortung und Schuld macht globale Ungerechtigkeiten schwer fassbar. Sie sind vorhanden, stehen vor unseren Augen, aber warum sie existieren, wer für sie verantwortlich ist und was getan werden kann, um sie zu beseitigen, verliert sich im Nebel des Unwissens.
Die Menschenrechte als Maßstab globaler Gerechtigkeit
Die Philosophie kann das normativ-begriffliche Instrumentarium bereitstellen, um globale Ungerechtigkeiten besser zu verstehen und Lösungen zu formulieren. Ein mögliches und breit akzeptiertes Instrument sind die Menschenrechte. Menschenrechte will ich hier als moralische Rechte verstehen, sie sind nicht notwendigerweise deckungsgleich mit den ratifizierten Menschenrechten, auf die sich die Staatengemeinschaft geeinigt haben und die durch die internationale Menschenrechtspraxis weiter ausdifferenziert wurden. Menschenrechte haben immer einen universalen moralischen Kern, sie beziehen sich auf alle Menschen – die Spezifik der Menschenrechte von Kindern oder von Menschen mit Behinderungen wird noch zu erörtern sein.
Globale Ungerechtigkeiten bestehen darin, dass Menschen in Situationen leben müssen, in denen ihnen ihre Menschenrechte vorenthalten oder sie darin verletzt werden. Die Auszeichnung als globale Ungerechtigkeit soll dabei andeuten, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern um weitverbreitete Ungerechtigkeiten. Die Menschenrechte geben aber nur einen Rahmen vor, sie bezeichnen wichtige Interessen und Bedürfnisse des Menschen, die geschützt werden sollten. Sie bedürfen aber der konkreten Interpretation, um Ungerechtigkeiten benennen zu können. So gibt es ein Menschenrecht auf Gesundheit oder auch ein Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard oder das Recht auf soziale Sicherheit. Was diese konkret verlangen, ist zu klären.
Das Menschenrecht auf Gesundheit sollte nicht so verstanden werden, dass es ein Recht darauf gibt, niemals krank zu werden; wie auch das Recht auf Leben nicht bedeutet, dass man nicht sterben müsste. Vielmehr verlangt das Menschenrecht auf Gesundheit, dass Menschen Behandlung bekommen, sofern es Methoden und Medikamente gibt. Das Menschenrecht auf Gesundheit greift auch schon in den Bereich der Prävention ein. Klar ist, dass Menschen geschützt werden sollten, sofern gesundheitliche Schädigungen direkt vorhersehbar und vermeidbar sind. Kein Unternehmen hat das Recht, Trinkwasser zu verschmutzen oder Gifte in die Umwelt einzubringen, die Krankheiten bei den Bewohnern in der unmittelbaren Umgebung erzeugen.
Menschenrechtspflichten sind dreifach zu verstehen: Staaten dürfen selbst keine Menschenrechtsverletzungen begehen, sie müssen ihre Einwohnerinnen vor Menschenrechtsverletzungen durch andere schützen und sie müssen dafür sorgen, dass für alle Einwohnerinnen die Menschenrechte vollumfänglich verwirklicht werden. Menschenrechte haben nämlich Bedingungen und Voraussetzungen, die hergestellt werden müssen, wie zum Beispiel der Zugang zu Krankenhäusern oder Impfstoffen.
Menschen in ärmeren Ländern sterben jünger als in Europa und sie leiden unter vielen vermeidbaren Krankheiten, weil ihnen Impfungen, Behandlungen und angemessener Schutz fehlen. Das kann als Verletzung ihrer Menschenrechte bezeichnet und entsprechend moralisch und politisch angeprangert werden. Menschenrechte gelten universal, sie kennen keine Ländergrenzen und machen keinen Unterschied zwischen arm und reich. Das Menschenrecht auf Gesundheit gilt für alle gleichermaßen.
Dennoch sind die Menschenrechte vage und begrenzt. Das Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard ist vage. Was in Deutschland als angemessener Lebensstandard gilt, ist für viele Einwohner dieser Welt unerreichbar. Welcher Maßstab sollte hier angewendet werden? Ist es erlaubt, zwischen Ländern zu differenzieren und sich am dortigen jeweiligen Durchschnitt zu orientieren? Das hieße dann womöglich, dass ein angemessener Lebensstandard in dem einen Land bedeutet, eine kleine Hütte mit Lehmboden zu haben und ein paar Tiere zur Selbstversorgung, während in Deutschland und Österreich die Menschen ein Recht auf eine Wohnung, Waschmaschine, Internet und Mobiltelefon haben.
Das scheint doch ungerecht zu sein, wenn die Menschenrechte solche eklatanten Unterschiede zulassen würden. Globale Gerechtigkeit würde doch eher darin bestehen, wenn alle Menschen auf dieser Welt ungefähr den gleichen Lebensstandard erreichen würden. Das wiederum scheint aus heutiger Sicht utopisch und angesichts der klimaschädlichen Auswirkungen des westlichen Lebensstils auch nicht anstrebenswert, zu behaupten, dass allen gut neun Milliarden Menschen auf dieser Welt ein derart hoher Ressourcenverbrauch zustehen würde.
Die Menschenrechte werden daher oft begrenzt als Minimalstandards verstanden. Sie geben nur vor, was mindestens für alle Menschen gewährleistet sein muss, aber darüber hinaus kann es eklatante Unterschiede geben. Das läuft dann auch oft darauf hinaus, unterschiedliche Grade der Verwirklichung globaler Gerechtigkeit anzunehmen. Die Welt wäre deutlich besser, wenn niemand mehr hungern müsste. Das kann als Forderung der Menschenrechte gesehen werden – wenn aber in einer Welt, in der niemand hungert, einige sich Kaviar und Champagner leisten können, während die meisten nur Reis und Bohnen haben, wäre eine solche Welt zwar vielleicht mit den Minimalforderungen der Menschenrechten vereinbar, aber doch sicherlich nicht gerecht.
Die erste Stufe der globalen Gerechtigkeit wäre also erreicht, wenn die Forderungen der Menschenrechte für alle gelten und erfüllt sind. Die zweite Stufe der globalen Gerechtigkeit wäre vielleicht erreicht, wenn allzu grobe Ungleichheiten in relevanten Bereichen nicht mehr vorkommen würden. In einer solchen Welt gäbe es zwar noch Unterschiede und Ungleichheiten, aber diese würden nicht so eklatant ausfallen wie heute. Darüber hinaus wäre dann auch noch eine dritte, utopische, Stufe der globalen Gerechtigkeit denkbar, eine Welt, in der es tatsächlich für die Lebenschancen keinen Unterschied machen würde, in welche Familie oder in welches Land man hineingeboren wird.
Die COVID-19-Pandemie und die Suche nach globaler Gerechtigkeit
Die COVID-19-Pandemie ist eine globale Erschütterung. Sie wird vor allem auch im Globalen Norden als solche wahrgenommen, weil sie hier konkret spürbar ist. Man kann mit einiger Sicherheit befürchten, dass dieser Virus weitaus weniger Aufmerksamkeit bekommen würde, wenn er gleich viele Todesopfer, allerdings nur solche im Globalen Süden gefordert hätte. Das ist keine zynische Kalkulation, sondern der Hinweis darauf, dass Nähe und unmittelbare Betroffenheit für unsere Wahrnehmung und unsere moralischen Gefühle eine große Rolle spielen. Wenige Tote in der Nachbarschaft sind uns näher und betreffen uns mehr als Tausende in einem fernen Land.
Die COVID-19-Pandemie erzeugt und verstärkt bestehende globale Ungerechtigkeiten. Dass ein Virus auftritt und Menschen tötet, ist für sich genommen noch keine solche. Diese Pandemie wird zu einer globalen Ungerechtigkeit und zu einer Verletzung der Menschenrechte, weil sie durch die menschengemachten sozialen und globalen Strukturen kanalisiert wird. Wer wie verletzlich ist, ergibt sich aus der Biologie und aus der sozialen Struktur; es liegt daran, wie alt man ist, aber auch daran, ob man sich selbst distanzieren kann, ob man in einem Slum oder in einer deutschen Kleinstadt lebt.
Wer welche Behandlung bekommen kann, liegt daran, wo man krank wird und über welche finanziellen Mittel man verfügt. Zum Glück sind, entgegen manchen Befürchtungen, die Altersstrukturen in den Ländern des Globalen Südens so, dass sie einen gewissen Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 bieten. Die dortige medizinische Infrastruktur wäre ansonsten zu schwach, um damit fertig zu werden, wenn schon in den reichen Metropolen wie New York oder Madrid die Krankenhausbetten und Beatmungsgeräte zum ersten Höhepunkt im März und April 2020 knapp geworden sind.
Es geht bei der COVID-19-Pandemie aber sicherlich nicht nur um Fragen von Gesundheit, Krankheit und Tod. Es geht, das wissen wir mittlerweile alle, darum, den wirtschaftlichen und sozialen Schaden zu begrenzen, der durch den Virus und die Maßnahmen seiner Bekämpfung eingetreten ist. Diese sozialen Folgen haben eine klare globale Dimension. Sie sind überall spürbar, weil die wirtschaftlichen Kreisläufe zusammenhängen, weil die Globalisierung unsere Wirtschaftssysteme miteinander verwoben hat. Wenn nun der Konsum eingebrochen ist und manche Dienstleistungssektoren ebenso, wenn der Tourismus in seiner schwersten Krise seit Jahrzehnten steckt, dann trifft dies Menschen auf der ganzen Welt.
Aber auch hier sind nicht alle gleich verletzlich und nicht alle haben gleich viel zu verlieren. Es ist paradox, aber wahr, dass diejenigen, die weniger haben, die Armen dieser Welt, mehr zu verlieren haben. In Europa wurden Millionen arbeitslos, Millionen werden in Schulden und Armut fallen und die Auswirkungen noch Jahre, vielleicht ihr ganzes Leben lang spüren. Es ist zwar zu befürchten, dass die Milliarden, die jetzt zur Stabilisierung der Wirtschaft ausgegeben werden, nicht (ausreichend) bei denen ankommen werden, die am dringendsten Hilfe und Unterstützung benötigen, aber dennoch sind die Wohlfahrtsstaaten so ausgerüstet, dass sie die schlimmsten Folgen abfedern können.
Das ist in vielen Ländern des Globalen Südens nicht der Fall. Hungerkrisen könnten folgen und die Fortschritte bei der Bekämpfung der absoluten Armut, die in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, werden sicherlich einen Dämpfer erleiden, wenn die globale Wirtschaft – abseits der Börsen, auf denen es nach einem kurzen drastischen Dämpfer im Sommer und Herbst 2020 ganz gut gegangen ist – einbricht und die reichen Staaten vielleicht sogar Entwicklungshilfe und andere Projekte reduzieren. Das betrifft auch die Anstrengungen zur Eindämmung der Klimakrise, die sowieso schon zu spät und zu wenig drastisch vorgenommen wurden und nun, so droht es uns, angesichts der neuen Herausforderungen, die Wirtschaft zu retten, unterminiert werden. Das hätte auf künftige Generationen gravierende Auswirkungen, aber auch hier würden vor allem wiederum jene Menschen leiden, die in ärmeren Ländern wohnen, die von der Verwüstung und der Lebensmittelknappheit betroffen wären, deren Lebensgrundlage durch den Klimawandel wegbrechen würde.
Von Moria zu uns
Angesichts der globalen Ungerechtigkeiten ist es verwunderlich, dass nicht viel mehr Menschen aus ihrem Elend fliehen und sich auf den Weg nach Europa machen. Migration stieg schlagartig im Jahr 2015 zum politischen und gesellschaftlichen Thema Nummer 1 auf. Die hunderttausenden Menschen, die über den Balkan oder Italien nach Westeuropa strömten, vor allem mit dem Ziel, nach Deutschland oder ins Vereinigte Königreich zu gelangen, haben zuerst zu einem kurzen Moment der Willkommenskultur, rasch danach aber zu einer Politik und Stimmung der geschlossenen Grenzen und der Festung Europa geführt. Wenige Wochen bevor dieser Text fertig gestellt wurde, brannte das Flüchtlingscamp in Moria, und für einige Tage war das Migrationsthema wieder präsent und verdrängte nach Monaten die Diskussionen um Corona, Lockdown und Maskenpflicht.
Natürlich wäre es das einzig richtige gewesen, alle Menschen aus Moria sofort nach Europa aufzunehmen; das hätte Deutschland, ja das hätte auch das relativ kleine Österreich alleine gut geschafft, diese 13.000 Menschen zu versorgen, ihnen eine ordentliche Unterkunft, Nahrung, Kleidung, medizinische Versorgung und Bildung zu geben. Vor allem Bildung für die Kinder und Jugendlichen, die in diesen Lagern und Camps wichtige Monate und sogar Jahre der Formation ihrer Identität, ihres Charakters und ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten vergeuden müssen, weil man ihnen keine Chance geben will.
Klar ist aber auch, dass es ein Signal gewesen wäre, dass es eine Chance auf Aufnahme nach Europa gibt, wenn man sein eigenes Camp anzündet. Flüchtlinge sind natürlich weder dumm noch sind sie ahnungslos. Es ist auch nur allzu verständlich, ja moralisch legitim, dass man zu Notmaßnahmen greift, um einer ausweglosen und hoffnungslosen Situation zu entfliehen. Diejenigen, die hier Unrecht getan haben, waren nicht die Flüchtlinge, die versucht haben, nach Europa zu kommen, die Armut und Krieg entflohen sind, und auch nicht diejenigen, die nach Monaten oder Jahren des Wartens und Ausharrens in elenden Bedingungen eines Flüchtlingscamps zu drastischen Mitteln greifen, um von dort weg zu kommen; um nach Europa zu kommen.
Globale Gerechtigkeit, verstanden als die minimale Wahrung der Menschenrechte für alle, ist mit solchen Zuständen wie in den Flüchtlingscamps an den Grenzen Europas unvereinbar. Es ist aber ebenso unvereinbar mit den Menschenrechten, diese nach Gutdünken zu gewähren und vorzuenthalten und zwischen guten und schlechten Flüchtlingen zu unterscheiden. Alle Flüchtlinge haben die gleichen Menschenrechte, und eine bevorzugte Aufnahme von Kindern und Jugendlichen oder Müttern, wie sie teils in den Medien und der Politik im September 2020 in Österreich gefordert wurde, ist nur unter ganz bestimmten Bedingungen moralisch legitim.
Der Notstand, dass man nicht alle Menschen aus Moria oder auch alle, die gerade in Lagern in Griechenland oder Italien festsitzen, aufnehmen könnte, ist in Europa noch lange nicht erreicht. Natürlich sind Kinder und Jugendliche verletzlicher als Erwachsene, aber auch Erwachsene, Männer und Frauen, leiden und sind ohnmächtig, verzweifelt und brauchen Schutz und eine Perspektive. Auch unter den Bedingungen, dass es legitim ist, dass Europa nicht alle aufnimmt – abgesehen davon, dass alle ja gar nicht kommen –, so sollte es doch wesentlich mehr tun. Die Konvergenz, also das gleichzeitige Auftreten von europäischer Arbeitslosigkeit durch die COVID-19-Pandemie, dem Elend in den Flüchtlingslagern und dem immer weiter anwachsenden Reichtum der Superreichen ist keinesfalls zufällig.
Der Milliardenreichtum, den einige wenige Menschen angehäuft haben, ist so unvorstellbar wie die Armut der Milliarden. Der Schutz der Menschenrechte hängt mit dieser ungerechten Verteilung finanzieller Mittel unmittelbar zusammen. Einerseits, weil die Menschenrechte durch Armut verletzt werden, andererseits weil der Reichtum dadurch entstehen kann, dass die ungerechten globalen Strukturen ausgenutzt und zum eigenen Vorteil benutzt werden. Die alte Forderung der Umverteilung von oben nach unten bleibt aktuell und sie wird durch die COVID-19-Pandemie genauso wie durch Flucht vor Armut, Not und Krieg weiter genährt.