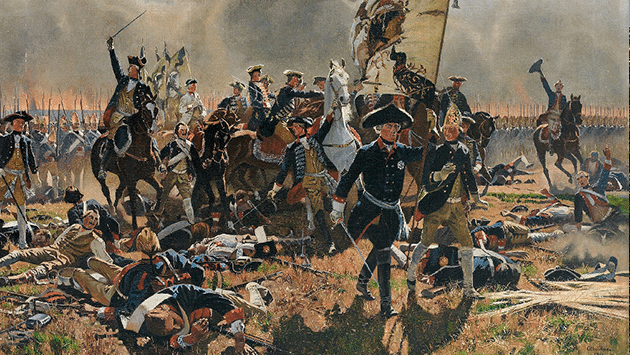Im Januar 1763 stellte Johann Christoph Stockhausen (1725–1784), Direktor des Lüneburger Johanneums, anlässlich des Endes des Siebenjährigen Krieges fest: „Der Krieg, man mag ihn betrachten von welcher Seite man will, ist immer ein Zerstöhrer der Menschen. Er ist es nicht nur unmittelbar, sondern auch mittelbar.“ Was als allgemein gültige Mahnung, nicht zuletzt angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine, gelten mag, stammt aus der Einladung zu einer Friedensfeier anlässlich des Endes des Siebenjährigen Krieges. Für das Thema Medizin, Krankheit und Krieg waren Stockhausens weitere Ausführungen in seiner Friedensrede zu den mittelbaren Folgen des Krieges besonders relevant. Unter anderem berichtete er von den hohen Verlusten durch ansteckende Krankheiten und Seuchen, die vor allem von den Militärlazaretten ausgingen. In Lüneburg hatten besonders im Jahr 1758 Fleckfieber und andere ansteckende Krankheiten gewütet, zahlreichen Menschen das Leben gekostet und die Stadt traumatisiert hinterlassen.
Stockhausens Ausführungen zeigen, wie sehr die Zeitgenossen die Gefahr des kriegsbedingten Ausbruchs ansteckender Krankheiten als existentielle Bedrohung wahrnahmen. Dieses Beispiel verdeutlicht zentrale Merkmale der Wahrnehmung von und des Umgangs mit ansteckenden Krankheiten im Krieg während der Frühen Neuzeit: So sahen die Menschen in der Frühen Neuzeit einen selbstverständlichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten ansteckender Krankheiten und Krieg. Sie betrachteten den Krieg mithin als unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Gesundheit. Es gab Infrastruktur zur medizinischen Versorgung, zum Beispiel Lazarette, und vor allem die städtische Obrigkeit bemühte sich durch Hygienemaßnahmen die Ausbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern. Es konnte also der Bedrohung durch ansteckende Krankheiten im Krieg gezielt therapeutisch wie präventiv begegnet werden.
Allerdings gilt es, diese Maßnahmen im Kontext der zeitgenössischen Medizin und des gesellschaftlichen Umgangs mit ansteckenden Krankheiten zu betrachten. Dabei stellte der Krieg frühneuzeitliche Gesellschaften vor besondere Herausforderungen, trug aber auch dazu bei, langfristig Vorstellungen von Ausbreitung und Verlauf ansteckender Krankheiten zu verändern. Der Fokus liegt daher im Folgenden auf zwei Fragen: Erstens, welche spezifischen Vorstellungen von Morbidität und Mortalität im Krieg bildeten sich unter dem Eindruck einer sich immer stärker quantifizierenden Militärmedizin heraus? – Und zweitens, welche Möglichkeiten gab es vor allem im städtischen Kontext für verschiedene Akteure wie Militär, landesherrliche und lokale Obrigkeit sowie die Bevölkerung, mit der Gefahr durch ansteckende Krankheiten in Kriegszeiten umzugehen?
Dabei bleiben mit Sicherheit andere Aspekte außen vor. Auf die Erfahrung von Krankheit und Verwundung durch unmittelbar davon betroffene Soldaten etwa wird nur am Rande eingegangen. Zunächst aber soll ein kurzer Überblick über die Grundlagen des Militärmedizinalwesens und die globale Dimension von Krankheit und Krieg zur Zeit des Siebenjährigen Krieges gegeben werden. Anschließend werde ich mich dem medizinischen Blick auf Morbidität und Mortalität befassen, bevor ich den konkreten Umgang mit der Seuchengefahr während des Siebenjährigen Krieges in den Blick nehme.
Strukturen und Institutionen
Seit den 1990er Jahren erhielt der Zusammenhang von Militär, Medizin, Krankheit und Krieg in der historischen Forschung größere Aufmerksamkeit. Vor allem die angelsächsische Sozial- und Kulturgeschichte der Medizin legte in erster Linie zum britischen und französischen Militär Arbeiten vor, die es erlauben, eine vergleichende Perspektive einzunehmen. Folgende Ergebnisse lassen sich zur Genese und Institutionalisierung des Militärmedizinalwesens in der Frühen Neuzeit knapp zusammenfassen. Erste Hinweise auf eine geregelte Versorgung kranker und verwundeter Soldaten lassen sich im späten Mittelalter in Form von Medizinalkassen finden. Daraus wurde die Versorgung kranker und verwundeter Soldaten durch Chirurgen und auch in städtischen Hospitälern finanziert.
Zweitens sind feste Einrichtungen des Sanitätswesens seit dem späten 16. Jahrhundert in Flandern nachweisbar. Seither verfügten europäische Armeen über eigene Feldlazarette. Drittens wurde das Militärmedizinalwesen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts integraler Bestandteil dauerhafter militärischer Infrastrukturen. Beispiele dafür sind die großen Invalidenhospitäler, die zuerst in Paris und Greenwich entstanden.
Viertens bestand eine enge Verflechtung zwischen ziviler und militärischer Gesundheitsversorgung. Ärzte und Chirurgen in landesherrlichen Diensten waren im Krieg für die Organisation des Sanitätswesens verantwortlich. Für viele Chirurgen war der Dienst in Feldlazaretten und als Feldscherer fester Bestandteil ihres Karriereweges, bevor sie sich niederlassen konnten. Fünftens wurde schließlich vor allem in Großbritannien die Frage nach dem Umgang mit kranken und verwundeten Soldaten im Verlauf des 18. Jahrhunderts immer mehr zum Gegenstand der öffentlichen politischen Auseinandersetzung. Der kranke oder verwundete soldatische Körper wurde außerdem zu einer statistischen Größe, die bei Verlustrechnungen eingepreist wurde.
Die Zeit des Siebenjährigen Krieges stellte in diesem Zusammenhang einen Wendepunkt dar. In der Medizin wurden klarere und evidenzbasierte Vorstellungen vom Zusammenhang von Krankheit und Krieg formuliert, während das Militär, vor allem seine Verwaltung, immer ausgefeiltere administrative Werkzeuge entwickelte und Daten über die Militärbevölkerung sammelte. Dies hatte aber zunächst kaum unmittelbare Auswirkungen auf die Einrichtungen zur Versorgung von kranken und verwundeten Soldaten.
In den meisten Armeen der Frühen Neuzeit wurden die Soldaten seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch Kompaniefeldscherer und Regimentschirurgen sowie Stadt- und Garnisonsärzte medizinisch versorgt. Kranke und Verwundete wurden in der Regel in ihren Quartieren behandelt und Soldaten, die nicht vor Ort waren, bekamen ihre Behandlungskosten aus der Medizinalkasse ihres Regiments erstattet. Ähnliche Arrangements bestanden auf den Schiffen der Kriegsmarine, deren Flotten unter Umständen durch eigene Lazarettschiffe begleitet wurden.
Auf Feldzügen wurde dieses System routinemäßig um temporäre Feldhospitäler erweitert. Das Personal für diese Hospitäler rekrutierte sich aus Leib- und Hofärzten und -chirurgen, den Amtsärzten und -chirurgen sowie den Feldscherern sowie angeworbenen Chirurgengesellen. Als Pflegepersonal dienten neben Soldatenfrauen und -witwen lokal angeworbene Tagelöhner und manchmal auch invalide Soldaten. Die Hospitäler konnten als Hauptlazarette an festen Orten eingerichtet werden – oft zusammen mit Magazinen und der Feldbäckerei – oder als fliegende Lazarette der Armee folgen. Spezielle Lazarettgebäude gab es in der Regel nicht. Schlösser und Kirchen wurden genauso genutzt wie Privathäuser oder Scheunen. So gesehen manifestierten sich Militärlazarette nicht in einer spezifischen Architektur, sondern in erster Linie in den in den Akten überlieferten administrativen Praktiken.
Globale Herausforderungen
Betrachtet man den Siebenjährigen Krieg militärisch und politisch als Konflikt mit globaler Dimension, so trifft das auch auf Kriegskrankheiten, Morbidität und Mortalität zu. An dieser Stelle nur ein paar kurze Hinweise. Auf dem europäischen Kriegsschauplatz galten den Ärzten und Chirurgen die altbekannten Kriegskrankheiten, vor allem unterschiedliche Arten von Fiebern wie Fleckfieber oder Wechselfieber – also Malaria –, als große Gefahr für die Gesundheit der Armeen. Außerdem fürchtete man die Ruhr als besondere Herausforderung für das Militärmedizinalwesen mit ihrer hohen Ansteckungsgefahr und besonderen Anforderungen an die Hygiene in Lagern und Lazaretten.
Auf den Kriegsschauplätzen in Übersee kamen zu den aus Europa bekannten Krankheiten fremde Erreger wie das Gelbfieber hinzu, gegen das die europäischen Soldaten kaum über Abwehrkräfte verfügten, was mitunter große Verluste zur Folge hatte. In der Karibik begann die Royal Navy seit dem Österreichischen Erbfolgekrieg auch aus diesem Grund, ihre Lazarett-Infrastruktur systematisch auszubauen. Zunächst auf Jamaika, später auf Antigua und anderen Karibikinseln unter britischer Kontrolle entstanden Hospitäler nach dem Vorbild der Hospitäler in Greenwich und Portsmouth.
Diese Zweckbauten dienten der dauerhaften Versorgung der kranken und verwundeten britischen Seeleute und halfen, die Verluste der britischen Marine in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts signifikant zu senken. In Nordamerika wiederum hatten die regulären britischen und französischen Truppen während des Siebenjährigen Krieges häufig auch unter Mangelerscheinungen zu leiden. So verloren zum Beispiel zwar 58 britische Soldaten ihr Leben in der Schlacht um Quebec im September 1759, allerdings starben fast zehnmal so viele im folgenden Winter, viele an Skorbut.
Umgekehrt hatte der Krieg in den Kolonien auch massive Auswirkungen auf die Gesundheit vor allem indigener Populationen. So hatten die aus Europa eingeschleppten Pocken großen Einfluss auf Morbidität, Mortalität und Moral im Krieg in Nordamerika. Während ein Großteil der Soldaten aus England über einen hohen Grad an Immunität gegen Pocken besessen haben dürfte, waren die nordamerikanischen Rekruten deutlich schlechter gegen eine Infektion geschützt. Entsprechend groß war die Angst unter ihnen vor einer Epidemie. Viel stärker noch aber war die indigene Bevölkerung betroffen. Weitgehend ohne Immunschutz war sie der Krankheit ausgeliefert. Die Annahme aber, dass das britische Militär Pocken im Siebenjährigen Krieg systematisch als biologische Waffe einsetzte, ist umstritten. In jedem Fall aber hatte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Verbreitung der Pocken im Zuge der kolonialen Expansion in Nordamerika katastrophale Folgen für die indigene Bevölkerung. Von den Europäern wurde die von der Ausbreitung der Pocken beförderte Zersetzung indigener Kultur und politischer-militärischer Handlungsfähigkeit systematisch im Sinne ihrer kolonialen Interessen ausgenutzt.
Morbidität und Mortalität im Siebenjährigen Krieg
Während sich das Leid, das Krankheit und Krieg mit sich brachte, kaum beziffern und nicht in Zahlen ausdrücken lässt, wurden die Soldaten und ihr körperlicher Zustand in der Frühen Neuzeit zum unmittelbaren Gegenstand administrativer Praktiken. Um dieses Humankapital zu managen, wurde auf Werkzeuge aus der Buchführung sowie der Regiments- und Lazarettökonomie zurückgegriffen. Listen, Tabellen und Rechnungen wurden ursprünglich angelegt um die Zahl der Soldaten zu erfassen und die Kosten für ihre Bezahlung, Verpflegung, Transport und Ersatz zu berechnen.
Es ist nun naheliegend zu erwarten, dass auf Grundlage der erhobenen Daten halbwegs belastbare Aussagen über die Verluste der Armeen zu treffen wären. Dies ist aber mitnichten der Fall. Zum einen ist die Überlieferung lückenhaft, das heißt, komplette Zahlenreihen über einen längeren Zeitraum zu Verlusten und Krankenstand sind selten. Zudem sind die überlieferten Daten nicht sauber, das heißt, es gibt Lücken und die Daten sind fehlerhaft. Es gibt aber auch Ausnahmen. Aus dem Österreichischen Erbfolgekrieg etwa sind Zusammenstellungen von Monatslisten erhalten, die über den Stand und die Verluste der hannoverschen Regimenter in den Niederlanden Auskunft geben. In ihnen wurden der Ist-Stand, Krankenstand und Verluste angegeben und nach Regimentern erfasst. Aber auch hier handelt es sich um aggregierte Daten, deren Erhebungsgrundlage unklar ist. Außerdem sind die Daten fehlerhaft: Addiert man zum Beispiel die Verluste durch Kranke, Gestorbene, Deserteure und Abgänge, entspricht die Summe abzüglich der neu Angeworbenen nicht der Zahl des fehlenden Personals. Ebenso ist nicht deutlich, worauf sich die Kategorien genau beziehen. So liegt es zwar nahe, dass mit „Gestorbene“ jene in den Lazaretten gemeint sind, was sich aber genau hinter den „Abgängen“ verbarg, bleibt unklar.
Dennoch lassen sich auf Grundlage der Daten einige allgemeinere Beobachtungen machen. So lag die Morbidität von Juli 1744 bis April 1748 im Schnitt bei 6,3 %, mit 9,7 % aber deutlich höher im Kriegsjahr 1745, in dem die hannoverschen Regimenter verstärkt in Kampfhandlungen verwickelt waren und unter anderem in der Schlacht bei Fontenoy im Mai 1745 zum Teil schwere Verluste hinnehmen mussten. Was sich an den vorliegenden Daten ebenso ablesen lässt, sind Trends bei der Morbidität und Mortalität und vor allem die Auswirkungen einzelner Kriegsereignisse.
Bemerkenswert ist an den eben vorgestellten Zahlen, dass sie kaum mit den Zahlen vergleichbar sind, die für den Siebenjährigen Krieg bekannt sind. Die folgenden Zahlen stammen aus der immer noch viel zitierten Arbeit von Boris Urlanis zur Bilanz der Kriege (Berlin, 1965) in Europa seit dem 17. Jahrhundert. Darin wertete er in den 1960er Jahren in einer Metastudie die ältere demographische und vor allem militärgeschichtliche Forschung zu Menschenverlusten aus. Für den Siebenjährigen Krieg gab er als Gesamtverluste der Armeen auf dem europäischen Kriegsschauplatz 550.000 Soldaten und Offiziere an.
Für die österreichische Armee schlüsselte er die Zahlen weiter auf und gab die Verteilung auf Gefallene mit 26 % an, weitere 15 % seien an Verwundungen gestorben und die Mehrheit von 59 % an Krankheiten verstorben. Allerdings stehen diese Zahlen im Widerspruch zu anderen Zahlen, die Urlanis nannte, wenn er an anderer Stelle die Mortalität in Bezug auf Krankheiten bei den österreichischen und preußischen Armeen mit 80 % angab. Was aber unstrittig sein dürfte – und das galt zumindest bis zum amerikanischen Bürgerkrieg – ist, dass in den Kriegen der Frühen Neuzeit weit weniger Soldaten im Kampf getötet wurden oder an ihren Verwundungen starben als an Krankheiten.
Der ärztliche Blick
Dies wurde besonders in den Feldlazaretten deutlich. Dort wurden auch auf unterschiedlichste Weise Daten über die Patienten gesammelt. Allerdings ist diese Überlieferung noch dürftiger und bruchstückhafter als die der Kriegskanzleien. Für die preußische Armee aber sind Daten überliefert, nach denen die Mortalität in den schlesischen Lazaretten im Siebenjährigen Krieg bei 19,4 % lag. In den Feldlazaretten konnte die Datenerhebung auf traditionellen ärztlichen Aufzeichnungspraktiken beruhen, wie Patientenjournalen und Fallgeschichten, die in Publikationen wie den Sammlungen von Fallgeschichten führender preußischer Feldärzte und -chirurgen nach dem Siebenjährigen Krieg einflossen oder in medizinischen Zeitschriften veröffentlicht wurden.
Eine andere Form der Datenerhebung stellen die Krankenjournale dar, die in den Krankensälen der Feldlazarette geführt wurden. Sie dienten dazu, die von unterschiedlichem Personal vorgenommenen Diagnosen, Therapien und Krankheitsverläufe kontinuierlich zu dokumentieren. Derartige Journale wurden in der Berliner Charité, die zugleich Ausbildungsklinik für preußische Feldchirurgen war, bereits im frühen 18. Jahrhundert eingeführt.
Bereits im Österreichischen Erbfolgekrieg wurden solche Daten und die der Militärverwaltung von Ärzten genutzt, um grundlegende Überlegungen zum Zusammenhang von Krankheit und Krieg anzustellen. In seinen sehr einflussreichen Beobachtungen zu den Krankheiten einer Armee (deutsch Ausgabe von 1754) aus dem Österreichischen Erbfolgekrieg erhob der britische Generalfeldmedicus John Pringle den Anspruch, auf Grundlage empirischer Beobachtungen berechnen zu können, „[…] auf wieviel Leute man sich zu verschiedenen Zeiten des Jahres zum Dienst verlassen könne.“ Pringle führte den allgemeinen Gesundheitszustand der Soldaten auf äußere Umwelteinflüsse und die sex res non naturales zurück, also Licht und Luft, Nahrung, Bewegung und Ruhe, Schlaf und Wachsein, Ausscheidungen und die, wie es hieß, „Anregungen des Gemüts“.
Pringles Ätiologie war somit tief in den humoralpathologischen Vorstellungen der in den antiken Traditionen stehenden europäischen Medizin verwurzelt. Pringle machte in diesem Zusammenhang nicht nur Angaben zum relativen Krankenstand einer Armee auf Grundlage der monatlichen Rapporte, sondern setzte sie auch in eine statistische Beziehung zu spezifischen Umweltfaktoren – hier jahreszeitlich bedingte klimatische Verhältnisse – und machte Angaben zu den typischen Konjunkturen der Morbidität während eines bestimmten Feldzuges.
Für Preußen lässt sich ebenfalls zeigen, wie ursprünglich ökonomisch motivierte Praktiken den Blick von Ärzten auf die Morbidität in der Armee veränderten. So wurden in Preußen im Siebenjährigen Krieg routinemäßig Rapporte aus den Feldlazaretten eingereicht. In tabellarischer Form gaben diese Berichte einen Überblick über die Zahl der Patienten, unterschieden nach Offizieren und Gemeinen, zu Beginn und am Ende des Berichtszeitraums und dazwischen die Anzahl der Rekonvaleszenten, Invaliden und Verstorbenen. Solchen Rapporten waren in der Regel Berichte beigefügt, in denen der Generalfeldmedicus oder der Hospitaldirektor über außergewöhnliche Vorfälle im Lazarett informierten, Personalfragen diskutierten und die Entwicklung der Morbidität und Mortalität kommentierten.
Im Begleitschreiben zu einem Rapport aus dem Torgau vom November 1760 zum Beispiel informierte der preußische Generalfeldmedicus Christian Andreas Cothenius (1708–1789) nicht nur über die auf Grund der verbesserten Verhältnisse im Lazarett gestiegenen Rekonvaleszentenrate. Er prognostizierte außerdem vor dem Hintergrund seiner Beobachtungen, dass er im kommenden Monat in der Lage sein werde, weitere 2500 Verwundete und innerhalb der darauffolgenden drei Monate noch einmal 1500 Verwundete als Rekonvaleszenten zurück zur Armee zu schicken. Darüber hinaus gab er an, 650 Kranke in den kommenden zwei Monaten als Rekonvaleszenten entlassen zu können.
Cothenius stellte zwar keine Korrelation zwischen dem Gesundheitszustand der Patienten und ihrer Behandlung mit Morbiditäts- und Mortalitätsraten her. Allerdings benutzte er die Daten und seine Beobachtungen im Feldlazarett sehr wohl, um auf ihrer Grundlage Vorhersagen über die zukünftig zu erwartenden Rekonvaleszentenzahlen zu treffen.
Pringle und Cothenius richteten einen quantifizierenden Blick auf den Körper und lenkten den Fokus weg vom individuellen Körper hin zu größeren Patientengruppen. Hier zeichnet sich eine wesentliche Verschiebung ab, wenn sich Mitte des 18. Jahrhunderts die Medizin quantifizierende Praktiken aus der Körperökonomie von Militär und Militärverwaltung aneignete. Und diese Verschiebung bestätigt die Befunde, die die „Geburt der Statistik“ ins 18. Jahrhundert datieren.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelten die Ärzte und Chirurgen in den Feldlazaretten einen Blick auf die Lazarettbevölkerung, der diese zu einer statistischen und damit dynamischen Größe machte, deren Veränderung potentiell Rückschlüsse auf den körperlichen Zustand der Armee genauso zuließ wie die mögliche Einflussnahme darauf durch gezielte Anwendung von Behandlungsmethoden und Präventivmaßnahmen. Dass eine derartige Sichtweise allerdings Mitte des 18. Jahrhunderts noch keineswegs handlungsleitend im Sinn einer evidenzbasierten Medizin war, wird am folgenden Beispiel des Umgangs mit der Gefahr der Ausbreitung ansteckender Krankheiten im Siebenjährigen Krieg in Nordwestdeutschland deutlich.
Die „Kriegsseuchen“ und das staatliche Gesundheitswesen
Angesichts des Kriegsverlaufs in den Jahren 1757/58 ist es nicht überraschend, dass Nordwestdeutschland vor allem 1758 von kriegsbedingten Epidemien betroffen war. Seit dem Spätsommer 1757 bis zum Herbst 1758 fanden im Kurfürstentum Hannover Truppenbewegungen in großem Umfang statt. In deren Verlauf berichten die Quellen vom Ausbruch sogenannter „Fleckfieber“ und „hitziger Fieber“. Die am stärksten betroffenen Gebiete lagen entlang der Weser, der wichtigsten Versorgungslinie und in der Lüneburger Heide, unter anderem auch in den von mehrfachen Durchzügen und Einquartierungen betroffenen Städten Lüneburg, Uelzen und Celle. Dies zeigte sich deutlich im natürlichen Überschuss der Bevölkerung, der in Lüneburg, Uelzen und Celle im Seuchenjahr 1758 deutlich stärker negativ ausgeprägt war als in anderen Krisenjahren.
Allerdings muss hier einschränkend hinzugefügt werden, dass die Auswirkungen des Krieges punktuell und eher durch die spezifischen Bedingungen vor Ort wohl zu erklären sind. So unterschied sich der natürliche Überschuss im Wendland 1758 nicht von anderen, durch Missernten und Konjunkturkrisen verursachten, Krisenjahren in den späten 1760er und in den 1770er Jahren. Hier zeigte sich die generelle Vulnerabilität vorindustrieller Populationen am natürlichen Plafond.
In jedem Fall waren den Zeitgenossen die akuten epidemiologischen Auswirkungen des Krieges klar. So hatten die in Hannover erscheinenden Nützlichen Nachrichten bereits im März 1758 unter dem Eindruck der Auswirkungen des Krieges auf das Kurfürstentum Hannover ihren Lesern die Frage gestellt, wie das Einhergehen von Krankheit und Krieg zu erklären sei und welche Gegenmaßnahmen getroffen werden könnten. In einer Antwort vom 28. April 1758 erläuterte ein anonymer Autor, vermutlich ein Arzt, worin die Ursachen für das Einhergehen von Krankheit und Krieg lägen und was die geeignetsten Maßnahmen wären, den Ausbruch dieser „Kriegsseuchen“ zu verhindern oder zumindest einzudämmen.
Mit Blick auf mögliche Präventivmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung ansteckender Krankheiten schlug er vor, besonders auf Reinlichkeit auf den Straßen, in den Quartieren und Lazaretten zu achten, in den Lazaretten Kranke und Verwundete strikt zu trennen, die Krankensäle regelmäßig zu Lüften und zu räuchern sowie auf die persönliche Hygiene und gesunde Ernährung der Soldaten zu achten.
Als sich Daniel Philipp Rosenbach (1691–1760), Stadtarzt von Hannoversch Münden, mit seinem Entwurf für eine Hospitalordnung 1759 an die Kriegskanzlei in Hannover wandte, schlug er ähnliche Maßnahmen vor. Außerdem teilte er die Patienten in drei Klassen ein: jene, die an ansteckenden Krankheiten litten, jene die von sogenannten „gemeinen Fiebern“ befallen waren und Verwundete. Da er eine Ansteckung durch „[…] ausdünstung der bösen Lufft und giftigen miasmatum […]“ befürchtete, empfahl er die getrennte Unterbringung der Patienten in frei stehenden Gebäuden am Stadtrand, damit „[…] die aus jenem dringenden vapores gravolentes und die foetores der Nachbarn nicht einen Schaden und eckel, noch morbos epidemicos veruhrsachen und nach sich zieen mögen.“
Diese Sicht auf den Zusammenhang von Krieg und Epidemien wurde über Ärztekreise hinaus weit geteilt und war in der hippokratisch geprägten westlichen medizinischen Tradition verwurzelt. Humoralpathologie und Miasmenlehre machten Präventionsmaßnahmen plausibel, die auf persönlicher und öffentlicher Hygiene, Diätetik und im Zweifel Quarantänemaßnahmen basierten. In einem ähnlichen Rahmen bewegte sich das staatliche Gesundheitswesen.
Sowohl für den Landesherrn als auch die Obrigkeiten vor Ort stellte die epidemiologische Dimension des Krieges ein Problem dar. So erließ die Regierung in Hannover bereits am 6. Oktober 1757 eine Verordnung zur Reinigung der Häuser, Gassen und Hospitäler, die am 30. März 1758 erneuert wurde, unmittelbar nachdem die französische Armee das Kurfürstentum verlassen hatte. Bei der Umsetzung hatte die Obrigkeit vor Ort einen gewissen Spielraum, und in Nienburg etwa führte der Rat im April 1758 eine regelmäßige Müllabfuhr ein und beauftragte den Stadtsyndikus dafür zu sorgen, dass Straßen und Häuser regelmäßig geräuchert wurden. Außerdem sollte er auf die Hygiene in den Quartieren achten, vor allem dort, wo Kranke untergebracht waren. Bestattungen in Massengräbern wurden untersagt, da diese „[…] abscheulichen Gestanck veruhrsachten und die Lufft inficiren konnten.“
Militärlazarette im städtischen Raum
Besonderes Augenmerk galt mit Blick auf die öffentliche Gesundheit den Lazaretten. Sie waren die wichtigsten Einrichtungen zur Versorgung von Kranken und Verwundeten im Krieg. Hauptlazarette wurden im Siebenjährigen Krieg an zentralen Versorgungsorten eingerichtet. Dazu gehörten in Nordwestdeutschland Münster, Osnabrück und Nienburg. Fliegende Lazarette folgten der Armee im Feld. Wie die Präsenz solcher Lazarette sich vor Ort auswirkte und welche Folgen sie für die Wahrnehmung von und den Umgang mit der Gefahr der Ausbreitung ansteckender Krankheiten hatte, möchte ich abschließend kurz am Beispiel Hamelns in den Jahren 1757 bis 1759 verdeutlichen.
Hameln war neben Nienburg, Harburg und Göttingen eine der wichtigen kurhannoverschen Landesfestungen. Seit dem späten 17. Jahrhundert war dort eine Garnison stationiert und zu ihrer Unterbringung Kasernengebäude errichtet worden. Im Siebenjährigen Krieg wurden die öffentlichen Gebäude am Markt (Nikolaikirche, Rathaus, Neues Gebäude, Kommandantenhaus), das Gasthaus zur Sonne und die Baracken beim Münster im Südwesten und am Zehnthof im Nordwesten der Stadt mit Lazaretten belegt.
Ein erstes französisches Lazarett wurde Ende Juli 1757 nach der Schlacht bei Hastenbeck eingerichtet. Wie der Pastor der Münsterkirche Johann Daniel Gottlieb Herr berichtete, herrschten dort schlimme Zustände: „Das Sterben darin war außerordentlich und nur die allerwenigsten geneseten, sonderlich die in der Marktkirche lagen, daher sie zuletzt heraus und auf das Rahthaus geleget wurden.“ Glaubt man der älteren Stadtgeschichte Hamelns, dann starben dort bis Ende 1757 über 4000 Patienten, die auf dem Münsterkirchhof und vor dem Mühltor in Massengräbern bestattet wurden.
Die Größe des zum Teil zeitgleich bestehenden hannoverschen Lazaretts variierte im Laufe der Zeit und wuchs während des Jahres 1758 erheblich an. Geleitet wurde es durch den Stadtarzt von Hameln, Johannes Noréen und einen aus Hannover hinzu beorderten Stadtchirurgen, Ludwig Christian Lammersdorf.
Der Stadt gaben die Lazarette beständig Anlass zur Sorge, und so klagte der Rat der Stadt Hameln Ende Oktober 1758 einmal mehr sein Leid der Regierung in Hannover: „So dann fürchten wir unß für ansteckende Kranckheiten, und haben dahero gesuchet, daß die Krancke in die Casernen gebracht werden mögen, allwo die freye lufft ihre genesung befordern, und das vorbey fließende Wasser die zur […] fortschleppung eines Contagii geneigte Unreinigkeiten abführen kann. Von blessirten ist hier nicht die Rede; Für diese ist genugsahmer Raum in der Stadt […].“
Anlass für die Bitte um eine Verlegung der an ansteckenden Krankheiten leidenden Patienten war aber nicht die unmittelbare Gefahr des Ausbruchs einer Seuche, sondern ein länger schwelender Streit mit dem Garnisonskommandanten, Generalleutnant Georg Friedrich Freudemann. Während das Militär die Lazarette in den zentralen Gebäuden um den Markt belassen wollte, bemühte sich die Stadt um eine Verlegung der Patienten in die Baracken am Zehnthof an den Stadtrand.
In diesem Streit um die Unterbringung des Lazaretts mutmaßte der Rat zu den Motiven des Militärs, dass die in den Baracken untergebrachten Offiziere nicht auf die komfortablen Quartiere und das ihnen dort kostenfrei zur Verfügung gestellte Feuerholz verzichten wollten. Die Stadt verwies darauf, dass die Unterbringung des Lazaretts aber eben nicht im Rahmen der Einquartierung zu Lasten der Stadt geschehen dürfe, sondern zu Lasten der Kriegskasse durch das Kommissariat organisiert werden müsste. Zugleich zeigte man sich kompromissbereit, indem die Stadt einwilligte, leicht verwundete Soldaten in das reguläre Quartier zu nehmen.
Dabei war die Sachlage eigentlich längst klar. Bereits am 18. Oktober 1758 hatte die Kriegskanzlei in Hannover nämlich im Sinne der Stadt entschieden, kranke und verwundete Soldaten zu trennen und die Kranken in die Kasernen zu verlegen. Auf die abermalige Beschwerde des Hamelner Rates hin sah sich die Kriegskanzlei gezwungen zu intervenieren und wies den Garnisonskommandanten an, zumindest die kranken und verwundeten Soldaten voneinander zu trennen und erstere in die Baracken am Stadtrand zu verlegen, um eine weitere Ausbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern.
An diesem Beispiel wird deutlich, wie stark die Argumentation seitens des Hamelner Rates und der Kriegskanzlei auf zeitgenössische epidemiologische und militärmedizinische Gemeinplätze rekurrierte. Die Angst vor dem Ausbruch einer Epidemie war aber nur ein Motiv für die Verlegung des Lazarettes und zugleich rhetorisches Mittel. Andere Motive wurden vom medizinisch-epidemiologischen Diskurs überlagert: der Standeskonflikt zwischen Militär und städtischer Obrigkeit um Privilegien bei der Einquartierung, genauso wie Ressourcenkonflikte zwischen Kriegskanzlei, Stadt und Militär.
Fazit
Betrachtet man abschließend die frühneuzeitliche Deutung von „Kriegsseuchen“, dann ähnelte diese zunächst der Interpretation von anderen Epidemien und Naturkatastrophen. Sie erschienen den Zeitgenossen im Anschluss an das 2. Buch Mose (Exodus) als Strafe Gottes oder wurden im Rahmen eschatologischer Deutungen mit den Reitern der Apokalypse (Krieg, Hunger und Tod) assoziiert. Solche Narrative hatten zur Zeit des Siebenjährigen Krieges aber in der Regel nur noch topische Funktion. Mit anderen Worten: Die Annahme eines selbstverständlichen Einhergehens von Krankheit und Krieg wurde nicht mehr metaphysisch ausgedeutet oder anderweitig hinterfragt. Vielmehr wurde dieser Zusammenhang im Rahmen der zeitgenössischen Medizin rationalisiert. Deren Annahmen bewegten sich im Wesentlichen im Rahmen von auf antike Wurzeln zurückgehenden Konzepte wie der Humoralpathologie, Miasmentheorie und Contagion als Krankheitsursache sowie den sex res non naturales als therapeutische Grundlage. Erst ab der Mitte des 18. Jahrhunderts sind Ansätze zu einer medizinal-statistischen Betrachtung von kriegsbedingten Epidemien zu beobachten, die aber nicht in Konkurrenz zu hergebrachten Deutungsangeboten standen und noch nicht als Grundlage evidenzbasierter Seuchenbekämpfung herangezogen wurden. Erste Ansätze dazu sind in der Tat erst im 19. Jahrhundert zu beobachten.
Ob die Kriegsseuchen mit den durchziehenden Soldaten kamen oder endemisch waren, war in der Frühen Neuzeit sekundär. Wichtiger waren die spezifischen Bedingungen, die eine Ausbreitung ansteckender Krankheiten beförderten und das praktische Wissen, das Seuchenprävention und -eindämmung erforderten. Beim Umgang mit ansteckenden Krankheiten während des Siebenjährigen Krieges standen praktische Fragen im Vordergrund: Durch welche Maßnahmen ließen sich Epidemien verhindern oder eindämmen? Wer hatte dafür die Verantwortung zu übernehmen? Wie ließen sich Seuchenschutz, militärische und ökonomische Interessen vereinbaren?
Dementsprechend waren Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens der Hauptansatzpunkt für die städtische und landesherrliche Obrigkeit. Zugleich führten sie mitunter zu Konflikten, wenn einerseits das Militär sich in seinen Handlungsmöglichkeiten und Privilegien eingeschränkt sah. Andererseits sahen die Untertanen mitunter ihre eigene Gesundheit bedroht, wenn die Obrigkeit ihrer Pflicht nicht ausreichend nachzukommen schien, die Ausbreitung von Seuchen in Kriegszeiten zu verhindern.
Einige der vorangegangenen Beobachtungen lenkten den Blick auf Vorstellungen, die uns heute fremd sind. Andere hingegen kommen uns auch in der aktuellen Pandemie bekannt vor: althergebrachte Maßnahmen zur Seucheneindämmung wie Abschottung, Quarantäne und Hygienemaßnahmen, bedingt aussagekräftige statistische Modelle, Infrastruktur, die angesichts der Katastrophe an ihre Grenzen stößt, oder die Unterwerfung der Deutungen des Seuchengeschehens unter partikulare, politische und ökonomische Interessen. Eines aber – und das soll nicht unerwähnt bleiben – war dem 18. Jahrhundert weitgehend fremd: Nämlich die Ursache für den Ausbruch von Kriegsseuchen in den dunklen Machenschaften einer wie auch immer gearteten Verschwörung zu suchen.