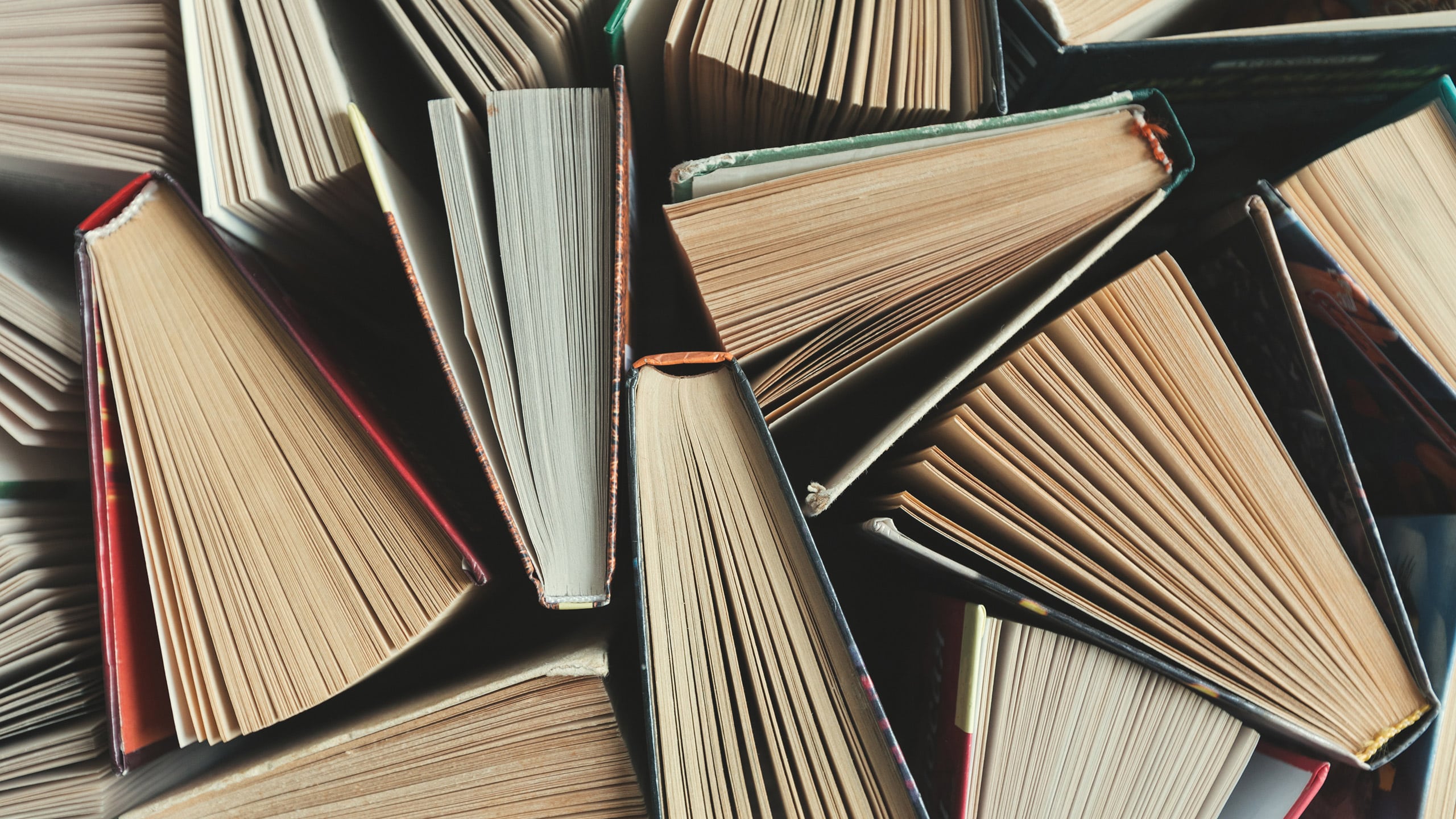Im letzten Jahr habe ich Adolf Muschg zum ersten Mal getroffen bei der Tagung des Politischen Clubs in der Evangelischen Akademie in Tutzing. Das Thema war Religion und Politik. Eine Verhältnisbestimmung. Muschg sollte seine Drei-Potenzen-Hypothese entfalten, die er von dem Historiker Jacob Burckhardt übernommen hat: Religion, Staat und Kultur bilden einen unverzichtbaren Dreiklang. Was könnte ein Literat dazu sagen? Diese Fragestellung
interessierte mich.
Ich erlebte einen Literaten, der sehr persönlich zu diesem Thema Auskunft gab, keine schon hundertmal vertretenen Thesen, sondern eher die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und das Ganze in einer Lebendigkeit und Überzeugungskraft vorgetragen, die fesselte.
So habe ich Adolf Muschg angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, in der Katholischen Akademie zu lesen. Es folgte kein langes Zögern, kein Vertrösten, sondern der Hinweis, dass er an einer Erzählung arbeite, die bis zur Lesung fertig sein könnte. Und wirklich: Die Erzählung liegt vor. Ein großes Dankeschön an den Beck Verlag, der das möglich gemacht hat – und ein herzliches Willkommen an Adolf Muschg und seine Frau Atsuko.
Adolf Muschg wurde am 13. Mai 1934 in Zollikon geboren, am rechten Ufer des Zürichsees, der Goldküste, die so heißt, weil es dort viel Sonnenschein gibt. Die gegenüberliegende Seite, die früh durch die Berge verschattet wird und wenig Sonnenschein abbekommt, heißt Pfnüsch- oder Schnupfenküste. Der Vater war Grundschullehrer, pietistisch geprägt und Kolumnist im Zolliker Boten. Er schrieb gegen den Lippenstift und das Frauenwahlrecht. Die Mutter von Adolf war Krankenschwester, der liebste Patient war ihr Sohn, der so eine hypochondrische Mitgift abbekam.
Dass Muschg nach dem Tod des Vaters die Gelegenheit zum Besuch des Gymnasiums und zum Studium bekam, war wunderähnlich. Er studierte Germanistik, Anglistik und Psychologie an der Zürcher Hochschule. Einer seiner Lehrer war Emil Staiger, bei dem er über Ernst Barlach promovierte. Von 1959 bis 1962 unterrichtete er Deutsch an der Kantonalen Oberrealschule in Zürich. Die viel beachtete Dissertation brachte ihn von 1962 bis 1964 als Lektor nach Japan, anschließend als Assistent von Walter Killy nach Göttingen. 1965 folgte die Veröffentlichung des Romans Im Sommer des Hasen, der ihm angesichts einer Schreibblockade viel Mühe gekostet hatte.
1970 erfolgte die Berufung als Professor für deutsche Sprache und Literatur an der ETH Zürich. 1981 nahm er die Frankfurter Poetikvorlesung über Literatur als Therapie wahr, 1994 bekam er den Büchner-Preis, 2001 den Grimmelshausen-Preis und 2003 wurde er Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Lebensentscheidend wurde 1983 für ihn eine Lesung am Goethe-Institut in Kyoto. Dort lernte er Atsuko Kanto kennen, die er 1991 heiratete. Ihr ist die Erzählung Nicht mein Leben gewidmet, aus der Muschg heute lesen wird.
Immer häufiger hat sich Muschg in den letzten Jahren mit dem Thema Sterben und Tod auseinandergesetzt. Für einen Neunzigjährigen nichts Außergewöhnliches. Aber wie er es tut, das ist außergewöhnlich.
Sterben: das letzte Abenteuer
Der weiße Freitag – so lautet eine Erzählung von Muschg und so bezeichnete Johann Wolfgang von Goethe den Tag, an dem er und sein Dienstherr Herzog Carl August auf dem Gotthard auf über 2200 Metern Höhe den Furka-Pass überschritten, „eine Sache auf Leben und Tod“. In die Lektüre des Berichts von Goethe und seine Deutung streut Muschg immer wieder eigene Reflexionen zu Tod und Sterben ein. So wird dieses Buch zu einem Memento mori.
„Krebsangst wird nun, da der Krebs sichtbar eingetreten ist, zum leeren Wort. Keiner der nächsten Verwandten hat mein Alter erreicht – meine Mutter ausgenommen, und ihr letztes Jahr möchte ich keinem Feind wünschen. Was zählt: dass ich dankbar bleibe. Offenbar hat Dankbarkeit ihren Preis, und was ich dafür bezahlt habe…muss angenommen werden als gültige Währung, auch wenn ich gut genug weiß, wieviel daran gemogelt war.“ (187)
Die Dankbarkeit ist es, die ihn vor einem in der Schweiz durchaus möglichen Schritt Abstand nehmen lässt: „Heute(!) glaube ich: Beihilfe zur Entsorgung kommt nicht in Frage: dafür ist der letzte Atem zu kostbar. Mit dem Giftbecher, auch dem bekömmlichsten, stirbt man nicht seinen eigenen Tod, auch wenn man ihn als Abschiedsparty zelebriert.“ (188)
Er ist zu der Überzeugung gekommen, dass jeder Augenblick des Lebens kostbar ist. Und er möchte, solange es irgend geht, für Umstände sorgen, die das Gefühl des Glückens stärken. Das hat er durch sein Schreiben gelernt. Schreiben heißt Hoffnungen abweisen, die für einen selbst nicht zutreffen und radikal ehrlich sein. Vielleicht ist das Sterben das letzte Abenteuer, das bestanden werden will: „Mit dem Sterben beginnt ein unbekanntes. Warum darf es kein Abenteuer sein? Es gehört zu den wenigen, für die man alt sein darf, und dankbar, dass man es werden durfte. Den Weg, den du jetzt gehst, gehen alle, aber du zum ersten Mal.“ (221)
Adolf Muschg, der in seiner Kindheit so etwas wie eine „Gottesvergiftung“ erleiden musste, hat im Alter zu einem neuen und befreiten Umgang mit dem Glauben gefunden. Man hat ihn als Prediger im Zürcher Großmünster eingeladen, darüber zu sprechen. Er hat den Weg zurück in seine Kirche gewählt, nicht resigniert, sondern aufrecht und unverbogen.
Er hat die christliche Mystik über den Umweg Japan entdeckt. Der Zen-Buddhismus wurde seine befreiende Kraft. Aufklärung und Mystik bilden für ihn keinen Widerspruch. Sie verhalten sich zueinander wie Einatmen und Ausatmen. Er ist sich seines eigenen Erbes bewusster geworden und in diesem Erbe auch seiner Freiheit.
Nicht mein Leben
„Darf ich mit dir in das Grab?“, so fragt Aki ihren Mann August Mormann. Damit sind Ton und Thema der Erzählung Nicht mein Leben gesetzt. Es geht um das Bedenken der Endlichkeit, nicht resignativ, sondern realistisch. Die Erzählung wird zu einem Einsammeln und Versammeln beider Leben mit dem Blick auf das Ende. Es geht aber auch die ständige Sorge mit: „shinanai“, d. h. stirb nicht oder besser stirb nicht ohne mich. Die Tradition des Noh-Theaters wird aufgerufen, das sie beide oft gemeinsam besucht haben. Der Dichter Zeami beschreibt darin zweierlei Blüten, die der Jugend und die am alten Stamm wachsende. Letztere gilt es nun in den Blick zu nehmen. Die Suche nach dem gemeinsamen Grab wird zur Begegnung mit früheren Bekannten, die schon gestorben sind. Besonders einer sticht ins Auge, von dem auch die Todesanzeige abgedruckt ist: Robin P. Marcus. Er hatte August zu Schulzeiten durch die Aufführung von Grillparzers Weh dem, der lügt die Augen dafür geöffnet, was Kunst vermag. Der Möglichkeitssinn brannte sich in seine Seele ein – für immer. Und nun wird es August möglich, auch seinen Tod zu imaginieren. Die größte Angst „stirb nicht ohne mich“ wird nun beschriebene Realität. Während Aki sich in einem entfernten Musiksaal zum ersten Mal zum Lied Morgenglanz der Ewigkeit auf dem Klavier begleitet, stirbt August inmitten all seiner kostbaren Erinnerungen – das Leuchten um ihn war zu stark. Wie im Noh-Theater, wo ein Mönch das Verschwinden von der Bühne als Erlösung von der Liebe durch die Liebe deutet, so erfährt August die volle Gegenwart des reinen MU. Dasein und Abwesenheit waren zu einem Ort der Vollendung geworden.
Ich kenne keine Erzählung in der Gegenwartsliteratur, in der das Sterben so eindringlich geschildert wird. Ich kann also versprechen: Das werden literarische Exerzitien heute Abend, eine literarische Revision du vie.