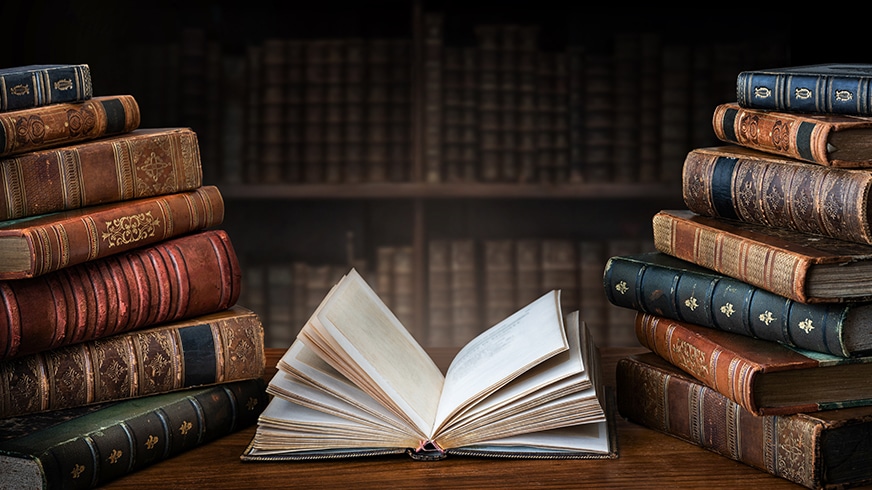Ich darf mich zunächst einmal für die Einladung ganz herzlich bedanken. Ich bin gerne hier, auch deswegen, weil ich die Katholische Akademie immer als einen Ort der Ruhe und der Reflexion empfinde. Das gibt die Gelegenheit, einmal grundsätzlich über ein paar Dinge nachzudenken, einen Schritt zurückzutreten und sich ein wenig mit der Rolle und der Bedeutung der Universität zu beschäftigen, losgelöst vom Tagesgeschäft. Es gibt ja dieses Bonmot: Alles, was dringend ist, ist nicht wirklich wichtig, und alles, was wirklich wichtig ist, ist nicht dringend. Das stimmt wahrscheinlich nicht immer, aber hat den wahren Kern, dass man, wenn man sich aus den Zwängen des Tagesgeschäfts einmal löst, vielleicht den einen oder anderen interessanten Punkt machen kann.
Folgendes will ich versuchen zu tun: Ich werde mich in meinen Ausführungen zunächst auf die Volluniversitäten beschränken. Damit meine ich den Typus Universität, wie ihn die LMU München verkörpert, oder auch die Universitäten Heidelberg oder Göttingen, und international beispielsweise Cambridge und Oxford. Universitäten, die, beginnend mit den Geisteswissenschaften, über Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und bis zur Medizin, den großen Teil aller Fächer überspannen – jedoch in Deutschland typischerweise ohne Ingenieurwissenschaften; international ist das teilweise anders. Ich will versuchen, für diese Universitäten ein wenig in die Zukunft zu schauen und zu sehen, welche Perspektiven sich ergeben. Gezielt außen vor lassen werde ich Fachhochschulen und Technische Universitäten ebenso wie Einzeluniversitäten oder hochspezialisierte Universitäten.
Lehre
Ich möchte auch nicht zu detailliert auf die LMU eingehen. Stattdessen werde ich mit zwei Entwicklungstrends beginnen – der eine betrifft die Lehre, der andere die Forschung –, die zeigen, wie sich das Universitäts- und Hochschulsystem in den letzten Jahren entwickelt hat. Zunächst fällt auf, dass die Universität, so wie wir sie heute kennen, ein relativ neues Phänomen ist. Hierzu gibt es eine sehr anschauliche Zahl: Nach einer Schätzung, die von Eric Hobsbawm stammt, gab es vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen maximal etwa 150.000 Studenten. Heute gibt es allein in München über 100.000 Studierende! In der Greater London Area sind sogar eine Million Studierende eingeschrieben. Wir beobachten also in den letzten 60, 70 Jahren eine unglaubliche Expansion des Hochschul- und Universitätssystems. Das ist an sich schon eine beispiellose Erfolgsgeschichte.
Die Idee der Universität hat sich weltweit in vielerlei Hinsicht entwickelt, und es ist keineswegs so, dass diese Entwicklung sich verlangsamt. In den letzten 25 Jahren scheint sie sich sogar weiter zu beschleunigen. Auch hier eine eindrucksvolle Zahl: Anfang, Mitte der 1990er Jahre gingen 20 Prozent eines Schulabgänger-Jahrgangs zum Studieren an eine Hochschule. Heute liegen wir in Deutschland bei mehr als 50 Prozent, und wenn Sie es global betrachten wollen, gibt es Schätzungen, dass es im Jahr 2040 etwa 500 Millionen Studierende weltweit geben wird. Man kann das für gut oder für falsch halten. Interessant ist aber die Frage nach den Ursachen: Wie kann man erklären, dass so viele junge Leute an die Hochschulen, an die Universitäten drängen? Ein Faktor ist sicherlich das persönliche Interesse, also das Interesse an der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Aber es ist letztendlich doch so, dass vor allem die Perspektiven für den eigenen Beruf, für die eigene Karriere determinieren, ob junge Leute ein Hochschulstudium aufnehmen. Und man muss sagen, die Perspektiven sind mit einem Hochschulstudium eben weiterhin ganz hervorragend.
In Deutschland wird das mitunter dann so übersetzt – wir sind ja immer ein bisschen defensiv oder pessimistisch –, dass ein Hochschulstudium der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit ist. In den USA wird die Frage etwas offensiver angegangen; dort gibt es Berechnungen, die versucht haben zu ermitteln: Was bringt mir eigentlich ein Hochschulstudium an zusätzlichen Einkommenschancen, an Arbeitsmarktchancen? Das wird in der sogenannten „college wage premium“ berechnet. Konkret: Was verdient man zusätzlich, wenn man einen Hochschulabschluss hat, im Vergleich zu einer Person, die keinen Hochschulabschluss hat? Legt man hier die üblichen Zahlen zugrunde, kommt man zu dem Ergebnis, dass in den USA – die Zahlen in Europa und in Deutschland unterscheiden sich nur unwesentlich –, diese „college wage premium“ bei 70 oder 80 Prozent liegt. Wohlgemerkt nicht individuell; das ist keine individuelle Erfolgsgarantie. Aber im Schnitt verdient man 70 bis 80 Prozent mehr als eine Person ohne Hochschulabschluss.
Jetzt werden Sie sagen, das hört sich doch schon mal gar nicht schlecht an. Trotzdem muss man vorsichtig sein; denn es variiert von Fach zu Fach. Leider sieht es in machen klassischen Geisteswissenschaften mit der „college wage premium“ nicht ganz so toll aus wie beispielsweise bei Ingenieuren oder Ärztinnen. Außerdem beobachtet man auch erhebliche Schwankungen der „college wage premium“; wir wissen also nicht, wie stabil diese Entwicklung in Zukunft bleibt. Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass diese Prämie sinken wird, dass – mit anderen Worten – in Zukunft ein Hochschulstudium wieder weniger attraktiv werden könnte.
Was heißt das für die Zukunft? Global werden sicherlich die Studierendenzahlen in den nächsten Jahren weiter wachsen. Dabei spielt Asien eine zentrale Rolle, während sich in Deutschland die Situation komplexer darstellt. Hier gibt es zwei Entwicklungstrends: Zum einen haben wir hierzulande aktuell einen Studierendenanteil von 50 Prozent aller Schulabgänger, also eine sehr hohe Akademikerquote. Es gibt andere Länder wie die Schweiz, wo weiterhin nur 20 oder 25 Prozent eines Jahrgangs an die Hochschulen gehen. Von daher spricht einiges dafür, dass in Deutschland die Zahl nicht ohne weiteres zu steigern ist, zumal es ja auch weiterhin nichtakademische Berufe gibt, die finanziell durchaus attraktiv sind. Denken Sie an Bauhandwerk wie Schreiner oder Installateure.
Auf der anderen Seite erleben wir den klaren Trend zur Akademisierung vieler Berufe. Auch in traditionellen Handwerksberufen oder Pflegeberufen gibt es den Wunsch nach einer akademischen Ausbildung. Das betrifft natürlich vorrangig die Fachhochschulen. In der Summe kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich bei uns die beschriebene Wachstumsentwicklung, die wir in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, etwas abflachen wird und damit auch Raum geschaffen wird, um zum Beispiel – und das ist für uns in Deutschland interessant – auch hochqualifizierte ausländische Studierende nach Deutschland zu holen.
Was sind eigentlich die Konsequenzen aus diesen hohen Studierendenzahlen? Ein Aspekt ist – und das ist wirklich nicht neu –, dass die Hochschulen überlastet sind. Dabei muss man ehrlicherweise konzedieren, dass die Überlastung in einigen Fächern massiv, in anderen weniger ausgeprägt ist. Lassen Sie mich auf einen zweiten Aspekt eingehen, der in Zukunft an Bedeutung zunehmen wird: Die heutige Studierendenschaft ist viel bunter und vielfältiger, als es früher der Fall war. An der LMU sind 20 Prozent der Studierenden aus dem Ausland. Weiterhin haben nach Schätzungen zehn Prozent der Studierenden eine chronische Erkrankung. Letzteres stellt auch die Problematik des barrierefreien Studiums in den Raum. Auf all das muss sich die Universität als Institution einstellen. Das war vor 20 Jahren noch kaum ein Thema; heute ist ein barrierefreier Hörsaal, den man auch mit einem Rollstuhl besuchen kann, selbstverständlich. Wenn sich eine Institution öffnet, wie wir es an den Hochschulen getan haben, kommen natürlich auch alle Fragen, alle Probleme der Gesellschaft bei uns an der Universität an, mit unterschiedlichsten Diskussionen, Anfragen, Forderungen oder Wünschen.
Das sehen Sie in den USA noch deutlicher als hier. Dort findet derzeit eine große Diskussion um die Frage von Minderheitsrechten versus akademischer oder Wissenschafts- und Meinungsfreiheit statt. Diskussionen über „no-platforming“ oder „trigger warnings“ beschäftigen dort viele Hochschulpräsidenten. In Berkeley schlug sich beispielsweise die Debatte, ob man Veranstaltungen von weit rechts stehenden Studierendenorganisationen an der Universität zulassen müsse, neben vielen Diskussionen direkt auch in Gerichtsprozessen nieder. In Deutschland gibt es im Gegensatz zu den USA selten die typische Campus-Universität, daher sind diese politischen Phänomene bei uns weniger ausgeprägt. Ich persönlich bin optimistischer und glaube, dass die Chancen, die wir durch so viele unterschiedliche, heterogene, diverse junge Leute bei uns an den Hochschulen gewinnen, deutlich höher zu bewerten sind als mögliche Risiken. Wir öffnen uns für Teile der Gesellschaft, die bisher überhaupt keinen Zugang zu Hochschulen hatten, und darin liegt für uns als Gesellschaft, als Land eine große Chance.
Forschung
Lassen Sie mich jetzt ein paar Worte zum Thema Forschung sagen, wo wir eine ähnliche Expansion beobachten. Ich mache das wieder an ein paar Zahlen deutlich: In den 1950er Jahren wurden in den Naturwissenschaften und der Medizin jährlich 50.000 Artikel veröffentlicht. Heute liegen wir bei 1,5 Millionen – anderthalb Millionen Artikel werden im Bereich Naturwissenschaften und Medizin jedes Jahr veröffentlicht, weltweit. Auch diese Entwicklung hat sich unterdessen noch einmal beschleunigt. Wir zählten um das Jahr 2000 noch 800.000 Publikationen jährlich. Diese Zahl an Publikationen hat sich also allein in den letzten 15 Jahren noch einmal fast verdoppelt.
Was sind die Gründe dafür? Ein Grund ist, dass Forschung in den Naturwissenschaften, in der Medizin, Grundlagenforschung insbesondere, einer der Treiber für Innovation ist. Forschung eröffnet Chancen und hält für viele „great challenges“ unserer Zeit – zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Nahrung – Antworten bereit. Investition in die Grundlagenforschung ist auch immer mit der Hoffnung verbunden, damit auf Dauer – neben der wissenschaftlichen Erkenntnis – auch Innovationen zu generieren, die in der Medizin und in vielen anderen Bereichen dann zu konkreten gesellschaftlichen Fortschritten führen. Es ist zum Zweiten natürlich auch ein Spiegelbild des Wachstums der Universitäten. Wie ich vorhin gezeigt habe, sind die Universitäten in den vergangenen 60 Jahren enorm gewachsen. Überall sind zusätzliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingestellt worden, die neben der Lehre – ganz nach Humboldt – natürlich auch Forschung betreiben. Insoweit ist das ein Wachstum, das parallel zu dem der Universitäten verläuft.
Hinzu kommt, und das erklärt den Anstieg seit etwa 2000, die Rolle asiatischer Länder: dort passiert im Moment ein unglaublicher Aufholprozess, mit dem Asien seine Rolle als Wissenschaftsstandort zunehmend stärker geltend macht. Auch hierzu ein Zahlenbeleg: Mittlerweile werden in China mehr wissenschaftliche Papiere jährlich veröffentlicht als in den USA. China und andere asiatische Länder artikulieren ihre Rolle in der Wissenschaft deutlich. Das ist eine außerordentlich spannende Entwicklung, die auch in Zukunft noch weitergehen wird, mit der Konsequenz, dass das Wissenschaftssystem weltweit weiter wächst.
Kann man also den Publikationsoutput von 1,5 Millionen Veröffentlichungen pro Jahr noch weiter steigern? Man sollte sich zumindest vergegenwärtigen, dass damit auch Qualitätsprobleme verbunden sind. Im Englischen wird die Problematik unter dem Bild des „death of the Renaissance man“ zusammengefasst. Damit wird verbildlicht, wie immer mehr in Teams zusammengearbeitet wird und wie sich der einzelne Wissenschaftler immer weiter spezialisiert. Die beschriebenen Phänomene bringen neue Herausforderungen mit sich, mit denen sich die Universitäten auseinandersetzen müssen. Man muss sich fragen: Sind nicht manche Themen irgendwann einmal ausgeforscht? Gibt es nicht auch Fragen, die wir am Ende nicht beantworten können?
Hierzu ein Beispiel aus der Ökonomie, das den Zusammenhang zwischen Quantität und Qualität von Forschung und die möglichen Grenzen zeigt. Es geht um die Relation von Ersparnis und Zins. Also: Was passiert, wenn der Zins einmal nicht fällt, sondern steigt? Wie reagieren die Menschen: Sparen sie mehr oder sparen sie weniger? Es gibt Argumente für beide Seiten. Theoretisch ist der Zusammenhang unklar, und es ist auch schon lange bekannt, dass der Zusammenhang unklar ist. Er wird seit 50 Jahren in unzähligen empirischen Studien untersucht. Vor einiger Zeit erschien in einem sehr schönen Handbuch ein Artikel von einem wirklich hervorragenden finanzwissenschaftlichen Kollegen aus den USA, der feststellte, dass es unzählige Untersuchungen gebe, und wenn er diese alle zusammenfassen müsse, käme er zu dem Schluss: Die Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Nach 50 Jahren also weiterhin: „more research is needed“, es braucht noch mehr Forschung. An dieser Stelle könnte man sich stattdessen vielleicht auch fragen: Ist das tatsächlich sinnvoll und zielführend, hier weiter zu forschen?
Fest steht, dass wir hohe Studierendenzahlen haben, die wahrscheinlich weltweit noch weiter wachsen werden. In Deutschland wird sich wohl künftig diese Entwicklung, zumindest an den Universitäten, etwas abflachen. Es wird dann vielleicht die Möglichkeit geben, mehr internationale Studierende an die deutschen Universitäten zu holen. Auch im Bereich der Forschung sind Deutschland und die gesamte EU weiterhin hervorragend aufgestellt; wir spüren aber auch die Konkurrenz aus Asien. Das ist also aktuell der Rahmen – und nun zur Frage: Was heißt das für die Volluniversitäten, über die wir ja sprechen wollen?
Folgerungen
Dabei könnte man die verschiedensten Fragestellungen diskutieren. Ich will ganz bewusst nicht auf die Frage eingehen, was Digitalisierung für die Volluniversität bedeutet. Ich lasse auch andere Themen wie Internationalisierung und ihre Konsequenzen für die Volluniversität beiseite. Vielmehr frage ich vor dem Kontext des rasanten Wachstums der Universitäten in den letzten 50 bis 60 Jahren, was das Studium, was die Lehre, was die Studierendenzahlen und was auch die Forschung betrifft: Was ist die Zukunft der Volluniversitäten?
Wird es eigentlich bei der Volluniversität klassischen Typs bleiben? Wird dieses Modell, mit einem großen Verband an Fächern, mit den vier großen Fächergruppen Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin, zusammengespannt in einer Einrichtung auch in Zukunft noch funktionieren? Das kann man durchaus kritisch sehen. In einigen Ländern wurde die Medizin in sogenannten medizinischen Hochschulen, also in spezialisierten Universitäten zusammengefast. Und es gibt hervorragende medizinische Hochschulen, wie etwa das Karolinska-Institut in Schweden. Es gibt auch sehr bekannte und renommierte Business Schools, z.B. die London Business School oder die London School of Economics. Spezialisierte Institutionen können also auch sinnvoll sein. Auch hierzulande gibt es immer wieder Initiativen, neue spezialisierte Universitäten oder Hochschulen einzurichten. Jüngstes Beispiel ist der Plan der bayerischen Staatsregierung, in Nürnberg eine sehr profilscharfe Technische Universität neu einzurichten. Es existieren durchaus andere sinnvolle Entwicklungsmodelle – auch neben der Volluniversität.
Was ist also der entscheidende Vorteil der Volluniversität? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber ich sehe bei der Volluniversität mehrere Vorteile. Da ist zum einen eine diversifizierte Fächerstruktur. Wenn sich etwas ändert, sei es in der Wissenschaft oder in der Studierendennachfrage, kann eine Volluniversität relativ leicht darauf reagieren. Sie ermöglicht es zudem, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, was in vielen Fächern an Bedeutung gewinnt. Naturwissenschaften, Medizin, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, da eröffnen sich viele Möglichkeiten. Und dann bietet die Volluniversität natürlich das, was Kant den Streit der Fakultäten nannte, der eine Universität einfach belebt und als Institution in vielerlei Hinsicht fruchtbar macht. Ich würde vielleicht eher vom Wettbewerb der Fakultäten sprechen. Ich halte insgesamt die Vorteile, die eine Volluniversität gegenüber einer spezialisierten Institution hat, für so groß, dass ich davon ausgehe, dass die Volluniversität auch in Zukunft ein Erfolgsmodell bleiben wird.
Ein deutlicher Hinweis darauf zeigt sich aktuell in Frankreich. In Deutschland wird das nicht so stark wahrgenommen, aber in unserem Nachbarland findet in gewisser Weise eine Revolution in der Hochschul- und Universitätsszene statt. Frankreich hatte traditionell sehr spezialisierte Universitäten. Sie sind in der Folge von 1968 entstanden – unter anderem deshalb, um die Studentenproteste zu kanalisieren. Nun wurde vor einigen Jahren den Universitäten die Möglichkeit geboten, wieder zusammenzuarbeiten und sich zusammenzuschließen. Was ist passiert? Ich habe das in Paris in einem Fall begleitet. Da ist quasi eine neue Sorbonne entstanden: Aus dem Zusammenschluss der Geisteswissenschaften an der früheren mit der Medizin und den Naturwissenschaften wird wieder eine klassische Volluniversität. Ein ähnliches Konstrukt hat zur neuen, größeren Université de Strasbourg geführt. Die Tatsache, dass die Institutionen diesen Schritt proaktiv gehen, zeigt, wie produktiv diese Idee ist. Es wurde der Wunsch umgesetzt, die wissenschaftliche Zukunft für diese Institution gemeinsam zu gestalten. Insoweit ist die Volluniversität immer noch das Erfolgsmodell für die Zukunft.
Aber wie wird die Volluniversität in Zukunft im Einzelnen aussehen? Da sind viele Punkte offen. Ich habe bei Weitem nicht auf jede Frage eine Antwort. Wir könnten dazu erneut ganz unterschiedliche „approaches“ diskutieren. Ich will drei Beispiele geben: Wenn Sie sich die Organisationsstruktur einer Universität ansehen, die „governance“, wie man neudeutsch sagt, dann gibt es in der öffentlichen Diskussion sehr polarisierte Positionen. Auf der einen Seite die beispielsweise an der TU Berlin immer wieder diskutierte Drittel- oder gar Viertelparität in den akademischen Gremien. Auf der anderen Seite gibt es das Modell der unternehmerischen Universität, einer Universität also, die sich in ihrer Organisation an einem Unternehmen orientiert, und selbstverständlich gibt es unzählige Zwischenformen zwischen diesen beiden Visionen. Daran zeigt sich, dass die Vorstellung davon, wie eine Universität organisiert werden soll, wie ihre Verfassung aussehen soll, sehr unterschiedlich ist.
Neben politischen Hintergründen hat dies vor allem auch etwas damit zu tun, dass grundsätzlich nicht eindeutig geklärt ist, was man von den Universitäten erwartet. Die Auffassungen darüber, welche Aufgaben die Universitäten übernehmen sollen, gehen sehr weit auseinander. Eine Gruppe wirbt dafür, dass vor allen Dingen die beiden Kernaufgaben einer Universität, nämlich Forschung und Lehre, bedient werden. Eine andere Philosophie sieht die Universität als eine allgemeine Beglückungsanstalt, die eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen hat. Ich selbst bin eher sehr zurückhaltend, zu viele Aufgaben bei einer Universität abzuladen.
Daneben wird eine große Diskussion darüber geführt, wie autonom die Hochschulen eigentlich sein sollen. Das ist eine Frage, die vor allen Dingen die staatlichen Hochschulen betrifft. Wir haben ja in den letzten 25 Jahren einen enormen Autonomiezuwachs an den Hochschulen gesehen, was ich am Beispiel der LMU deutlich machen will. Früher hat faktisch das Wissenschaftsministerium neue Professorinnen und Professoren berufen, und der Minister hat jeden Ruf unterschrieben. Heute entscheidet die Universität autonom über Berufungen; das Berufungsrecht liegt direkt bei der Universität. Und es gab noch viele weitere Änderungen, die die Autonomie gestärkt haben. Auch dieser Prozess ist nicht unumstritten; es gibt durchaus auch Befürworter einer stärkeren Regulierung der Universitäten.
Ich sehe in der hier herrschenden Meinungsvielfalt kein Problem, warne aber vor der Antwort: Lasst uns doch einen goldenen Mittelweg gehen, machen wir von allem ein bisschen. Das halte ich für ein Zeichen von Denkfaulheit und in manchen Punkten für falsch. Was die Aufgabendefinition für die Universitäten angeht, bin ich eher Purist und würde immer argumentieren, man solle sich auf Forschung und Lehre konzentrieren.
Wenn man definiert, was eine Universität tun soll, was ihre Aufgaben sind, muss aber auch explizit dargestellt sein, was sie nicht tun soll. Man erlebt eine Art Verantwortungsverschiebung. Beispielsweise wurde das Thema Weiterbildung und viele andere Themen nach und nach, teilweise direkt per Gesetz, den Universitäten zugeschrieben. Das fand ich immer sehr gefährlich, und deswegen bin ich der Meinung, dass die Universitäten hier im eigenen Interesse sehr vorsichtig sein müssen. Die ganze Aufgabenpalette klingt wirklich gut: Technologietransfer, Patentierungen – alles Aufgaben der Universitäten. Man muss aber die Aufgaben auch erfüllen und wird letztlich an der Erfüllung dieser Aufgaben gemessen.
Ich glaube, dass die angesprochenen Fragen alle lösbar sind, und dass das Modell der Volluniversität wirklich Zukunft hat. Wenn es uns gelingt, diese Fragen für unsere Institution jeweils richtig zu beantworten, dann können Sie das, was ich Ihnen heute sagen wollte, folgendermaßen zusammenfassen: Wenn Sie die Zahlen, die ich Ihnen vorhin genannt habe, nochmal Revue passieren lassen, sehen Sie, dass die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts das Jahrhundert der Universitäten war, sicherlich auch das Jahrhundert der Volluniversitäten, trotz oder vielleicht sogar wegen dieses enormen Zuwachses. Und wenn wir es klug anstellen, dann wird das 21. Jahrhundert auch wieder ein Jahrhundert der Universitäten werden.