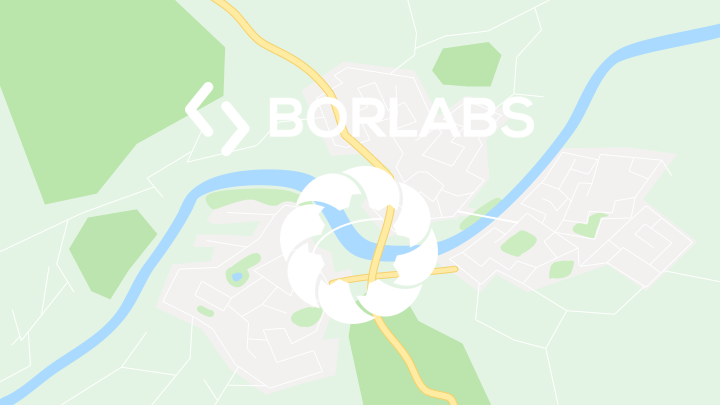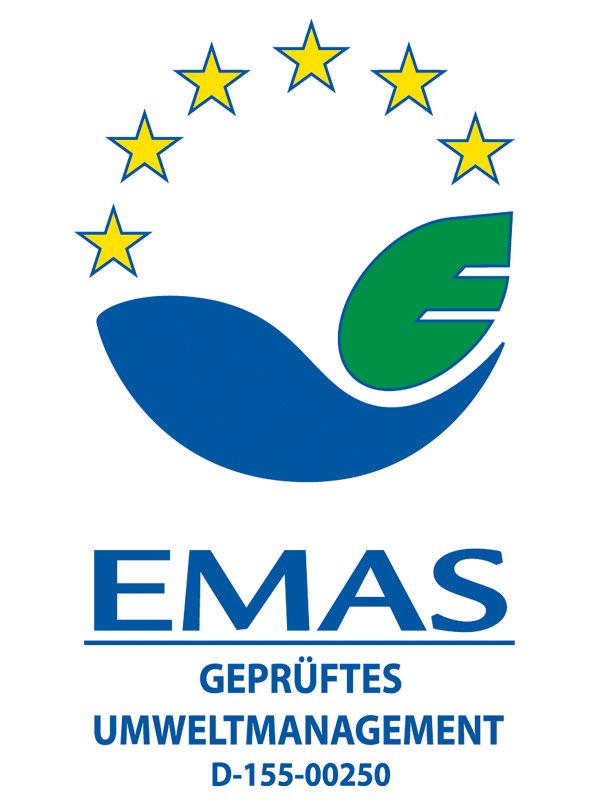Die Fragestellung
Niemand wurde von Jesus zur Nachfolge gedrängt – genau deshalb hat er eine ganze Reihe von Männern und Frauen für das Evangelium begeistert. Niemand wurde von den Aposteln für den Dienst in der Kirche zwangsverpflichtet – genau deshalb haben sich die frühen Gemeinden gegründet. Niemand wurde von den ersten Christinnen und Christen in ein geschlossenes kirchliches Milieu gepresst – genau deshalb hat sich eine Kirche gebildet, die klein angefangen hat, aber groß herausgekommen ist.
Paulus hat wie kein anderer die Freiheit des Glaubens betont und damit die tiefe Erfahrung reflektiert, dass sich das Glück des Lebens inmitten sozialer Schande finden und dass sich die Liebe zu Gott mit der Liebe zum Nächsten verbinden lässt. Das Neue Testament verifiziert diese Option für die Freiheit. Die Evangelien beschreiben die Wege der Jüngerschaft, die in der Passion enden, um durch Jesus einen neuen Anfang zu finden. Die Apostelgeschichte schildert, mit welchen Hoffnungen sich die ersten Menschen auf den Weg gemacht haben, um Jesus zu bezeugen, und in welchen inneren Kämpfen sie entdecken konnten, dass Gott längst dort ist, wohin sie, mühsam genug, vorgedrungen sind. Die Briefe reflektieren die Gottesfrage mitten im Alltag der Welt und geben Antworten, die in jeder Generation kreativ neu entdeckt werden müssen. Die Johannesoffenbarung beschreibt die Katastrophe eines finalen Infernos, um den Glanz des himmlischen Jerusalems erstrahlen zu lassen, das allen Völkern dieser Erde einen paradiesischen Platz bietet.
Diese Geschichten eines religiösen Aufbruchs sind in der Kirche wieder und wieder erzählt worden, um die (angebliche) kulturelle, moralische, spirituelle Überlegenheit des Christentums herauszustreichen: gegenüber dem Judentum, gegenüber den Römern wie den Griechen und von Generation zu Generation gegenüber jeder „Umwelt“.
Dieser Abwertung anderer entspricht innerkirchlich eine Stabilisierung herrschender Strukturen. Die Erinnerung an den Schwung des Anfangs dient dann dazu, die Kirche mit frischer Motivation, echter Begeisterung und neuer Energie zu versorgen, ohne die traditionellen Hierarchien in Frage zu stellen. Wer die neutestamentlichen Geschichten so erzählt, steht meist oben und beansprucht eine Deutungshoheit, die Anerkennung findet, weil die Geschichten so faszinieren, nicht die Erzähler.
Die biblischen Glaubensgeschichten sind aber auch immer anders erzählt worden und sollten dann eine andere Wirkung haben: Sie sollten Autoritäten und Hierarchien in Frage stellen; sie sollten die Fixierung auf Strukturen auflösen; sie sollten zeigen, dass es echte Alternativen zum Status quo gibt. In dieser Haltung werden sie meistens von unten erzählt – von denen, die an der Basis die Wirkung der bisherigen Entwicklung spüren und mehr wollen: mehr Kirche, mehr Glaube, mehr Freiheit.
In der gegenwärtigen Krise ist der erste Erzähltyp obsolet, der zweite hingegen brisant. Die aktuelle Debatte über die notwendige Strukturreform der katholischen Kirche dreht sich um Machtfragen, um Beteiligungsrechte, um Transparenz und Kontrolle. Diese Debatte ist notwendig. Sie hat jedoch eine entscheidende Voraussetzung: dass Menschen überhaupt bereit sind, sich in die Kirche einzubringen und dort mitmachen, mitreden und selbstverständlich auch mitbestimmen zu wollen. Diese Voraussetzung ist aber alles andere als selbstverständlich. Die Reformen würden umsonst sein, wenn es nicht Menschen gäbe, die sich an der Kirche reiben, mit der Kirche solidarisieren und in der Kirche engagieren. Wie aber kann es gelingen, Leute von heute für die Kirche zu interessieren, so dass sie sogar Verantwortung in ihr zu übernehmen bereit sind? Besser gefragt: Was erwarten Menschen von der Kirche, so dass sie sich einbringen wollen? Welche Charismen und Kompetenzen bringen sie mit? Welche hoffen sie in der Kirche zu entwickeln? Welche Strukturen müssen geschaffen werden, damit die Freiheit des Glaubens ihren Platz erhält?
Diese Fragen aufzuwerfen, liegt in der Perspektive der neutestamentlichen Geschichten selbst. Sie stellen Gott und den Glauben der Menschen in den Mittelpunkt. Sie verachten Organisationen und Hierarchien in keiner Weise, sondern bilden sie aus, um dem Wort Gottes dauerhaft und vielerorts Gehör zu verschaffen. Das Urchristentum ist kein rechtsfreier Raum. Von Anfang an gibt es Dienste und Ämter, wenngleich nicht nach Schema F. Von Anfang an wird auch die kirchliche Hierarchie aufgebaut: freilich in der biblisch einzig begründbaren Bestimmung des Begriffs, dass Jesus Christus auch in der Struktur und Organisation als Herr der Kirche zur Wirkung kommt. Deshalb ist der Nachfolgeruf Jesu wesentlich, deshalb der Dienst der Apostel, deshalb auch die Gestaltung der apostolischen Nachfolge.
Die Exegese kann ihr Ziel nicht darin sehen, die spätere Entwicklung zum dreigegliederten Amt entweder bereits ins Neue Testament zu projizieren oder als historischen Fehler zu demaskieren, weil sie nicht biblisch sei. Beides wäre anachronistisch. Die Exegese kann aber das ekklesiologische Potential ermessen, das genutzt worden ist, und ebenso dasjenige, das bislang ungenutzt geblieben ist. Sie kann rekonstruieren, in welcher kirchlichen Gemeinschaft und in welcher Phase der Kirchengeschichte welche biblischen Traditionen aufgenommen worden sind und welche nicht, auch in der Ekklesiologie.
Es reicht allerdings nicht, wenn die Exegese aufweist, welche kirchlichen Strukturen es im Urchristentum bereits gegeben hat und welche nicht. Es ist auch schwierig, im Neuen Testament Modelle für Gemeindebildung und Kirchenleitung auszumachen, an denen man sich bei der heutigen Kirchenreform orientieren könnte. Denn die ganze Welt hat sich geändert, die Kirche auch. Bislang gab es in der Geschichte der Kirche keine Reform, die nicht am Neuen Testament Maß genommen, und keine, die das Neue Testament kopiert hätte. Die Exegese muss zu zeigen versuchen, unter welchen Bedingungen von welchen Positionen aus welche Perspektiven der Kirche geöffnet worden sind, die es wiederum erlauben, jeweils neue Standortanalysen vorzunehmen, die realistische Zukunftsszenarien entwickeln lassen, um dem Glauben einen Ort zu bereiten, an dem er sich personal wie ekklesial zu entwickeln vermag.
Eine wichtige Voraussetzung ist die historische Einordnung theologischer Geltungsansprüche, die für die neutestamentlichen Texte typisch sind. Ohne diese Ansprüche hätte es keine Mission, keine Bewegung, kein Wachstum gegeben. Mit ihnen verantwortlich umzugehen, ist ebenso schwierig wie nötig. Damit sie theologisch fruchtbar werden, bedürfen sie einer religionswissenschaftlichen und sozialgeschichtlichen Analyse. Auf diese Weise wird an der Heiligen Schrift selbst die Fähigkeit trainiert, zwischen Tradition und Traditionalismus zu unterscheiden. Wenn diese Differenzierung gelingt, werden neue Lösungen möglich, die ebenso schrift- wie zeitgemäß sind, ohne dass die bisherige Überlieferung verachtet oder vergessen würde. Die Geschichte der Kirche ist von dieser Kreativität geprägt. Ausgerechnet in der Neuzeit wird sie römisch domestiziert. Auch in der neutestamentlichen Ekklesiologie vermischen sich die Ambitionen des religiösen Aufbruchs mit den Konventionen traditioneller Gesellschaften, z.B. in den Geschlechterrollen.
Diese Korrelationen sind nicht nur unvermeidlich, sondern auch im Ansatz legitim, weil die Kirche kein utopisches Gebilde ist, sondern immer vor Ort präsent ist, mitten im Leben, bestenfalls als Avantgarde an der Peripherie. Wie aber ist das eine, der genuine Impuls, vom anderen, der kulturellen Einbettung, zu unterscheiden? In der lehramtlichen Rezeption wird diese Differenzierungsleistung bislang nicht erbracht. Deshalb segeln paternalistische Stereotype unter der Flagge des Evangeliums Jesu Christi. Es sind erst die modernen Gesellschaften mit neuen Rollenbildern und Familienstrukturen, in denen die Geltungsfrage aufbricht und differenziert beantwortet werden kann.
Theologisch entscheidend ist die Frage, wie der verantwortliche Dienst in der Kirche mit der Freiheit des Glaubens einhergeht, der zum Aufbruch der Kirche geführt hat und in der Kirche aller Zeiten neu vergegenwärtigt werden muss. Das Neue Testament verweist auf die Berufung durch Jesus, auf die Begabung durch den Heiligen Geist und in beidem auf die Bestimmung durch Gott – als Begründung menschlicher Freiheit in der Erfahrung des Glaubens.
Berufung und Bevollmächtigung
In allen Evangelien wird erzählt, dass Jesus von Anfang an nicht allein sein wollte, sondern Menschen in seine Nachfolge gerufen hat (Mk 1,16-20 parr.; 2,13-14 parr.; Joh 1,35-51). Die Erzählungen sind in hohem Maße stilisiert. Sie erlauben weder ein Psychogramm von Berufungen noch eine soziologische Studie über den Beginn kirchlicher Karrieren. Sie verdichten und veranschaulichen vielmehr theologische Grundüberzeugungen, die sich in der reflektierten Erinnerung an das Wirken Jesu gebildet haben. Das entscheidende Wort hat immer Jesus selbst. Markus und Matthäus schreiben in archaischer Einfachheit. Er kommt – er sieht – er ruft. Dieser Ruf ist eine Berufung, die Berufung ist eine Verheißung, die Verheißung wird zu einem neuen Beruf: Aus Fischern wird Jesus Menschenfischer machen. Bei Lukas wird diese Profession ins Bild gesetzt, wenn Jesus diejenigen, die er schon als seine Jünger ausersehen hat, Simon und ein paar andere, auffordert, in See zu stechen und die Netze auszuwerfen, die wider Erwarten bis zum Bersten gefüllt sein werden; bei Lukas erkennt Simon auch sofort seine eigene Unfähigkeit, die er als Sünder bekennt, ohne dass Jesus von ihm ablässt, seine Sendung mit ihm zu beginnen (Lk 5,1-11). Bei Johannes schickt der Täufer die ersten Jünger zu Jesus – die dann von ihm selbst eingeladen werden, ihn und seine Welt und seinen Gott zu entdecken: „Kommt und seht“ (Joh 1,39).
Die Berufung in die Nachfolge hat eine doppelte Pointe. Zum einen qualifiziert sie den Glauben, an dem die Beziehung zu Jesus hängt. Nachfolge ist bei Markus eine qualifizierte Form des Glaubens an das Evangelium, den Jesus fordert. Basal ist sie dadurch gekennzeichnet, dass Jesus vorangeht und die Jünger folgen. Es kann weder zu einem Rollentausch noch zu einer Ablösung kommen, weil Jesus nicht nur ein Lehrer und Prophet, sondern der Messias ist – erkennt der Glaube. In der Kirche, der nachösterlichen Jüngerschaft, gibt es einen einzigen Primat, der seinen Namen verdient; das ist der Primat dessen, der seinen Jüngern nach Jerusalem vorangeht (Mk 10,32) und nicht gekommen ist, bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele (Mk 10,45).
Dieser Primat Jesu entlastet und verpflichtet die Jünger: Sie werden nie in der Rolle Jesu sein; sie dürfen nie die Menschen, die Gott Glauben schenken wollen, an sich selbst binden; sie dürfen sich nie zwischen Gott und die Menschen drängen – werden es aber noch und noch tun, wie die Evangelien in vielen plastischen Szenen vor Augen stellen. Desto wichtiger ist die Ausbildung einer kirchlichen Organisation, die den Primat Jesu – wenn nicht garantiert, so doch – strukturiert. Rhetorisch ist dies in der römisch-katholischen Kirche bestens geregelt. Der Papst, als vicarius Christi gesehen, scheint genau diese Rolle zu spielen. Aber wenn der Stellvertreter alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird es nicht leicht, die Rolle zu erkennen. Praktisch schlägt das Zeugnis für Christus strukturell in Herrschaftswissen um.
Zum anderen ist die Berufung eine Bevollmächtigung. Die Jünger müssen können, was sie sollen. Jesus befähigt sie. Die synoptischen Evangelien verfolgen die Spur der Berufung weiter, wenn sie von der Einsetzung des Zwölferkreises erzählen und dessen Sinn – Markus sei zitiert – wie folgt bestimmen: „damit sie mit ihm seien und er sie aussende, zu verkünden und Macht zu haben, Dämonen auszureiben“ (Mk 3,14). Die Exorzismen sind erwähnt, weil sie, in der Welt der damaligen Zeit, das Schwerste sind, was es zu leisten gilt, wenn Menschen befreit werden, wieder sie selbst zu sein und ihr eigenes Leben zu gestalten, einschließlich der Suche nach Gott. Diese Machttaten sind wie die Spitze eines Eisbergs, der von der Bevollmächtigung zur Verkündigung getragen ist, in Worten und Taten nichts Anderes zu besagen und zu bewirken als das, was Jesus besagt und bewirkt hat: die Nähe des Reiches Gottes offenbar werden zu lassen.
Dies können die Jünger nie und nimmer aus eigener Kraft, sondern nur in der Kraft Jesu selbst. Aber in ihr sollen sie es können, weil er durch sie den Radius seines Wirkens verbreiten will. So heißt es auch in der später folgenden Aussendung der Zwölf: Er „gab ihnen Macht über die unreinen Geister“ (Mk 6,7). Diese Linie ist exegetisch, ekklesiologisch und kanonistisch im Blick darauf ausgezogen worden, welche Macht durch Jesus den Nachfolgern
Jesu zukommt, welche Rechte sie haben und welche Freiheit sie genießen.
Tatsächlich ist ohne die Übertragung von Macht und Recht das Evangelium nicht in Wort und Tat zu verkünden und zu vergegenwärtigen: Sünden zu vergeben, böse Geister zu vertreiben, die Nähe Gottes zuzusprechen. Es bedarf auch einer Freiheit des Amtes, diese Macht auszuüben und dieses Recht wahrzunehmen. Aber die entscheidende Perspektive darf bei dieser Auslegung nicht verlorengehen: Bei der Bevollmächtigung und Aussendung geht es nicht darum, einen privilegierten Status der Jünger zu begründen, sondern darum, den Menschen, die mit dem Evangelium in Kontakt kommen sollen, nicht ein zweitklassiges, sondern ein erstklassiges Angebot zu machen: die volle Kraft der Vergebung und der Erneuerung, das ganze Wort Gottes, die Fülle der Gnade.
Die Jünger müssen mit der ganzen Vollmacht Jesu ausgestattet sein, um den Menschen, zu denen sie gesandt sind, diesen Dienst leisten zu können. Der diakonische Zug ist prägend. Die Jünger sind nicht um ihrer selbst willen, sondern um Gottes und der Menschen willen mit der Vollmacht, den Rechten und den Freiheiten ausgestattet, die um der kraftvollen Verkündigung willen notwendig sind. Sie brauchen sie, weil sie selbst schwach sind und über die notwendige Kraft unmöglich selbst verfügen können. Sie müssen sie deshalb auch nicht um ihrer selbst willen gebrauchen, sondern um derer willen, die ihren eigenen Zugang zum Reich Gottes finden sollen. Theoretisch ist wiederum in der katholischen Kirche alles klar. Der Papst nennt sich sogar servus servorum, Diener der Diener. Bescheidener geht es nicht, hochmütiger auch nicht. Die Dialektik der Demut wirft tiefe Schatten. Der Missbrauch geistlicher Macht hat in ihr eine seiner tiefsten Wurzeln.
Die Linie von der Berufung zur Bevollmächtigung und Aussendung verläuft nicht ungebrochen. Es gibt keine Automatik. Nachfolge setzt Glauben voraus. Glauben kann nur in Freiheit gelebt werden. In den Evangelien wird dieser Zusammenhang an zwei Schaltstellen deutlich. Die eine Position: Der Ruf in die Nachfolge kann abgelehnt werden. Dafür steht das traurige Beispiel des Reichen, bei Matthäus des reichen Jünglings. Er hat in seinem Leben alles richtiggemacht: Er hat die Gebote Gottes erfüllt; er ist zu Jesus gekommen; er hat ihn gefragt, wie er das ewige Leben gewinnen kann. Aber er kann sich nicht von seinem Geld trennen, als Jesus ihn einlädt, seinen Besitz zu verkaufen und den Armen zu geben, um ihm nachzufolgen (Mk 10,17-22). So bedauerlich dieser Ausgang ist, so deutlich zeigt er die Freiheit der Nachfolge. Simon und Andreas, Johannes und Jakobus – sie alle hätten Nein sagen können, und Jesus hätte es akzeptiert. Sie haben Ja gesagt – und müssen ein Leben lang lernen, was diese Zustimmung bedeutet.
Die andere Schaltstelle: Zu den wichtigsten Lektionen in der Schule der Jüngerschaft gehört es, anzuerkennen, dass es nicht nur einen Weg der Nachfolge gibt und dass er nicht auf einer höheren Steilkurve zu einem besseren Platz im Reich Gottes führt, sondern dass es neben ihm, mit ihm, unterschieden von ihm andere Wege gibt, denselben Glauben in derselben Nähe Gottes und in derselben Anerkennung durch Jesus zu leben, auch wenn die Evangelien diesen Formen etwas weniger Aufmerksamkeit schenken. Aber die Indizien sind klar: Der eine will Jesus nachfolgen, wird aber angehalten, in seine Heimat zu gehen und dort das Evangelium zu verkünden (Mk 5,1-20); die andere kehrt in ihre Familie zurück, wo sie sich vor allem um ihr Kind kümmern will, das Jesus geheilt hat (Mk 7,24-30). Der eine wird in sein Haus geschickt (Mk 2,12), die andere soll im Frieden ihrer Wege gehen, ohne dass sie sich Jesus anschließen müsste (Mk 5,34). Der eine ist „nicht weit vom Reich Gottes“, weil Jesus und er im Doppelgebot übereinstimmen (Mk 12,29.34), die andere macht nicht viel Aufhebens um ihre Heilung und sorgt für Jesus als Gast des Hauses (Mk 1,29ff.). Den Jüngern, die einem fremden Wundertäter verbieten wollen, in Jesu Namen zu wirken, sagt Jesus: „Wer nicht gegen uns ist, ist für uns“ (Mk 9,40). Beim Gleichnis vom Weltgericht, dass Jesus nach Matthäus seinen Jüngern erzählt, wird das Bekenntnis zu Jesus an den Werken der Barmherzigkeit gemessen, die getan oder verweigert werden (Mt 25,31-46; vgl. Mk 9,41).
Die Bedeutung der expliziten Nachfolge wird durch diese Differenzierungen nicht kleiner, sondern größer. Es ist gerade die Berufung der Jünger, im Glauben zu bezeugen, dass es nicht nur die Formen der Gottesliebe und Nächstenliebe gibt, die sie realisieren, sondern auch andere. Es ist ihre Verpflichtung, andere Menschen nicht von sich abhängig zu machen, sondern ihnen die Nähe Gottes zu erschließen. Es ist ihre Sendung, die Geschichte und das Ziel ihrer Berufung und Bevollmächtigung transparent werden zu lassen: dass nämlich ihr Privileg ist, keines zu haben und auch keines reklamieren zu müssen, um wichtig zu sein.
Bestimmung und Befreiung
Die vorösterliche Grundstruktur der Jüngerschaft – Berufung und Beauftragung zur Bezeugung der Heilssendung Jesu – charakterisiert auch die österliche Grundstruktur, nur dass Jesus allen Jüngern ihr Versagen in der Passion vergeben muss, bevor er sie neu beruft und beauftragt. Eindrucksvoll verdichtet das Johannesevangelium in der nachgetragenen Offenbarungsszene am See Genezareth, dem Meer von Tiberias, diese Verbindung, wenn Jesus nach dem reichen Fischfang drei Mal Petrus fragt, ob er ihn liebe, so wie Petrus drei Mal Jesus verleugnet hat, und ihm auf dessen dreifache Liebesbeteuerung hin drei Mal sagt: „Weide meine Lämmer“, „weide meine Schafe“ (Joh 21,15-17). Als Hirte hütet er alles, aber dominiert nichts, wie ihm sogleich an der eigenen Geschichte des Lieblingsjüngers klargemacht werden wird (Joh 21,18-23).
Paulus hat seine Theologie der Freiheit aus einer Reflexion seiner Berufung gewonnen. Einerseits sieht er sie als göttliche Bestimmung. So schreibt er im Galaterbrief: „Als es aber Gott gefiel, der mich aus meiner Mutter Schoß erwählt und in seiner Gnade berufen hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn den Völkern verkünde, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel gewesen waren, sondern ging nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück“ (Gal 1,15-17).
Am Anfang steht die Erwählung. Gott ergreift nicht nur die Initiative im Moment der Berufung, sondern hat immer schon die gesamte Biographie des großen Außenseiters unter den Aposteln im Sinn. Genau diese Vorherbestimmung aber verschafft Paulus Freiheit. Er weiß sich nicht abhängig von der Zustimmung anderer, sondern begründet in seiner Berufung seine Unabhängigkeit selbst gegenüber den Jerusalemer Uraposteln – mit denen er aus freien Stücken intensiven Kontakt pflegt.
Den gegenläufigen Gedankengang entwickelt Paulus im Ersten Korintherbrief. Hier beginnt er mit der rhetorischen Frage: „Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, gesehen, unseren Herrn?“ (1Kor 9,1) – freilich nicht, um auf seinem Freiheitsrecht zu beharren, sondern um die Berufung als Grund für den Dienst zu sehen, den er leistet. Diese Diakonie verpflichtet ihn so sehr, dass er beteuert: „Wenn ich das Evangelium verkünde, ist es nicht mein Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir; denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde“ (1 Kor 9,16). Er fährt in einer Dialektik fort, die kaum jemand so wie Martin Luther in seiner „Freiheit eines Christenmenschen“ 1520 auf den Punkt gebracht hat: „Frei von allen, versklave ich mich allen selbst, um einige zu gewinnen“ (1 Kor 9,19). Die Freiheit des Apostels umschließt die Freiheit, auf sie zu verzichten, um anderen zu dienen. In dieser gebundenen Freiheit und in dieser freien Bindung will Paulus den Korinthern, besonders den „Starken“ ein Vorbild sein, dass zur christlichen Souveränität Rechtsverzicht gehören kann.
Warum aber kann die Bestimmung durch Gott Befreiung sein? Weil Paulus sich selbst, wie jeden anderen Menschen, als Geschöpf Gottes sieht, der durch Gottes Wort ins Leben gerufen wird: nicht nur biologisch, sondern auch personal, und weil Paulus sich als Sohn Gottes sieht, als Bruder Jesu, der in der Liebe Jesu sein Ich findet (Gal 2,19-20) – und darin nicht vereinsamt, sondern mit allen geschwisterlich verbunden ist, die getauft sind (Röm 6,3-4). Die Freiheit konkretisiert sich nicht nur in der Vergebung der Sünden, sondern in der Liebe zu Gott, im Glauben an Jesus, in der Inspiration durch den Heiligen Geist. In der Bestimmung zum Apostel öffnen sich Paulus weite Horizonte des Lebens, die sich ekklesial in der Bildung der einen Kirchen von Juden und Heiden zeigen. Im Glauben entstehen Schnittstellen von Himmel und Erde, die das Glück der Gnade spüren – und freilich im selben Moment Gott vermissen und ersehnen lassen, solange er nicht von Angesicht zu Angesicht geschaut werden kann: von allen, denen Gott sich offenbaren will, gleich welche Position sie innerhalb oder außerhalb der Kirche haben.
In der paulinischen Reflexion kommt eine Struktur zum Ausdruck, die auch für die Nachfolge gilt: Jesus nimmt in Dienst – und dadurch kommen die Jünger zu sich selbst. Sie gewinnen ihr Leben, indem sie es für Jesus und das Evangelium einsetzen (Mk 8,35). Sie erkennen, wie sie mit der Sonde des Doppelgebotes von Gottes- und Nächstenliebe das ganze Gesetz durchleuchten können, um es zu erfüllen (Mk 12,28-34 parr.). Sie lernen, mit eigenen Worten so zu beten, wie Jesus sie zu beten gelehrt hat. Sie erfahren die Nähe Gottes mitten im Leid; sie hoffen auf das ewige Leben, das jetzt schon beginnt. Berufung und Bevollmächtigung sind Bestimmung und Befreiung, oder sie sind nicht Berufung und Bevollmächtigung, sondern Verführung und Entmündigung.
Wie aber kann dieses paulinische Moment, dass göttliche Bestimmung persönliche Befreiung ist und göttliche Befreiung persönliche Bestimmung, in der kirchlichen Praxis der Berufung und Bevollmächtigung realisiert werden? Eine Antwort hat mindestens zwei Aspekte. Eine Dimension ist die Theozentrik: Gott ruft und beruft, durch Jesus. Dieser theozentrische Vorbehalt ist nicht nur gegenüber allen Herren dieser Welt, sondern auch gegenüber allen Bischöfen dieser Kirche geltend zu machen. Er schafft Freiheit – in der Bindung an Gott; sie spiegelt sich in der Anerkennung derer, die Gott beruft und bevollmächtigt, durch diejenigen, die zur Gemeinschaft der Kirche gehören, und insbesondere durch diejenigen, die sich ihrerseits berufen und bevollmächtigt wissen, die Kirche zu leiten.
Die Liturgie der Ordination öffnet dieser Freiheit einen Raum – wenn deutlich wird, dass die Handauflegung und das Gebet der Person, die ordiniert, in das Gebet und in die Prophetie der ganzen Kirche integriert sind, wie es sich die Pastoralbriefe einmal gedacht zu haben scheinen (1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6). Was heute fehlt, ist eine rechtliche Ordnung, die dieser Liturgie entspricht und nicht nur die episkopale Vollmacht, sondern auch den theozentrischen Vorbehalt und die gesamt-ekklesiale Einbettung organisiert.
Der andere Aspekt ist die Orientierung an den Menschen: sowohl in der diakonischen Orientierung jeden Amtes als auch in der intrinsischen Motivation, diesen Dienst zu leisten – nicht, weil man es soll, sondern weil man es will. Die einzige Motivationsquelle, die nicht versiegt, ist der Glaube, so angefochten er ist. Er verbindet diejenigen, die in der Kirche beauftragen und beauftragt sind. Niemand kann beauftragen, der nicht selbst beauftragt ist. Die Humanisierung der Amtstheologie ist die Kehrseite der Theozentrik.
Je deutlicher die Bestimmung durch Gott, desto größer die Freiheit; je größer die Befreiung, desto entschiedener die Bestimmung in der Vorsehung Gottes, ohne die es keinen universalen Heilswillen und keine Vollendung der Versöhnung gäbe. Psychologisch und mentalitätsgeschichtlich lassen sich Grade unterscheiden. Theologisch gibt es aber nur das volle Maß, mag es auch nicht gespürt werden.
Die Befreiung, die in der Bestimmung durch Gott für den Dienst in der Kirche liegt, ist so kreativ, wie Gott kreativ ist: Sie führt nicht zum status quo ante; sie löst auch nicht nur die Fesseln, die um der guten Ordnung halber nahezu allen angelegt werden müssen, die an sich dasselbe könnten, aber es nicht sollen, damit kein Chaos entsteht. Die Befreiung ist vielmehr, biblisch verstanden, die Antizipation der Vollendung, der Vorschein jenes Reiches der Freiheit, das im Modus der Verheißung Gegenwart sein kann. Umgekehrt ist die Bestimmung, als Befreiung verstanden, keineswegs etwa nur die Zuschreibung von Kompetenzen, sondern die Eröffnung eines Handlungsspielraumes im Interesse aller, die sich aus der offenen Zukunft und Gegenwart der Gottesherrschaft ergibt und auf diese Weise die diakonische Dimension mit Leben erfüllen kann.
Begabung und Beauftragung
Paulus selbst hat in seinen Briefen klare Vorstellungen, wie das Leben in den Gemeinden organisiert werden soll. Er selbst hat als Apostel seine Aufgabe darin gesehen, alles zu tun, damit auf dem Fundament, das er mit Jesus Christus selbst vor Ort gelegt hat, kräftig weitergebaut wird (1 Kor 3,10-17). Entscheidend sind für Paulus die Charismen: die geistgewirkten Kompetenzen, die von den Gläubigen in die Kirche mitgebracht oder in der Kirche entwickelt werden. Paulus unterscheidet sie nicht von „Ämtern“, wie es in der deutschen Ekklesiologie eingerissen ist, sondern identifiziert sie mit „Diensten“ und „Energien“ (1 Kor 12,4-6). Im Ersten Korintherbrief entwickelt Paulus eine Charismen-Ekklesiologie für eine von ihm selbst gegründete, (1 Kor 12-14), im Römerbrief für eine ihm persönlich unbekannte Gemeinde (Röm 12,6-8). Da er über die Lage in der Hauptstadt recht gut informiert ist, dürfte diese Adresse beweisen, dass Charismen zwar im paulinischen Missionsfeld besonders gut bezeugt, aber im Urchristentum als Phänomen und Konzept weit verbreitet und geradezu charakteristisch sind.
Die Charismen gibt es immer nur im Plural, weil niemand alles und niemand nichts mitbringt, mag jemand auch als „stark“ oder „schwach“ eingeschätzt werden. Jedes Charisma geht auf den einen Geist, den einen Kyrios, den einen Gott zurück, der „alles in allen wirkt“ (1 Kor 12,6). Der Unterschied der Charismen besteht nicht darin, dass sie mehr oder weniger Gnade realisieren, sondern darin, dass der Reichtum der menschlichen Ressourcen und die Fülle der gemeindlichen Aufgaben zu einander in Beziehung gesetzt werden. Paulus listet nicht vollständige Kataloge auf, sondern nennt signifikante Gnadengaben, die von der Martyrie über die Liturgie bis zur Diakonie die gesamte Bandbreite kirchlicher Aktivitäten erfassen. Die Leitungsaufgaben werden nicht hoch oben auf dem Podest platziert, sondern in längere Kataloge integriert. Besonders betont Paulus im Ersten Korintherbrief den Apostolat, die Prophetie und das Lehren (1 Kor 12,28): weil sie auf verschiedene Weise einen spezifischen Dienst am Wort leisten, von dem die Kirche lebt.
Das Kriterium, die Qualität eines Charismas zu ermessen, ist die Orientierung an der Stärkung anderer und am Aufbau der Kirche als ganzer (1 Kor 12,7), nicht etwa die Selbstdarstellung oder die Selbsterbauung. Im Blick auf den korinthischen Gottesdienst wird Paulus diese Orientierung am Vergleich von Prophetie und Glossolalie entwickeln (1 Kor 14) – besonders signifikant, wenn das Zungenreden aufgrund seines Enthusiasmus in der Gemeinde besonders geschätzt worden sein sollte, Paulus aber die Prophetie fördern wollte. Stärkung der anderen heißt: Anerkennung und Förderung ihrer spezifischen Charismen, Kooperation mit ihnen durch Selbstbegrenzung und Selbstverpflichtung auf den Gebrauch der eigenen Gaben.
Über die Apostel, Propheten und Lehrer – beiderlei Geschlechts – schreibt Paulus, Gott selbst habe sie in der Ekklesia eingesetzt (1 Kor 12,28). Die Berufung zum Apostolat, die Paulus an der eigenen Person reflektiert, aber auch bei den Zwölfen und Anderen analysiert (1 Kor 15,3-8), zeigt den Zusammenhang der Charismen mit der Berufung, der Bestimmung und Befreiung zum Dienst am Evangelium, der nicht exklusiv mit den Aposteln, sondern auch mit anderen Gläubigen verbunden ist, die wichtige Dienste in der Kirche übernehmen. Alle Gnadengaben werden von ein und demselben Gott selbst verliehen. Diese Quelle begründet die Unabhängigkeit vom Urteil anderer und ebenso wie die Freiheit, sich aus voller Überzeugung zu engagieren – und von anderen helfen zu lassen, wo es not- und guttut.
In 1 Kor 12,28-31 macht Paulus einen Unterschied zwischen den personalen Markierungen der Apostel, Propheten und Lehrer und den funktionalen der weiteren Charismen, die erwähnt werden. Aber der Unterschied ist nicht qualitativ. Immer sind es bestimmte Menschen, die ihre Aufgaben annehmen sollen und erfüllen können; immer sind es bestimmte Aufgaben, die nur Menschen sich zu eigen machen können.
Der Apostel ist es, der dieses Bild einer charismatischen Gemeinde entwirft, um die Kräfte zu stärken und zu bündeln, die Gott selbst in der Kirche durch Menschen entwickelt, die glauben und ihre spezifischen Talente nutzen. Charismen sind bei Paulus nicht spontane Eingebungen, die flüchtige Momente erfassen, sondern angenommene, reflektierte und nachhaltig genutzte Möglichkeiten, die Verantwortung begründen und Verpflichtungen schaffen.
In der nachapostolischen Zeit muss diese Konstellation zukunftsfest gemacht werden. Das Corpus Paulinum lässt zwei große Schritte entdecken.
Die erste Passage gestaltet der Epheserbrief. Die Apostel und Propheten sieht er als Fundament der Kirche, dessen Eckstein Jesus ist (Eph 2,20f.).
Auf diesem Fundament entwickeln sich alte Dienste neu und neue in der Nachfolge der alten. Evangelisten, Hirten und Lehrer werden eigens genannt, ihre Aufgabe ist es, alle Heiligen, die ganze Gemeinde, zu ertüchtigen, so dass sie mündig ihr eigenes Glaubensleben – in Verbindung mit den anderen Gläubigen – führen können (Eph 4,11-16). Das Wort Charisma kennt der Brief nicht; aber dass die Dienste, die das Wachstum des Leibes Christi fördern, eine charis, eine Gnade, sind, hält er fest.
Er knüpft auch eine theologische Verbindung zur Christologie, weil es nicht etwa die Weitergabe des Staffelstabes durch den Apostel, sondern der von den Toten auferstandene Jesus Christus selbst ist, der allen Gläubigen, die getauft sind (Eph 4,4-6), das Maß an Gnade zueignet, das sie für sich und für ihr Engagement in der Kirche brauchen (Eph 4,7-9). Es ist die Begabung durch Jesus Christus selbst, die in der Kraft des Geistes zur Beauftragung wird. „Paulus“, der ideale Autor des Briefes, stellt diese Gnadentheologie als Rückgrat der Ekklesiologie heraus und rekonstruiert dadurch den Zusammenhang zwischen Berufung und Bevollmächtigung als Korrelation von Bestimmung und Befreiung unter den Bedingungen nachapostolischer Zeit.
Der zweite Passus wird von den Pastoralbriefen markiert, die von der Gnade, die einen kirchlichen Dienst begründet, nur noch im Hinblick auf den Meisterschüler Timotheus sprechen (1 Tim 4,14) und dadurch indirekt auf den Episkopos, den Bischof, der in einer Stadt amtieren soll (1 Tim 3,1-7), aber nicht mehr auf die vielen anderen Dienste, die in der Kirche zu leisten sind; überdies wollen sie die Frauen aus der Öffentlichkeit, auch der kirchlichen, ins Private zurückdrängen (1 Tim 2,8-15).
Bei den konservativen Reformern, die sich in den Briefen zu Wort melden, wird als neue, aus dem Judentum adaptierte Struktur die Ordination durch Handauflegung und Gebet entwickelt, die von den Presbytern (1 Tim 4,14) resp. dem Apostel (2 Tim 2,6) ausgeht und über Timotheus weitergehen soll (1 Tim 5,22). Mit diesem Modell wird einerseits personale Kontinuität geschaffen, die Generationen verbindet und das Zeugnis des Glaubens von Angesicht zu Angesicht auf Dauer stellt. Anderseits wird durch den Ritus der Handauflegung das epikletische Moment der Ekklesiologie gestärkt, verbunden mit dem Gebet der Ältesten, die das kollegiale Moment stärken.
Die starke Entwicklung im Corpus Paulinum wird extrem unterschiedlich bewertet: im traditionellen Katholizismus als notwendiger Klärungsprozess, der anfängliche Unsicherheiten hinter sich lässt, im liberalen Protestantismus als Abfall von der paulinischen Geisteshöhe in die Niederungen frühkatholischer Kasuistik. Beide Deutungen unterschätzen die hermeneutische Dynamik des Corpus Paulinum, das zu den Keimzellen des neutestamentlichen Kanons gehört. Gegenüber den paulinischen Originalbriefen halten die Pastoralbriefe fest, dass die Geschichte über die Anfänge der paulinischen Gemeindegründungen hinausgeführt hat und neue Lösungen der kirchlichen Organisation forderten; aber gegenüber den Pastoralbriefen halten die paulinischen Schreiben an die Korinther und die Römer fest, dass die Entwicklung nie über den Anfang hinaus, sondern immer nur mitten in ihn hineinführen kann, weil er ja durch Jesus Christus selbst gelegt und in der Kraft des Geistes vergegenwärtigt wird.
Wenn also die Pastoralbriefe in die Richtung einer episkopalen resp. presbyterialen Leitung weisen mögen, die nach einer langen Inkubationszeit und nicht ohne starke Modifikationen lange Zeit den Dienst der Kirche geprägt hat, erklären die paulinischen Originalscheiben: Jedes kirchliche Amt ist Dienst; jedes ist Charisma, das wirkt, alle Amtsinhaber werden also daran gemessen, wie sehr sie ihre Aufgabe in der Anerkennung anderer und in der Arbeit am Wachstum der Kirche erfüllen. Paulus zeigt: Es darf keine Monopolisierung kirchlicher Leitung, Katechese, Liturgie und Diakonie durch Bischöfe resp. Älteste geben, denen Diakone dann noch assistieren dürfen; der ekklesiale Pool verantwortlicher, freiwilliger, kompetenter, anerkannter Mitarbeit ist weit größer, als er sich im Spiegel der Tradition katholischer Theologie zeigt, das Zweite Vatikanische Konzil nicht ausgeschlossen. Auch die Dienste von Frauen gehören dazu.
Auswertung
Die Grundfrage, wie der verantwortliche Dienst in der Kirche mit der Freiheit des Glaubens einhergeht, lässt sich auf der Basis des Neuen Testaments theoretisch beantworten, indem die Theozentrik der Berufung mit der Gemeinschaft der Gläubigen vermittelt wird, die ihrerseits kein Selbstzweck ist, sondern die Nähe Gottes in der Welt von heute verkünden und verwirklichen soll. Die Kirche bedarf einer charismatischen Erneuerung – im Sinne dessen, dass die fundamentale Bedeutung, die soteriologische Gleichheit und die ekklesiale Vielfalt der Möglichkeiten, die alle Gläubigen mitbringen, als Lebenselixier der Kirche neu beschrieben und vor allem neu organisiert wird. Charismen sind Begabungen, die als Beauftragungen entdeckt, angenommen und anerkannt sein wollen. Darin realisieren sie in der nachösterlichen Kirche die Korrelation von Bestimmung und Befreiung, in der sich der Zusammenhang von Berufung und Bevollmächtigung zeigt.
Eine solche Neuorientierung der katholischen Ekklesiologie kann theologisch nicht überzeugen, ohne dass die ökumenischen Beziehungen vertieft werden, und zwar im Ansatz so, dass die Kirchlichkeit nicht vor allem an den historischen Entwicklungen ekklesialer Leitungsdienste gemessen, sondern an der „Frucht des Geistes“ (Gal 5,22) erkannt wird, also am Glaubenszeugnis, am Weltdienst und an der Gemeinschaftsbildung, an der sakramentalen Versöhnung, an den Sakramenten der Taufe und der Eucharistie. Die katholische Kirche hat eine Bringschuld, die sie mit einer Neubesinnung auf das Neue Testament im Rahmen biblisch orientierter Ekklesiologie abtragen kann.
Ob die Suche nach einer praktischen Neujustierung der Ekklesiologie vergeblich ist, weil sie gegen die Wand des Klerikalismus läuft oder schlicht zu spät begonnen wurde? Nicht wenn es neue Koalitionen zwischen reformfreudigen Bischöfen und engagierten Mitgliedern des Kirchenvolkes gibt. Die Zeit ist reif. Die urchristlichen Geschichten eines Aufbruchs ins Neue, Unbekannte, Weite müssen heute neu als die Anfangsgeschichten eines Glaubens entdeckt werden, der durch Freiheit bestimmt ist und die Freiheit als Chance bestimmt, Gott und dem Nächsten zu dienen.