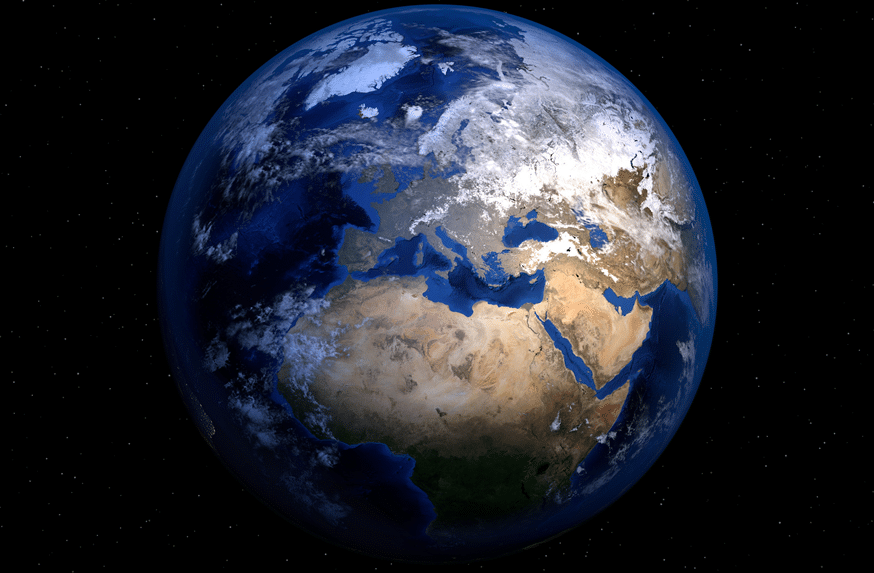Ich freue mich sehr, zum Schluss der Philosophischen Tage auch noch ein paar Gedanken zu einem Thema einbringen zu können, das mich seit langem beschäftigt. Gerade die Philosophie scheint, was das globale Denken angeht, trotz der Pionierleistung von Ram Adhar Mall und anderen Gründern der interkulturellen Philosophie immer noch einen großen Aufholbedarf zu haben – zumal die interkulturelle Philosophie die Mainstream-Philosophie häufig nur als exotische Randbemerkung garniert. Ein echter Dialog, der es vermag, an den Grundfesten des westlichen Philosophieverständnisses zu rütteln, findet leider viel zu selten statt.
Ich möchte in meinem Vortrag etwas zum Anspruch des Fremden im Denken sagen. Dabei sind mir die beiden Begriffe „Anspruch“ und „Fremdes“ als Ausgangspunkt für ein Denken in globaler Perspektive besonders wichtig. Ich möchte deshalb vor meinen weiteren Ausführungen kurz auf beide Begriffe eingehen.
Begriffe
„Anspruch“ beinhaltet einerseits eine bestimmte Wertvorstellung, eine Art normative Messlatte, die an das eigene Denken und Handeln angelegt wird. Andererseits bedeutet „Anspruch“ auch eine Herausforderung durch das Angesprochen-sein von Anderen. Beides zusammengenommen könnte man sagen, der Anspruch, den ich an mein Denken richte, ist, dass es dem fremden Anspruch zu antworten vermag. Das ist jedoch alles andere als einfach, denn, so betont Bernhard Waldenfels (1990, 7), „Erfahrungen, die auf Ansprüche antworten, macht man; man hat sie nicht zur Verfügung“. Man kann ihnen auch nicht zuvorkommen oder Verfügungsmacht erlangen, beispielsweise durch rezeptartige Anleitungen, wie man mit Fremdem umgehen könnte – eine Hoffnung, die viele haben, die sich zu Interkulturellen Kompetenztrainings anmelden oder Diversity management betreiben.
Die hier gemeinten Ansprüche unterscheiden sich auch von „Geltungsansprüchen, die wir erheben, wenn wir etwas behaupten oder verfechten“ (ebd.). Diese dienen uns vielmehr dazu, Fremdem gerade not antworten zu müssen, seinem Anspruch auszuweichen, ihn gar nicht erst zu hören oder zuzulassen. Die große Herausforderung fremder Ansprüche besteht gerade darin, dass wir ihnen nicht ausweichen können, denn selbst das Nicht-Antworten ist eine Form des Antwortens.
Fremde Ansprüche zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie sich mit der bekannten eigenen Ordnung nicht einfangen lassen – womit ich beim zweiten wichtigen Begriff wäre: dem „Fremden“. Eine besondere Schwierigkeit im Umgang mit Fremdem drückt sich bereits in der Sprache aus. Denn in der Regel reden wir von „dem Fremden“ und benutzen damit einen bestimmten Artikel. Fremdes lässt sich aber gerade not bestimmen. Es zeigt sich, mit der bekannten Formulierung Edmund Husserls ausgedrückt, in der „bewährbaren Zugänglichkeit des original Unzugänglichen“ (in: ebd.) – also gerade dadurch, dass es sich not zeigt. Es ist auf eine paradoxe Weise anwesend durch seine Abwesenheit.
Wäre Fremdes zugänglich, wäre es kein Fremdes mehr. Die widersprüchliche Erfahrung, dass sich Fremdes gerade durch seinen Entzug zeigt, führt dazu, dass es zwischen Faszination und Bedrohung schillert. Dieses „Schillern“ weist darauf hin, dass Fremdes immer relational ist. Fremdes an sich gibt es nicht, etwas ist immer nur fremd für mich – und wie ich es erlebe, hat viel mit mir zu tun: die einen zeigen sich offen und neugierig, andere ziehen sich zurück und reagieren abwehrend.
„Fremdes“ ist auch nicht einfach nur „Anderes“. In dieser Unterscheidung drückt sich die besondere Brisanz der Fremdheitserfahrung aus. Denn Fremdes ist nicht etwa bloß eine „Variante des Eigenen“ (Bedorf 2007, 23) oder nur verschieden von mir. Jenseits meiner eigenen Ordnung habe ich keinen Zugriff auf eine Instanz, die mir helfen könnte, Fremdes in Bekanntes einzureihen, es als „Anderes“ in den Griff zu bekommen. Damit erscheint Fremdes auch als Atopos, als Nicht-Ort. Gewissermaßen beginnt die westliche Philosophie mit dieser „atopischen“ Erfahrung – verkörpert in der Gestalt des Sokrates. Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass Waldenfels (1990, 8) in seiner Phänomenologie des Fremden vom „Stachel des Fremden“ spricht, und sich dabei auf die „Stechfliege“ Sokrates bezieht. Eigentlich müsste die Philosophie damit prädestiniert sein für das globale Denken – oder auch nicht, denn der Anspruch oder Ansporn von Sokrates führte schließlich dazu, dass er sterben musste.
Ich möchte in meinem Vortrag zunächst ein paar Gedanken dazu entwickeln, warum sich die westliche Philosophie (aber natürlich nicht nur sie) schwer tut mit Fremdem und daran anknüpfend der Frage nachgehen, wie ein Philosophieren mit globalem Anspruch gelingen könnte. Im Hintergrund meiner Ausführungen schwingt die Erfahrung des interkulturellen Philosophierens mit indigenen Menschen in Kanada – insbesondere mit dem Cree Ältesten Stan Wilson, mit dem ich seit einigen Jahren einen intensiven philosophischen Austausch pflege. Denn für mich hängt das Reden über die Philosophie und das Philosophieren eng zusammen. Dabei steht immer auch das Verständnis von Philosophie selbst auf dem Spiel.
Philosophie und der Stachel des Fremden
Zum ersten Punkt: Ich möchte das schwierige Verhältnis der Philosophie zum Fremden aus drei Richtungen betrachten, die sich wechselseitig bedingen: (1) Gründe, die im Selbstverständnis der europäischen Philosophie liegen, (2) Gründe, die im Einfluss der Sprache auf unser Denken liegen, (3) psychologische Gründe, wenn wir uns selbst fremd werden.
Gründe, die im Selbstverständnis der westlichen Philosophie liegen
Kürzlich hörte ich im Deutschlandfunk eine Sendung, in der Andrea Roedig (2020) im Zusammenhang mit den Herausforderungen durch das Corona-Virus erklärte, Social Distancing komme dem Philosophieren entgegen. Denn Philosoph*innen zögen sich typischerweise zurück und betrachteten die Welt aus einer gewissen Distanz heraus. Es gehöre zum Philosophieren dazu, sich über die Alltäglichkeit der Welt zu erheben, um aus einer Metaperspektive zu Erkenntnissen über sie zu gelangen. Philosophie tendiere also eher zum „Distancing“ und weniger zum „Socializing“.
Auch wenn ich dieser Annahme nur bedingt folgen kann, ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Philosophie immer schon schwer tut mit dem Sozialen – und zwar vor allem dann, wenn es darum geht, vom Anderen her zu denken (vgl. Bedorf 2011, 7 ff.). Noch schwerer tut sie sich mit Fremdem. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass „das Fremde über Jahrhunderte kein genuin philosophisches Problem [war]“ (Waldenfels 2007, 361), was ein Blick in in das Historische Wörterbuch der Philosophie belegt. Hier findet sich erst im Jahr 2004 ein erster explizierter Eintrag zur „Xenologie“ als Wissenschaft vom Fremden. Vielfach sei es noch heute so, meint Waldenfels (ebd.) und fährt fort: „Wenn [der Fremde] auftaucht, dann wie ein Irrwisch, der rasch wieder verschwindet, sobald das Licht der Vernunft darauf fällt.“
Die abendländische Philosophie sei beherrscht von einem ego-logischen Begriff der Totalität, kritisiert auch der jüdische Philosoph Emmanuel Lévinas (2003, 20). Sie bleibe einer „Philosophie des Selben“ verhaftet und lebe, viel mehr noch als in der Heidegger‘schen „Seinsvergessenheit“, in einer „Vergessenheit des Anderen“ (vgl. Bedorf 2016, 100). Er verweist damit auf den unabdingbaren Anspruch des Fremden und „sondiert Möglichkeiten, von Erfahrungen, die über die Selbstgenügsamkeit des Ich hinausgehen, philosophisch Rechenschaft abzulegen: Erfahrungen der Überschreitung, des Entzugs und der Öffnung auf ein Anderes hin, das nicht vom Selbst vereinnahmt, ja nicht einmal begrifflich voll erfasst werden kann“ (ebd.).
Die Angst scheint nach wie vor groß zu sein, den objektiven Stand des Zuschauers zu verlieren, wenn wir die Schiffbrüche der Welt beobachten, denn leicht könnten uns die Wogen hineinziehen in das unheimliche Geschehen, würden wir uns aus der sicheren Distanz wagen. Das betrifft auch unser Verhältnis zur Natur. Treffend spricht Hans Blumenberg (2012, 66) von „Weltverwicklung“, wenn wir den Drohungen der Natur ausgeliefert sind, statt ihnen gegenüber gestellt zu sein – insofern ist das Corona-Virus ein besonderer Affront, denn immer noch sind unsere Erkenntnisse nicht so weit, dass wir seiner Herr werden könnten.
Aus dieser Erfahrung spricht auch das große Unbehagen darüber, dass wir durch unsere körperliche Verfasstheit der Natur näher sind, als uns lieb ist. Man könnte hier auch von einer „Leib- oder Naturvergessenheit“ sprechen, die wir durch intensive Erfahrungen beim „Waldbaden“, in den Bergen oder am Meer wettzumachen versuchen. Letztlich drückt sich darin auch eine Entfremdung von uns selbst aus. Mich verwundert dabei immer wieder, wie leicht es uns gelingt, unsere „Leiblichkeit“ bzw. „Natürlichkeit“ abzuspalten, wenn wir auf hohem abstrakten Niveau philosophieren und meinen, dadurch die Welt ganz besonders gut erklären zu können.
Die westliche Philosophie ist über Jahrhunderte hinweg geprägt von naturwissenschaftlichen Errungenschaften und nicht zuletzt angesichts schrecklicher Kriege auch von dem Wunsch, das „Tier“ im Menschen in den Griff zu bekommen. Die Bewältigung all dessen, was befremdlich ist, scheint geradezu charakteristisch für die abendländische Rationalität zu sein, die dabei Techniken hervorbringt, „die schon bei Hobbes Sozial- und Lebenstechnik miteinschließt“ (Waldenfels 1990, 61). Fremdheitserfahrungen – auch mit sich selbst – sollen auf dem Wege der Aneignung unschädlich gemacht werden. Als wichtige Strategie dafür hat sie neben der Egozentrik die Logozentrik hervorgebracht: So wird bei Kant Fremdes „vom Eigenen durch die Konstitution eines formalen, vorgängigen Denkraumes [H.i.O.]“ (ebd.) abgeschieden, bei Hegel wird es in einem totalen, allumfassenden Denkraum aufgehoben.
Die Tatsache, dass Jürgen Habermas (1996) bei all seiner programmatischen „Einbeziehung des Anderen“ fragt, „ob China und Japan tatsächlich ‚so komplex seien wie Europa‘“ (Elberfeld 2017b, 7), zeugt von den Konsequenzen einer eurozentrischen Aneignungsstrategie, die zahlreiche blinde Flecken hervorbringt, wie sich Habermas dann auch selbst eingesteht. Angesichts eines „globalen Denkens“ ist dabei besonders frappierend, dass die jahrhundertelange „Verflechtungsgeschichte“ (Elberfeld 2017a, 21 ff.) der westlichen Philosophie mit zahlreichen Strömungen anderer philosophischer Traditionen weitgehend ignoriert wird. Nach wie vor dominiert die Vorstellung, dass die (einzige) Wiege der Philosophie Griechenland sei.
Die Konsequenzen des Versuchs einer Bewältigung von Fremdem wird auch im „dreifachen Monopol der Vernunft“ deutlich, das Merleau-Ponty (in: Waldenfels 1990, 62) beschreibt: „Der Erwachsene hat recht gegenüber dem Kind, der Zivilisierte gegenüber dem sogenannten Primitiven, der Gesunde gegenüber dem Kranken“ – „von rechtlosen Tieren oder gar Pflanzen ganz zu schweigen“, fügt Waldenfels noch hinzu.
Leider muss man hier noch ein weiteres Vernunftmonopol ergänzen, das bis heute das Selbstverständnis der Philosophie prägt: Philosophieren ist männlich (vgl. Munz 2004, 7). Ich habe den Eindruck, dass man sich als Philosophin mit all den Eigenschaften präsentieren muss, die in der Regel Männern zugeschrieben werden. Nur so hat man als Frau die Chance, ebenso anerkannt zu sein. Die überkommene Vorstellung Lawrence Kohlbergs, die höchste Stufe der Moralentwicklung sei eine Orientierung an abstrakten ethischen Prinzipien, hält sich trotz der bekannten Kritik Carol Gilligans hartnäckig. Sie steht symptomatisch für ein Philosophieren, das Spontaneität, Kontingenz, Emotionalität und Leiblichkeit als defizitär betrachtet. Philosophinnen wie Susanne Langer und Iris Murdoch machten darauf aufmerksam, dass Gefühle nicht etwa nur das „Andere der Vernunft“ sind, sondern eine wichtige Rolle für die moralische Urteilskraft spielen und damit überaus „vernünftig“ sind.
Man könnte hier noch einige weitere Aspekte des Selbstverständnisses der westlichen Philosophie anführen, die es schwer machen, den Anspruch des Fremden zu hören. Dazu gehört beispielsweise die „Lebensweltvergessenheit“, die Husserl in seinem Spätwerk bemängelt, sowie die Gräben zwischen aktiv und passiv, zwischen Theorie und Praxis und zwischen Objektivität und Subjektivität – Gräben, die in der Philosophie bis heute immer wieder neu gezogen werden. Dabei spielt die Language eine besondere Rolle – womit ich bei einem zweiten Gesichtspunkt für Gründe wäre, die einen echten Dialog mit Fremdem erschweren.
Gründe, die im Sprechen und Denken liegen
Unsere Sprache ist das Medium, in dem wir uns eine bestimmte Sicht auf die Welt erzeugen. In dieser Weltansicht leben wir – je länger, desto unbemerkter (vgl. Elberfeld 2014, 50). „In jeder Sprache entwickeln sich ausgehend von einzelnen Wörtern ganze Wortfelder, die in einzelnen Sprachen […] eine herausgehobene kulturelle Bedeutung gewinnen. In der Bedeutung dieser Wörter und Wortfelder bündeln sich philosophische Gedanken und Auslegungsformen der Wirklichkeit.“ (ebd., 277) Sie erleichtern bestimmte Gedanken oder legen diese nahe. Zudem erschöpfen sich Worte, die wir gebrauchen, nicht darin, Tatsachen wiederzugeben, vielmehr schaffen wir mit unseren Äußerungen auch Tatsachen. Wie folgenreich das für den Umgang mit Fremdem sein kann, möchte ich anhand eines Wortfelds verdeutlichen, das im deutschen Sprachraum bis heute äußerst einflussreich ist – und zwar das, was sich aus dem lateinischen Wort cultura entwickelt hat.
Als das Wort „Kultur“ Mitte des 18. Jahrhunderts in die deutsche Sprache (damals noch mit C geschrieben) eingeführt wurde, galt es als ungebräuchlicher Spezialbegriff oder Fremdwort. „Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte das Wort Kultur eine Bedeutungsfülle gewonnen, die seinen differenzierten Gebrauch bis heute erschwert.“ (ebd., 280) Ausgehend von Ciceros Formulierung der cultura animi als „Pflege der Seele“ hing das Wort zunächst für eine lange Zeit eng an der Vorstellung von Education, die den rohen Naturzustand des Menschen in einen Kulturzustand überführen soll. Kant spricht von der „Kultivierung“ des Menschen (dessen Gemütskräfte), die notwendig ist, um frei und damit moralisch handeln zu können. Daran anknüpfend verwendet Herder den Begriff der Kultur im Sinne der Entwicklung ganzer Völker und Nationen, „die ihre ‚Wildheit‘ hinter sich lassen und sich damit mehr und mehr abheben von der ‚Natur‘“ (ebd., 286). Prinzipiell können all Menschen und Völker „Kultur“ erlangen – Unterschiede zwischen ihnen bestehen „nur“ im Stand ihrer „Kultiviertheit“. In der damaligen Zeit war dieser Gedanke alles andere als selbstverständlich!
Auf was es mir hier vor allem ankommt, ist, dass es sich bei diesen ersten Ausführungen zur Kultur grammatisch strikt um einen Singular handelt, der Plural „Kulturen“ taucht erst Mitte des 19. Jahrhunderts auf – mit wichtigen Konsequenzen für das globale Denken. Denn der Singular „Kultur“ beschreibt einen Sollzustand, zu welchem sich ein Mensch oder ein Volk entwickeln soll. Der Plural „Kulturen“ bezeichnet einen Istzustand, nämlich die Tatsache, dass es unterschiedliche Kulturen gibt. Der große Unterschied zwischen beiden ist, dass Kultur zunächst ein Prozessbegriff ist, wohingegen Kulturen als Resultate dieses Prozesses gesehen werden, die dann auch nebeneinandergestellt und verglichen werden können.
Einer, der dies in besonderer Weise erkannt hat und dazu beitrug, dass die Pluralbildung „Kulturen“ in der deutschen Sprache verbreitet wurde, war Friedrich Nietzsche. In einem Aphorismus, der mit Zeitalter der Vergleichung überschrieben ist, schreibt er, ein solches Zeitalter bekomme seine Bedeutung dadurch, „dass in ihm die verschiedenen Weltbetrachtungen, Sitten, Culturen verglichen und neben einander durchlebt werden können“ (in: ebd., 292). Interessant ist, dass Nietzsche hier nicht nur von „vergleichen“, sondern auch von „durchleben“ spricht. Es geht ihm also nicht nur um den distanzierten Blick von außen, sondern auch darum, sich auf Fremdes einzulassen, sich durch die Begegnung verändern zu lassen. Er weiß jedoch, dass das alles andere als einfach ist – so gesteht er sich verschämt ein, dass er sich angesichts der Beunruhigung eines chaotischen „Durcheinanderflutens“ (MA § 23) zurückwünsche unter die „Glocke“ oder das „Sturzglas“ der Kultur. Wörtlich schreibt er, dass ihm angst wurde „beim Anblick der Unsicherheit des modernen Culturhorizonts“ und dass er sich ermannen müsse, um sich in das freie Weltmeer zu stürzen (vgl. Elberfeld 2008, 135).
Bei Nietzsche zeigt sich in besonderer Weise, wie sich mit der Pluralbildung „Kulturen“ ein Weg auftut, „dem eurozentrischen und universal orientierten Fortschrittsgedanken in der Geschichte zu entkommen“ (Elberfeld 2017a, 223) – ein Gedanke, der begleitet wurde von der gewaltvollen Europäisierung der Welt. Der Einfluss des Singulars „Kultur“ ist jedoch nach wie vor groß. Denn der Imperialismus ist auch in unserer Sprache noch tief verwurzelt: So lebt der Singular deutlich in der Rede von einer „Leitkultur“. Viele aktuelle Debatten wie die „Black Lives Matter“-Bewegung oder die Diskussion um den Rasse-Begriff im Grundgesetz zeugen von der Notwendigkeit, kritisch darüber nachzudenken, wie unser Blick auf die Welt durch den Einfluss der Sprache auf unser Denken gefärbt wird.
Nietzsches Angst macht auf eine letzte Annahme für die Schwierigkeit des Umgangs mit Fremdem aufmerksam, die ich noch kurz andeuten möchte. Dabei geht es mir um psychologische Gründe, insbesondere um die Herausforderung, Fremdem im Selbst zu begegnen.
Psychologische Gründe – die Herausforderung durch Fremdes im Selbst
Interessant ist, dass Nietzsches Entdeckung des Plurals Kulturen auch das Verständnis seines Selbst erschüttert. Er schreibt: „Die Annahme des Einen Subjekts ist vielleicht nicht nothwendig; vielleicht ist es ebensogut erlaubt, eine Vielheit von Subjekten anzunehmen, deren Zusammenspiel und Kampf unserem Denken und überhaupt unserem Bewußtsein zu Grunde liegt?“ (in: Schellhammer 2019, 234) Weit vor postmodernen Überlegungen zur Identität stellt Nietzsche einen Zusammenhang her zwischen der Pluralität des Selbst und der kulturellen Vielfalt. Dabei wird deutlich, dass Pluralismusfähigkeit vor allem damit zu tun hat, mit der eigenen inneren Vielfalt umgehen zu lernen. Auch wenn die Antike entlang „geistiger Übungen“ (vgl. die Ausführungen von Foucault oder Hadot) hier einiges zu bieten hat, zeigt sich doch, dass sich die Philosophie schwer tut mit den unbewussten Schattenregionen des Menschen. So schreibt Kant in seiner Anthropologie zwar von „dunklen Vorstellungen“, die wir haben, ohne uns ihrer bewusst zu sein, meint dann aber, diese seien nur dem Bereich der physiologischen Anthropologie zuzurechnen, auf die es ihm nicht weiter ankomme.
Dass die Begegnung mit Fremdheitserfahrungen im Selbst gerade für den interkulturellen Dialog von besonderer Bedeutung ist, liegt auf der Hand. Und dennoch scheint mir diese wichtige Erkenntnis häufig vernachlässigt zu werden, was gewissermaßen symptomatisch ist. Trifft uns der Anspruch des Fremden, sind wir nämlich in erster Linie versucht, dessen Fremdartigkeit in den Griff zu bekommen, ihm seinen Stachel zu nehmen. Spätestens seit Sigmund Freud wissen wir um die zahlreichen Abwehrmechanismen, derer wir uns bedienen, um der eigenen Verunsicherung Herr zu werden, indem wir die Andersartigkeit des Anderen „behandeln“. Welche Folgen das haben kann, hat der israelische Psychologe Dan Bar-On eindrücklich beschrieben. Seine Analyse zur Friedensbildung im Israel-Palästina-Konflikt passt zu Nietzsches Erkenntnis der „Subjekt-Vielheit“.
Er weist darauf hin, dass es erst Frieden geben wird, wenn monolithische Identitäten zu bröckeln beginnen, weil Menschen nicht nur das Opfer in sich sehen, sondern auch den Täter. Erst dann können sie frei, d. h. ohne Projektion und Abwehr auf den Anspruch des Anderen antworten. Eigentlich ist diese Erkenntnis alles andere als neu, so bezieht sich Hannah Arendt bei ihrer Frage, was uns zum Denken bringt, auf Sokrates, der „entdeckte, daß man Umgang mit sich selbst haben kann, so gut wie mit anderen, und daß beide Arten von Umgang irgendwie miteinander zusammenhängen“ (Arendt 1998, 187). Es sei kennzeichnend für „schlechte Menschen“, „daß sie ‚mit sich selbst entzweit sind‘ und sich selbst fliehen; ihre Seele ist in Aufruhr gegen sich selbst“ (ebd., 188).
Der Anspruch des Fremden erweist sich also als ein doppelter: Ich stehe nicht nur vor der Aufgabe, dem fremden Anderen zu antworten, sondern auch mir selbst. Ich halte die Fähigkeit, sich selbst antworten zu können, für eine Grundvoraussetzung des globalen Denkens. Denn nur so können wir wirklich offen sein, ohne uns in projektiven Verzerrungen zu verheddern. Arendt (2016, 57) würde sogar sagen, es handelt sich um eine Voraussetzung für jedes philosophische Denken. Denn es sei eine Illusion, aus der menschlichen Pluralität ausbrechen zu können. Sie schreibt: „Selbst wenn ich ganz allein leben würde, so lebte ich doch mein Leben lang im Zustand der Pluralität. Ich muss mit mir selber zurechtkommen.“
Ich komme nun zur Frage, wie im Anschluss an diese Befunde ein Philosophieren mit dem Anspruch des Fremden gelingen könnte. Wie geht „globales Denken“?
Philosophie mit dem Anspruch des Fremden
Ich möchte dazu ohne „Anspruch“ auf Vollständigkeit drei Thesen formulieren, die auf wichtige Spannungsfelder hinweisen, in welchen sich das globale Denken vollzieht.
Erstens. Das „Denken“ selbst muss zur Disposition gestellt werden
Mit Waldenfels (2007, 363) könnte man auch sagen: „Eine veritable Philosophie des Fremden bahnt sich an, sobald die zwei Grundpfeiler der Moderne, nämlich die Autonomie des Subjekts und eine monologische Vernunft, Risse bekommen. Mit der Dezentrierung des Subjekts und der Pluralisierung der Rationalität entsteht Raum für Fremdes.“ Das bedeutet, nicht nur anzuerkennen, dass wir uns selbst immer auch fremd sind, sondern ganz bewusst auf diese Fremdheit in uns selbst zu antworten. Dazu gehören unsere Leiblichkeit und Emotionalität genauso wie die Schattenregionen unseres Selbst, die ich anders als Freud nicht nur als bedrohliche Macht, sondern eher wie C.G. Jung als wichtige Ressource erachte, um in der Auseinandersetzung mit inneren Widersprüchen zu größerer Freiheit zu gelangen. Bezogen auf den Anspruch des Anderen besteht diese Freiheit nicht darin, autonom und unberührt als eine Art monolithischer Block bei mir selbst zu beginnen, sondern aus dem Beginn beim Anderen eine Antwort zu finden, die keiner Projektion oder sonstigen Reaktion entspringt.
Die eben erwähnten Begriffe der „Dezentrierung“ und der „Pluralisierung“ sind jedoch nicht unproblematisch – und nicht immer führen sie dazu, dass Fremdes Raum bekommt. Denn wir brauchen einen Ort, um Fremdes empfangen zu können. Ein Dialog zwischen verschiedenen Denktraditionen gelingt nur, wenn ich eine eigene Position habe, die ich einbringen kann. Postmoderne Identitätstheorien, die eine zunehmende Multiphrenie für normal halten, unterschätzen die fatalen Folgen pathologischer Persönlichkeitsstrukturen. Denn ein Mensch ohne Grund und Boden ist gefährdet, überkompensatorisch in das extreme Gegenteil zu kippen und sich in „-istischen“ Weltbildern zu verfangen. „Auf den Globalismus antwortet der Lokalismus, der sich auf das Hier fixiert und sich an das Eigene klammert, bis hin zum ideologisch aufgeladenen Blut-und-Boden-Denken.“ (Waldenfels 2007, 367) Weder das Bollwerk der Identität, noch die Auflösung derselben eröffnen einen Raum, der globales Denken ermöglicht. Denn es vollzieht sich auf der Schwelle zwischen Eigenem und Fremdem.
Gerade in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen zeigt sich, dass der „Vernunftabsolutismus“ (Mall 2003) eine Erfindung der westlichen Philosophie ist. So betont Mall (ebd., 87): „Die Rede vom Mythos zum Logos ist eine Rede, welche die Vernunft sich selbst ausgedacht hat.“ Für meinen indigenen Gesprächspartner in Kanada ist es normal, auch spirituelle Erfahrungen im Denken ernstzunehmen oder nicht nur about die Natur zu philosophieren, sondern auch with ihr. Alles andere wäre für ihn regelrecht „unvernünftig“.
Denken in globaler Perspektive heißt, sich auf andere Formen des Denkens einzulassen und sie nicht als „Weisheitslehren“ oder „Mythologie“ geringer zu achten, sondern mit ihnen philosophisch ins Gespräch zu kommen. Wenn man sich die europäische Begriffsgeschichte des Wortes „Philosophie“ ansieht, stößt man auf ein enormes Spektrum an Bedeutungen (vgl. Böhme 1994), das zahlreiche Anknüpfungspunkte an andere Denktraditionen bietet. Angesichts der globalen Herausforderungen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, können wir es uns überhaupt nicht leisten, irgendeine Form des Denkens außer Acht zu lassen (vgl. Papst Franziskus 2015, 74).
Zweitens. Globales Denken kann nicht nur gefordert, es muss vor allem geübt werden
Die Fremdheitserfahrung ist eine „pathische“, d. h. eine, die uns unvermittelt trifft und erschüttert. Sie kommt unserem Denken und Handeln zuvor. Es geht mir immer ein wenig zu schnell, wenn von einer Responsivität die Rede ist, ohne darzulegen, wie man es eigentlich schafft, dieser Erfahrung zu antworten, d. h. ohne sich dabei selbst zu verleugnen oder den anderen zu ignorieren. Wie gelingt uns ein globales Denken, das sich wirklich auf Fremdes einlässt und es dabei zulässt, sich selbst in Frage stellen zu lassen? Hier zeichnet sich auch ein schwerwiegendes ethisches Problem ab, denn was hilft uns die beste und komplexeste Theorie, wenn diese nicht tatsächlich im menschlichen Handeln Wirkung entfaltet? Gerade wenn wir mit etwas konfrontiert werden, das uns selbst in Frage stellt, ist es schwer, besonnen und bedacht zu antworten. Es liegt in unserer physiologischen Grundstruktur – und wie neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, vor allem in der Funktionsweise unseres Gehirns –, dass wir in Gefahrensituationen nicht mehr lange überlegen, sondern reagieren.
Ich erwähnte vorher schon Kant, der sehr wohl um das dunkle Feld menschlicher Gemütsregungen wusste, die es seiner Meinung nach zu kultivieren gilt (das hieß für ihn: disziplinieren und zivilisieren), um der Moralität größere Chancen einzuräumen. Er tat diese „Gemütskräfte“ dann jedoch als bloß physiologische Herausforderung ab, mit der die Philosophie nichts zu schaffen habe. Mit Adorno wissen wir, dass diese Form der denkerischen Aufklärung eine dunkle Seite produziert, weil sie keine Praktiken entwickelt hat, die sich leiblichen Regungen, emotionalen Aufwallungen oder spirituellen Unbestimmtheiten stellt (vgl. Böhme 2005). Mit „Praktiken“ meine ich vor allem leibliche, emotionale oder spirituelle „Übungen“.
Die westliche Philosophie tut sich schwer mit dem Begriff der „Übung“, denn ihm hängt der Hauch des Praktischen, vielleicht sogar des „Primitiven“ an, weil man sich in die Niederungen des konkreten Lebensvollzugs herablassen muss. Dabei darf man nicht vergessen, dass es auch in unserer Tradition wichtige Hinweise auf die Bedeutung einer philosophischen Lebenspraxis gibt (vgl. Hadot 1991). Man denke hier z. B. an Aristoteles. Für ihn war völlig klar, dass es nicht ausreicht, bloß theoretisch zu wissen, was richtig oder falsch ist, wenn man nicht in der Situation selbst geübt hat, mit den eigenen Emotionen umzugehen.
Ein tolles Beispiel für interkulturelle Anschlussmöglichkeiten genau an dieser Stelle liefert Rolf Elberfeld mit seinem Aufsatz Kants Tugendlehre und buddhistische Übung. Dabei beantwortet er die Frage nach dem Wie der Kultivierung unserer Gemütskräfte mit Hilfe asiatischer Denktraditionen. Denn hier bedingen und durchdringen sich „Theoretisches“ und „Pragmatisches“, anstatt als Gegensätze bestehen zu bleiben, die nicht nur bei Kant in ihrer philosophischen Bedeutung unterschiedlich bewertet werden (vgl. Elberfeld 2013, 29). Damit erweist sich für das globale Denken selbst die Praxis des globalen Denkens als wichtige Ressource, um im Dialog mit verschiedenen Denktraditionen und -praktiken eigene blinde Flecken sichtbar und das eigene Philosophieren „fremdheitsfähiger“ zu machen.
Zwei Übungshorizonte sind dabei nicht zu vernachlässigen, deren wechselseitige Bezogenheit im bekannten Diktum Wittgensteins, „[…] eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen“ (PU 19), besonders deutlich zum Ausdruck kommt.
Wenn man bedenkt, dass eine Sprache zutiefst mit einer Lebensform verflochten ist und damit ein bestimmtes Denken nahelegt, müsste man als global denkende Philosophin eigentlich sowohl möglichst viele Sprachen lernen als auch möglichst viele Lebensformen kennenlernen. So gewönne man nicht nur ein stimmigeres Bild der Wirklichkeit, sondern auch ein besseres Verständnis der eigenen sprachlichen Grenzen, die ja Wittgenstein gemäß auch die Grenzen meiner Welt bedeuten. Dementsprechend muss einen die wachsende Dominanz des Englischen in der Philosophie, aber auch in anderen Disziplinen, sehr nachdenklich stimmen. Denn sie fördert eine monokulturelle Weltsicht, in der wir blind werden für viele Weltdeutungen, die sich im Englischen nicht ausdrücken lassen.
Ich habe sowohl in der Arktis als auch in Afrika die Erfahrung gemacht, dass man auch jenseits der Sprache etwas vom Denken und der Weltsicht einer anderen Kultur begreifen kann, wenn man sich gewissermaßen mit Haut und Haar auf die fremde Lebenswelt einlässt. So kann man, glaube ich, Emotionen mit Emotionen verstehen. Wenn sich die Philosophie jedoch nur als „das Andere zum Leben“ versteht, als ein Werk von Spezialist*innen und disziplinierter Anstrengung, die im Gleichmaß denkerischer Distanz „eine abgesonderte Erfahrung darstellt, kann sie nicht das sein und das sagen, was sie zu sein und sagen vorgibt“ (Gamm 2009, 127). Es reicht meines Erachtens nicht, sich auch noch so intensiv rein theoretisch mit afrikanischer Philosophie zu befassen, wenn man nicht dort war, sich der Fremdheit nicht tatsächlich ausgesetzt hat.
Eine Philosophie, die global denken möchte, darf nicht nur „das Andere zum Leben sein“ – sie muss es aber also, um Abstand zu bekommen und die Dinge aus einer gewissen Distanz heraus betrachten zu können. Auch dieser Abstand will geübt werden, denn allzu leicht lassen wir uns hineinziehen in subjektive Beweggründe und momentane Befindlichkeiten. Globales Denken muss sich in die Spannung von Nähe und Distanz einüben. Dies führt mich zu meiner dritten und letzten These.
Drittens. Globales Denken vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen Kultur und Kulturen
Dieser These kann man Unterschiedliches entnehmen. Ich möchte zwei Aspekte hervorheben:
Erstens geht es mir darum, globales Denken als eines zu sehen, das die eigene Kultur durch die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen entwickelt. Damit meine ich aber nicht die Entwicklung auf ein bestimmtes Ziel hin, vielmehr entwickelt sich das Ziel selbst aus dem Prozess des Denkens zwischen den Kulturen. Genau das scheint auch Nietzsche mit seiner Rede von der „Vergleichung“ im Sinn gehabt zu haben. Denn er spricht von einer „inneren Bewegung der Motive“, die durch das Durcheinanderfluten und die Vielstimmigkeit der Kulturen in Gang gesetzt wird. Die „Vergleichung“ selbst wird zu einem fruchtbaren Nährboden für die eigene Kultur. Darin verbindet sich der Singular Kultur im Sinne einer bildenden Tätigkeit mit dem Plural Kulturen als die verschiedenen Resultate (vgl. Elberfeld 2017a, 292).
Die zweite Deutung beschreibt den schwierigen Balanceakt zwischen einer gesunden kulturellen Selbstvergewisserung und der Offenheit für Fremdes. Hier gefallen mir die beiden Begriffen der „Bodenständigkeit“ sowie der „Weltläufigkeit“ besonders gut, die Waldenfels geprägt hat (vgl. Schellhammer 2020). Die Begriffe sind gut gewählt, denn sie sprechen durch die inneren Bilder, die sie erzeugen: „Boden-Stand“ impliziert Sicherheit, Stabilität, emotionale Verankerung, auch so etwas wie Eigenstand und eine Form des positiven Stillstands, vielleicht in kontemplativen Momenten meditativer Praxis.
„Welt-Läufigkeit“ dagegen suggeriert Bewegung, Öffnung, Unterwegssein, den Versuch, das Eigene aus einer anderen Perspektive zu sehen. Im Raum zwischen beiden sind wir hier and anderswo. Dieser Raum, den der Cree-Elder Willie Ermine einmal „Ethical Space“ genannt hat, ist alles andere als ein kuscheliger Ort, in den wir uns gemütlich einrichten könnten. Er lebt vielmehr von der unbequemen Spannung zwischen den Polen. Denn immer wieder stehen wir in der Gefahr, dem Anspruch des Fremden durch die Extreme der Aneignung oder der Enteignung zu begegnen. Vorher erwähnte ich auch den Lokalismus und den Globalismus, die Blut-und-Boden Mentalität und die Mulitphrenie sowie die monolithische Identität und den Pluralismus.
Man könnte noch weitere extreme Gegensätze nennen, für die wir momentan ohne Weiteres Beispiele finden, so steht der verzweifelten Heimatlosigkeit der Menschen auf Lesbos eine festgefahrene Heimatbesessenheit des österreichischen Kanzlers gegenüber. Auch hier gilt es, den Anspruch befremdlicher Parolen nicht einfach nur vom Tisch zu wischen, denn Gegenbewegungen sind als Symptome ernst zu nehmen – so schwer das manchmal auch fällt.
Was die Philosophie angeht, kann ich nun sehr schön den Kreis schließen zum Beginn der Philosophischen Tage und dem Vortrag von Ram Adhar Mall. Denn wenn ich sage, globales Denken vollzieht sich zwischen der Bodenständigkeit in der eigenen Kultur und der Weltläufigkeit in Begegnungen mit anderen Kulturen, komme ich seiner „orthaften Ortlosigkeit“ sehr nahe. Darin steckt auch die Spannung von Nähe und Distanz, die es sowohl in der Beziehung zu uns selbst, als auch zu anderen zu kultivieren gilt.