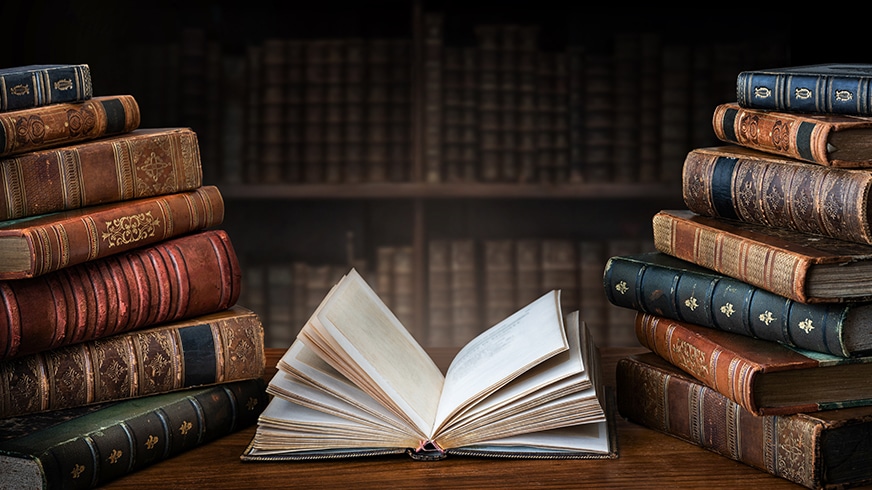Einleitung
Es mag auf den ersten Blick seltsam anmuten, eine Tagung über den „Bayerischen Adel“ mit einem Vortrag über das Münchner Patriziat zu beginnen, ist doch mit diesem Begriff untrennbar die kleine bürgerliche Ober- und Führungsschicht der landesherrlichen Stadt München konnotiert.
Allerdings war der Kreis der Patrizier in München ein weitgehend abgeschlossener, exklusiver, fast adelsähnlicher Zirkel, der seit dem 13. Jahrhundert aus etwa 20 bis 30 eng miteinander versippten Familien bestand. Das entscheidende Kriterium für die Zugehörigkeit zu diesem Kreis war bis in das 16. Jahrhundert hinein die Wahl in den Inneren Rat als dem wichtigsten städtischen Gremium. Für die Zeit des Mittelalters bis zur frühen Neuzeit wäre deshalb die Formulierung von „ratsfähigen“ Familien oder einfach „Ratsfamilien“ angemessener.
Denn der Begriff „Patrizier“ ist für diese Familien erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts erstmals nachweisbar, also in der Zeit des Humanismus und der Renaissance, als diese Münchner bürgerliche Elite mit einem dezidiert patrizischen Selbstbewusstsein den Höhe- und Scheitelpunkt seiner Entwicklung erreicht hatte. Erst ab dieser Zeit werden in den Matrikeln der Universität in Ingolstadt Münchner Bürgersöhne als „patricius Monacensis“ bezeichnet. Dieses patrizische Selbstbewusstsein manifestierte sich auch im Streben nach Ebenbürtigkeit mit dem Adel bzw. im Aufsteigen in den Adelsstand. Innerhalb der Stadtgesellschaft grenzte man sich von den einfachen Bürgern ständisch ab als „Die Geschlechter“.
Bis um 1500 hatten alle alten, ratsfähigen Familien ihren Landsitz erworben. Sie hatten sich nach und nach aus der Stadt und der politischen Verantwortung für diese Stadt zurückgezogen, wodurch ihr Einfluss entscheidend geschwächt wurde. Bürgerlicher Lebensstil und sogar das Bürgerrecht wurden in der frühen Neuzeit aufgegeben, um die Ebenbürtigkeit mit dem Adel nicht zu verlieren. Schließlich erfolgte ein völliger Übertritt in den Landadel. Patrizier traten immer mehr in den Hofdienst ein und strebten nach herzoglichen Rats- und höchsten Staatsstellen.
Im Gegenzug wurde der Einfluss des Stadtherrn, des wittelsbachischen Herzogs, später des Kurfürsten, auf München, nunmehr seine Haupt- und Residenzstadt, immer größer. In diesem Wandel von der bürgerlichen zur fürstlichen Stadt bestimmte der Stadtherr immer mehr die städtische Politik und auch die Zusammensetzung des Inneren Rats. Neue Familien strebten nach oben, die aber nie mehr das Ansehen der alten ratsfähigen Familien erlangen konnten, auch wenn im 17. Jahrhundert der Adelsbrief für die Mitglieder des Inneren Rats fast selbstverständlich geworden war.
1672 verlieh der Kurfürst erstmals ein Patriziatsdiplom, ähnlich dem Adelsdiplom. Die Aufnahme in das Patriziat war damit den Geschlechtern entzogen und Sache des Stadt- und Landesherrn, das Patriziat nur noch bloße Form. Sogar an Personen, die mit dem Bürgertum nichts mehr verband und denen es nur um die damit verbundenen Standesrechte ging, wurde das Patriziat verliehen. Im Grunde hatte das Patriziat am Ende nurmehr die Qualität eines Ehrentitels.
Das Bayerische Adelsedikt von 1808 und die Gemeindeordnung von 1818 kennen schließlich kein Patriziat mehr.
Entstehung der Münchner Ratsverfassung (bis 1403)
Die Entstehung einer städtischen Ratsverfassung und der Herausbildung einer Oberschicht innerhalb der bürgerlichen Gemeinschaft wird erst ca. 100 Jahre nach der urkundlichen Erstnennung Münchens von 1158, damals nur als Markt (forum Munichen), greifbar. München entwickelte sich erst nach 1180, als die Wittelsbacher mit dem Herzogtum Bayern belehnt worden waren, zu einer größeren Stadt. Im Jahr 1209 wird München noch als „burgus“ (Siedlung) bezeichnet, um 1215 taucht erstmals der üblicherweise für Bischofsstädte verwendete Begriff „civitas“ (Bürgergemeinde) in den Quellen auf. Nach der Teilung des Herzogtums im Jahr 1255 nahm Herzog Ludwig der Strenge in München seinen dauerhaften Wohnsitz. Damit wurde München zur Haupt- und Residenzstadt des oberbayerischen Teilherzogtums.
Von den etwa 2000 mittelalterlichen Urkunden im Stadtarchiv München datiert die älteste von 1265, ein Freiheitsbrief des Herzogs für München. Der Münchner Rat wird erstmals in einer Urkunde von 1286 genannt (consules civitatis Monacensis). Im ältesten überlieferten Stadtrecht von 1294, dem Rudolfinum, ist der Rat bereits zentrale Behörde der Stadt und im Besitz der Satzungsautonomie, der Polizei- und niederen Gerichtsgewalt. Das Rudolfinum hat zwar die Form eines Privilegs und einer fürstlichen Verleihung, gilt aber als Magna Charta der patrizischen Herrschaftsform.
Der Rat ging im Laufe des 13. Jahrhunderts in einer offenbar ruhigen Entwicklung und ohne große Auseinandersetzungen zwischen Stadtherrn und Bürgerschaft aus einer kleinen gehobenen Schicht hervor, die seit längerem bei Gerichtsverhandlungen und anderen wichtigen Anlässen in Erscheinung trat.
Zahl und Namen von Stadträten werden erstmals in einer Urkunde von 1295 überliefert. Diese Vereinbarung zwischen dem Rat und dem Kloster Scheyern enthält in der Zeugenreihe die ersten zwölf namentlich bekannten Mitglieder des Rats. Elf dieser zwölf Namen sind auch im Tiroler Handel nachweisbar, d.h. sie tauchen namentlich in den Tiroler Raitbüchern auf, den ältesten überlieferten Rechnungsbüchern der Jahre 1288 bis 1370. Das ist und blieb ein Kennzeichen des Münchner Patriziats: Er ging aus dem Handel hervor und hat sein Vermögen aus dem Handel erworben. Einige dieser zwölf Familien sind schon früher in Münchner Quellen belegt, wie z.B. die Schrenck (seit 1269). Die Schrenck, später als bayerisches Adelsgeschlecht in die Linien Notzing und Egmating gespalten, ist übrigens als einzige Familie des Münchner Altpatriziats heute noch nicht erloschen.
Die Patriziergeschlechter hatten also schon früh wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich die Führung der Stadt inne. Vor allem die zwölf Sitze des (später so genannten) Inneren Rats hatten sie teils jahrhundertelang inne. Die Bart waren seit dem 13. Jahrhundert 452 Jahre im Inneren Rat vertreten, die Ligsalz 438 Jahre, die Ridler 412 Jahre, die Schrenck 330 Jahre.
Das Anwachsen der Geschäfte und die Forderung breiterer Schichten der Bevölkerung nach Anteil am Stadtregiment führten zur Schaffung eines zweiten und sogar dritten Kollegiums. Neben den Zwölferrat, später als Innerer Rat bezeichnet, treten ein Äußerer Rat mit 24 Mitgliedern und die Gemain als Gemeindevertretung. Kontinuierlich ist ein Äußerer Rat erst seit 1362 eindeutig aus den Quellen belegbar. Auch die Gemeindevertretung, nun Großer Rat genannt, wird ab 1362 häufig namentlich genannt, verliert sich später aber wieder. Ab 1362 ist die Dreiteilung des Stadtregiments festgeschrieben.
Sehr früh kristallisiert sich für die beiden Ratsgremien je ein Redner (locutus ist die Bezeichnung im ältesten Ratssatzungsbuch von 1310/12) als Vorsitzender heraus. Erstmals am 22. Mai 1363 fällt in einer Ratsentscheidung (ein Bürger, der sich weigert, das Bürgermeisteramt zu übernehmen, muss die hohe Summe von 100 Pfund Pfennigen bezahlen) die Amtsbezeichnung pürgermaister.
Die führende Rolle der wenigen herrschenden Geschlechter in München beim Stadtregiment war nicht immer unumstritten. Mehrmals gab es deshalb im 14. Jahrhundert Unruhen, von 1397 bis 1403 sogar einen Bürgerkrieg. Viele Mitglieder des Inneren Rats und ihre Familien wurden zeitweilig aus der Stadt vertrieben, darunter Bartholomäus Schrenck oder Jörg Kazmair, vom dem die einzig erhaltenen chronikalischen Aufzeichnungen Münchens stammen. Der Versuch, ein Ratsregiment der Zünfte zu errichten, scheiterte jedoch. Viele vertriebene Ratsherren kehrten rehabilitiert zurück. Das Ratswahlgesetz vom 21. August 1403, gemeinschaftlich von den Herzögen Ernst und Ludwig, vom Rat und der Bürgerschaft erlassen, sicherte die Regierungs- und Gerichtsgewalt des Inneren Rates, und damit die Vorherrschaft der alten Geschlechter.
Die Ratsverfassung nach 1403 (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts)
Das Ratswahlgesetz von 1403 blieb mit gewissen Modifikationen in den Jahren 1767 und 1795 bis 1803 in Kraft. Nach diesem Gesetz bestand der Münchner Rat aus zwei Kollegien, eben einem Inneren und einem Äußeren Rat. Der Innere Rat war der eigentliche Träger der Regierungsgewalt. 1403 wurde die Zahl der Inneren Räte endgültig auf zwölf festgesetzt. Ein eng verflochtener, freilich nicht völlig geschlossener Familienkreis reicher Handelsleute, Unternehmer, Bankiers und Großgrundbesitzer war hier tonangebend – eben die später Patrizier genannten Familien.
Der Äußere Rat, seit 1403 endgültig auf 24 Mitglieder festgelegt und ursprünglich vielleicht nur als beratendes Gremium für den Inneren Rat gedacht, entwickelte sich im 14. Jahrhundert zu einem überwachenden und auch mitbeschließenden Kollegium. Seit 1403 war er integrierender Bestandteil des Gesamtrates, ohne dessen Mitwirkung der Innere Rat die Regierungsgeschäfte nicht wahrnehmen konnte. Er bestand teils aus jüngeren Angehörigen der vornehmen Familien, die später in den Inneren Rat aufsteigen konnten oder wollten, teils aus wohlhabenden Kaufleuten und Grundbesitzern niedrigerer Herkunft sowie aus angesehenen und wohlhabenden Handwerkern.
Die Gemain war grundsätzlich die Gemeinschaft aller Haus- und Grundbesitzer der Stadt, aus deren Mitte für eingehende Besprechungen mit dem Rat ein Ausschuss von 36 Mann gewählt werden konnte.
Das Verfassungsgrundgesetz von 1403 regelte auch die jährliche Neuwahl des Rats, die zwischen dem 20. Dezember und dem 6. Januar stattzufinden hatte. Danach sollte es drei Wähler für den Inneren Rat geben, die wie folgt ausgewählt wurden: Der Äußere Rat bestimmte ein Mitglied aus dem Inneren Rat, und der Innere Rat bestimmte je einen Wähler aus dem Äußeren Rat und der Gemain. Die neugewählten 12 Mitglieder des Inneren Rats legten vor dem Herzog, dem Stadtherrn, den Eid ab, der damit die Wahl formal bestätigte. Danach wählte der Innere Rat die 24 Mitglieder des Äußeren Rats, wobei die drei Wähler als gesetzt gelten. Allein der Wahlvorgang zeigte schon, wer in München das Sagen hatte!
Für das 15. Jahrhundert ist es bezeichnend, dass die Bürgermeister nur primi inter pares sind. Die zwölf Mitglieder des Inneren Rats teilen sich das Bürgermeisteramt im monatlichen Wechsel. Im Äußeren Rat wird es ebenso gehalten, jedoch müssen von den 24 Mitgliedern zwölf Bürgermeister ausgewählt werden. Im monatlichen Wechsel amtierten jeweils zwei Bürgermeister, je einer vom Inneren und vom Äußeren Rat. So fungierten alle zwölf Inneren Räte und die Hälfte der Äußeren Räte einen Monat als Amtsbürgermeister.
Im Jahr 1479 mischte sich Herzog Albrecht IV. erstmals nachweisbar in eine Ratswahl ein, als er einem gewählten Mitglied des Inneren Rats, Balthasar Pötschner, die Bestätigung verweigerte und ihn durch einen anderen ersetzen ließ, Heinrich Barth. Solch ein Eingriff in die Autonomie des Gemeinwesens wiederholte sich in den Jahren 1499 und 1515. Diese Eingriffe waren symptomatisch für das nun stärkere politische Auftreten des Stadtherren gegenüber der Münchner Bürgerschaft.
Andererseits hatte deren Führungsschicht, das den Inneren Rat stellende Patriziat aber auch selbst gegen Ende des 15. Jahrhunderts einen Wandel vollzogen, aus dem sie politisch geschwächt hervorgingen. Einige Familien, die teils jahrzehnte-, ja jahrhundertelang im Stadtrat saßen oder wichtige Ämter innehatten, starben aus – wie die Sendlinger, die Astaler (beide 1475), die Tulbeck (1476), die Gießer (1494) und die Tömlinger (1519). In der Zwischenzeit rückten andere Familien durch Einheirat, durch Gelderwerb und Leistung von unten nach, wie die Eßwurm, Hundertpfund, Scharfzahn, Rosenbusch, Fleckhamer, Weiler, Gienger, Reitmor, Gaishofer und Stockhamer. Allerdings – weiter als bis in den Äußeren Rat gelangen sie zunächst nicht. Im Jahr 1500 findet man im Inneren Rat nur einen einzigen dieser neuen Namen: Stockhamer. Die Namen der übrigen elf Mitglieder hätten ebenso auch schon 150 Jahre früher eine Ratsliste bilden können: Stupf, Schrenck, zwei Schluder, Wilbrecht, zwei Ridler, Barth, Rudolf, Kazmair, Ligsalz.
Ein anderes Phänomen war aber viel entscheidender für die Schwächung des Patriziats: der Rückzug von Ratsfamilien aus der Stadt aufs Land. Schon seit dem 13. Jahrhundert hatten die Patrizier ihr Geld in ländlichem Grundbesitz angelegt, in Erwerb von Edelsitzen und Hofmarken, wodurch sie auch das Recht der niederen Gerichtsbarkeit erhielten. Bis um 1500 besaßen alle alten, ratsfähigen Familien ihren Landsitz. Die Eintragungen in den Kammerrechnungen der Stadt über die Ausgaben von Botenlöhnen zur Benachrichtigung von Stadträten auf ihren Landgütern häufen sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts, selbst zur Stadtratswahl mussten einige Herren eigens zitiert werden.
Die Pütrich gaben um 1500 das Bürgerrecht ganz auf und verließen die Stadt endgültig. Andere Familien folgten diesem Beispiel und übernahmen Ämter draußen auf dem Land aus der Hand des Landesherrn. Dies gab zwar neuen Kräften, die aus niedrigeren Schichten (Handwerker) nach oben drängten oder die von außen zuwanderten, die Möglichkeit nachzustoßen. Allerdings konnten diese neuen Familien nicht mehr das Ansehen gewinnen, das die alten hatten.
Eine wesentliche Änderung im monatlichen Wechsel des Bürgermeisteramtes tritt erst im 16. Jahrhundert ein, als der Landesherr einen noch größeren Einfluss auf die Ratsführung zu gewinnen sucht. 1523 gab es im Inneren Rat erstmals nur noch sechs Bürgermeister, die das Amt jetzt zwei Monate innehatten. Diese Regelung mit sechs Bürgermeistern, deren Ernennung sich der Landesherr nun ausdrücklich vorbehält, setzte sich um 1600 in München ganz durch. Auch für die Bürgermeister des Äußeren Rat, der sich nun überwiegend aus Vertretern des Handels und des Handwerks zusammensetzt, setzte sich die zweimonatige Amtszeit durch, so dass in bestimmten Monaten oft dieselben Bürgermeisterpaare zusammen amtierten.
Auch in der Verwaltung der Stadt selbst, hatte der landesherrliche Einfluss seit dem Ende des 16. Jahrhunderts spürbar zugenommen. Seit 1592 wurde die Ratswahl durch Wilhelm V. nicht mehr lediglich bestätigt, sondern wurden die Bürgermeister der Stadt regelmäßig durch den Herzog ernannt. Herzog Maximilian I. behielt sich diese Maßnahme 1601 noch einmal ausdrücklich vor. Die höchsten Repräsentanten der Stadt waren damit zu herzoglichen Beamten geworden.
Bereits kurz nach der Übernahme der alleinigen Regierungsgewalt forderte Herzog Maximilian 1598 die Originalurkunden der städtischen Privilegien zur Überprüfung ein und machte damit deutlich, dass alle Rechte, die die Stadt besaß, unter dem Vorbehalt landesherrlicher Zustimmung standen. 1599 ordnete er sogar die Überprüfung der Münchner Handwerksordnungen an und beanspruchte damit die Mitsprache in einem Bereich, der bisher unangefochten der kommunalen Rechtsetzung unterstellt gewesen war.
Äußeres Symbol für die kurfürstliche Dominanz in der Haupt- und Residenzstadt München wurde die 1638 geweihte Mariensäule. Kurfürst Maximilian ließ sie in Erfüllung eines Gelübdes unter Verletzung städtischer Privilegien demonstrativ auf dem zentralen Platz der Bürgergemeinde München, dem heutigen Marienplatz, errichten.
Die Aushöhlung des Stadtrechts und der bürgerlichen Eigenständigkeit gelang auch durch eine Flut landesherrlicher Mandate, die die Lebensführung der Untertanen unter der Prämisse der ausschließlichen Katholizität bis ins Detail reglementierte. So bestrafte der Kurfürst 1624 die Ratsherren des Inneren Rats wegen Vernachlässigung der wöchentlichen Donnerstagsprozession mit einer demütigenden Geldstrafe.
Viel Widerstand gegen diese landesherrlichen Eingriffe war vom Münchner Patriziat nicht zu erwarten. Die führenden Repräsentanten der Bürgerstadt München fühlten sich im 17. Jahrhundert schon eher als Teil der höfischen Sphäre und zeigten sich daher gar nicht mehr an der Förderung einer eigenständigen bürgerlich-städtischen Kultur interessiert. Der Einsatz für das bürgerliche Gemeinwesen erschien dagegen kaum noch erstrebenswert.
Unter Kurfürst Max Emanuel (1679–1726) wurden in München zusätzlich zu den sechs sich alle zwei Monate im Rotationsprinzip ablösenden Bürgermeistern an Vertrauensleute des Landesherrn das Amt eines 7. und 8. Bürgermeisters im Inneren Rat vergeben, also ein weiterer Machtverlust der bürgerlichen Oberschicht. Die Kluft zwischen Innerem und Äußerem Rat wurde nicht zuletzt durch die soziologische Zusammensetzung seiner Mitglieder immer größer. Im 18. Jahrhundert kam es zu Unruhen, so dass am 18. Dezember 1767 die Wahlordnung von 1403 von Kurfürst Max III. Joseph erstmals in Teilen revidiert wurde. Dabei wurde die Position des Äußeren Rats gestärkt, der Bürgergemeinde wurden jedoch nur belanglose Zugeständnisse gemacht.
Durch den von Kurfürst Karl Theodor erlassenen Wahlbrief vom 1. Dezember 1795 wurde die Ratswahlordnung erneut revidiert und der Einfluss des Inneren Rats noch weiter zurück gedrängt. Nunmehr bestimmen nicht mehr wie seit 1403 drei Wahlmänner den Innern Rat, sondern 72 Vertreter der Zünfte, die damit das erste und einzige Mal in ihrer Geschichte auch verfassungsrechtlich in Erscheinung traten. Diese 72 Zunftvertreter wählten aus ihren Reihen 36 Wahlmänner, die dem Landesherrn und nicht dem Magistrat eidlich verpflichtet waren. Diese 36 Repräsentanten der Bürgerschaft wählten die 24 Mitglieder des Äußeren Rats. Die 24 Äußeren Räte und die 36 Ausschüsser wählten dann die zwölf Inneren Räte, bei denen „ceteris paribus aber allerdings auf Adel und Patriziat gesehen werden“ konnte.
Mit den Reformen des bayerischen Ministers Montgelas, die 1804 zur Schaffung eines einzigen Magistratskollegium anstelle des früheren Inneren und Äußeren Rates führte, ging für die Stadt München eine jahrhundertelange Ära zu Ende. Der Magistrat der Stadt München war zudem seit der Konstitution des Königreichs Bayern von 1808 und bis zur Verfassung von 1818 unter staatliche Kuratel gestellt.
Zusammenfassende Bemerkungen zum Wesen des Münchner Patriziats und seinem Wandel
Qualifikation für das Patriziat und ständische Abgrenzung: Bis weit in das 16. Jahrhundert hinein diente die Wahl in den Inneren Rat als Qualifikation für das Patriziat. Seit Ende des 15. Jahrhunderts ist das Streben nach Bestätigung im Adelsbrief nachweisbar. Es folgte im 16. Jahrhundert eine ständische Abgrenzung als Die Geschlechter oder Das Geschlecht. Im Implerhaus am Marienplatz gab es nun neben der Bürgertrinkstube eine gesonderte Herren- oder Geschlechterstube.
Ein erster Angriff auf den Adels-Status der bürgerlichen Oberschicht erfolgte um 1570, als Herzog Albrecht V. den Geschlechtern der Stadt das kleine Waidwerk streitig machte. 1578 versuchten die Münchner Geschlechter mit einer Supplication hinsichtlich der Kleidung und der Strafe bei Ehebruch dem Adel gleichgestellt zu werden – allerdings vergeblich.
Auch unter Herzog bzw. Kurfürst Maximilian wird eine strenge Abgrenzung des Adels vom Patriziat betrieben. Im Gegenzug werden aber immer mehr Mitglieder des Inneren Rats – aus fürstlichen Gnaden – in den Adelsstand erhoben und auch mit zusätzlichen Hofämtern betraut. Und so ist im 17. Jahrhundert der Adelsbrief für die Mitglieder des Inneren Rats fast selbstverständlich. Deshalb beanspruchten sie auch den Titel Edelgeboren, so in einem Schreiben vom 4. Februar 1789: „Es ist nicht Stolz oder Eigenliebe, welche uns auffordert, auf dieses Prädikat zu dringen, sondern ein Vorrecht, welches von jeher der hiesige Magistrat zu genießen die Ehre hatte, daß nämlich die Mitglieder des inneren Ratsgremii oder von adelichen Familien abstammen, oder sich des Diploma Nobilitatis zu erwirken bemüssiget sind.“
Bedeutung des Patriziats im späten Mittelalter: Größte Bedeutung hatte das Münchner Patriziat jedoch nicht am Ende des 18. Jahrhunderts, in der Zeit als es quasi dem Adel gleichgestellt war, sondern im späten Mittelalter, im 15. Jahrhundert, als München ihm die die größte Entfaltung seines bürgerlichen Lebens verdankte.
Auch wenn das Münchner Patriziat nie die Bedeutung des einstigen reichsstädtischen Patriziats, etwa Regensburgs, Augsburgs oder Nürnbergs, erreichte, regierte es die Stadt mehrere Jahrhunderte lang nahezu selbstverantwortlich. Die ratsfähigen Geschlechter traten als Stifter und Wohltäter hervor. Zahllos waren die Stiftungen an das Heiliggeistspital, die Mess- und Altarstiftungen an Kirchen und Kapellen und die Beiträge zur künstlerischen Ausgestaltung der Kirchen.
Schon früh zogen Herzöge Münchner Bürger an ihren Hof: 1294 Philipp Freimanner als Kanzler des Pfalzgrafen Rudolf (reg. 1294–1317), Jakob Freimanner 1346 als Hofmeister von Herzog Johann II. (reg. 1375-1397), Ulrich Pötschner 1390/94 als Landschreiber (Kanzler) von Oberbayern. Im 15. Jahrhundert sind sie häufig als herzogliche Räte nachgewiesen, so Lorenz (gest. 1460) und Bartlme Schrenck (gest. 1518/19), den Albrecht IV. 1508 auch in die Vormundschaftsregierung für Wilhelm IV. (reg. 1508–1550) berief.
Finanz- und Steuerkraft: Für die Zugehörigkeit zum Patriziat war immer eine gesicherte Finanz- und Steuerkraft von Bedeutung. Alle frühen Münchner Rats- und Patrizierfamilien waren im Fern- und Großhandel tätig, im Handel mit Tuch- und Eisenwaren, Salz und Wein, im Bergbau und Bankenwesen.
Auch die Familie Pütrich, die schon 1239 als Münchner Bürger nachgewiesen sind, war von Anfang an im Wein- und Salzhandel tätig. Nach und nach drangen die Pütrich auch in andere Handelszweige ein, weshalb sie bereits im 14. Jahrhundert als Großkaufleute unterschiedlicher Warengattungen zu den reichsten Münchner Familien zählten. Die Pütrich gehörten zusammen mit anderen Münchner Patrizierfamilien zu den größten Steuerzahlern.
Die Patrizier bildeten zwar nur 1 Prozent der Stadtbevölkerung, erbrachten aber 10-12 Prozent der gesamten Stadtsteuer. Reichtum war Voraussetzung, um die mit einem Ratssitz verbundenen zeitraubenden Ämter versehen zu können, die bis ins 16. Jahrhundert weitgehend Ehrenämter waren, also die Ämter der Bürgermeister, Kämmerer oder Steuerer, um nur einige zu nennen.
Besitz auf dem Land – Annäherung an den Adel: Seit dem 13. Jahrhundert legten die Patrizier das erworbene Vermögen in Haus- und Grundbesitz in und außerhalb der Stadt an. Ganze Hofmarken, mit denen neben den grundherrlichen Einkünften auch Hoheitsrechte, später sogar die Landstandschaft, verbunden waren, kamen in die Hand Münchner Patrizier. Gelegentlich konnten sie unmittelbar in den Ritterstand überwechseln, wie die Pütrich von Reichertshausen oder wie Balthasar Pötschner, den sein Grabstein von 1505 in St. Peter als miles bezeichnet.
Hier nur ein paar wenige ausgewählte Beispiele für die erworbenen Besitztümer und Hofmarken rings um München: Bereits 1273 hatten die Bart Besitz zu Kempfenhausen, 1360 zu Harmating; 1334 erwarb ein Pütrich die Veste Reichertshausen; 1369 Hans Katzmair den Wörthsee, wo die Familie später ein Schloss errichtete; 1399 kam Matheis Sendlinger an Schloss Pähl mit Zubehör, 1410 an Sulzemoos; Michael Schrenck nannte sich seit 1404 von Notzing. Als 1469 Hans und Karl Ligsalz Ascholding erwerben konnten und als Nachzügler ein Rudolf 1496 auf Nannhofen saß, hatten alle alten Ratsfamilien noch vor 1500 ihren Landsitz.
Die vermögende Münchner Familie Weiler konnte den seit 1494 gehaltenen Ansitz Garatshausen am Starnberger See (mit den Dörfern Feldafing, Weiling und Haushofen) 1565, also eine Generation später, in eine Hofmark umwandeln, wodurch die Familie Weiler dort auch die Niedergerichtsbarkeit ausübte. Diese Gerichtshoheit galt als besonders wichtiges Privileg, das die Ebenbürtigkeit mit dem Landadel unterstrich. Die Weiler zu Garatshausen starben 1707 im Mannesstamm aus.
Heiratskreis: Die Geschlechter, vertreten im Inneren Rat, bildeten auch in München einen weitgehend geschlossenen Heiratskreis. Jedoch war hier die ständische Geschlossenheit und Exklusivität nie so groß wie z. B. in Nürnberg. Immer wieder konnten in München reiche Bürger durch Einheirat in das Patriziat und in den Inneren Rat gelangen, wenngleich auch hier die Neigung groß war, sich als eigener Geburtsstand abzuschließen. Heiratsverbindungen mit dem Reichspatriziat von Regensburg, Nürnberg und Augsburg waren nicht selten, ebenso mit dem Landadel schon im 14. Jahrhundert.
„Entbürgerlichung“: Bürgerlicher Lebensstil, sogar das Bürgerrecht wurden in der Frühen Neuzeit aufgegeben, um die Ebenbürtigkeit mit dem Adel nicht zu verlieren. Schließlich erfolgte ein völliger Übertritt in den Landadel. Patrizier traten immer mehr in den Hofdienst ein und strebten nach herzoglichen Rats- und höchsten Staatsstellen. Drei alte Patrizierfamilien (Ligsalz, Bart, Ridler) erreichten schließlich 1626 die Gleichstellung mit dem Adel in der Kleiderordnung.
Die fortschreitende Abnahme der Geschlechter führte um 1600 zu Engpässen bei der Besetzung der Sitze des Patriziats im Inneren Rat und zu außerordentlicher Ämterhäufung. Von den zwölf Inneren Räten stellten 1606 je drei die Familien Bart und Ligsalz, 1636 vier die Ligsalz und zwei die Hörl, dazu die Hörl noch einen Äußeren Rat. Der Ratssitz war mittlerweile lebenslänglich und nahezu erblich, die Ratswahl eine Formsache. Von 1635 bis 1790 hatten insgesamt zwölf Innere-Rats-Familien nicht einmal mehr ein Haus in der Stadt.
Erbliches Patriziatsdiplom: 1672 verlieh Kurfürst Ferdinand Maria erstmals ein erbliches Patriziatsdiplom, ähnlich dem Adelsdiplom. Der Begünstigte war der Handelsmann und Hoflieferant Georg Gugler (von und zu Zeilhofen), von 1666 bis 1669 Innerer Rat. Durch den Druck der wittelsbachischen Landes- und Stadtherren gelangten auch neue Familien mit Migrationshintergrund (wie man heute sagen würde), die zunächst am Hofe tätig waren (und damit dem Hofrecht unterstanden und nicht der städtischen Jurisdiktion) erst zu Bürgerrecht, teilweise in den Adelsstand und in den Inneren Rat. Aus diesen Kreisen erhielten folgende Personen ein Patrizierdiplom: Matthias Barbier (1673); Maximilian von Alberti (1694); Max Joseph Vacchieri (1715); Josef Philipp Jovi (1730); Michael Cler (1773).
Die Aufnahme in das Patriziat war damit den Geschlechtern entzogen und Sache des Landesherrn, das Patriziat nur noch bloße Form. Die Stadt wurde von den Standeserhöhungen nur noch per Schreiben informiert. Sogar an Personen, die mit dem Bürgertum nichts mehr verband und denen es nur um die damit verbundenen Standesrechte ging, wurde das Patriziat verliehen: so 1789 dem Medizinalrat und kurfürstlichen Leibarzt Anton Leutner, 1792 dem Medizinalrat und kurfürstlichen Leibarzt Anton von Winter (in seinem Diplom ist explizit vom „Ehrentitel eines hiesigen Patriciats“ die Rede); und 1795 dem Beichtvater der Kurfürstin Maria Leopoldine, Anton Rossi. Als Letztem wurde im Jahr 1800 dem Geistlichen und Historiker Lorenz Westenrieder (1748–1829) diese Würde verliehen, die ihm aber lediglich den Weg zu einem Kanonikat am Kollegiatstift von Unserer Lieben Frau ebnen sollte.
Bei dieser schleichenden Sinnentleerung des Patriziats ist es kein Wunder, dass die im Königreich Bayern neu erlassenen Adelsedikte von 1808 bzw. 1818 mit ihren sechs bzw. fünf Klassen kein Patriziat mehr kennen.
Und auch die neue Gemeindeordnung von 1818, die Bestandteil der Verfassung von 1818 wurde, kennt kein Patriziat mehr, operiert aber weiter. mit den traditionellen Gremienzahlen. Nun gab es ein Zweikammer-System, auf der einen Seite der Magistrat mit zwei Bürgermeistern (einer davon musste rechtskundig sein), vier rechtskundigen und 12 bürgerlichen Räten, auf der anderen Seite als Kontrollorgan das 36köpfige Kollegium der Gemeindebevollmächtigten.
Interessante Figur des Übergangs (vom Bürgertum zum Adel und dann wieder zum Bürgertum) ist Franz de Paula von Mittermayr (1766-1836), Sohn eines Münchner Bürgers und Hofmetzgers. Nach seinem erfolgreich absolvierten Jurastudium wird er von Kurfürst Karl Theodor 1791 in den Innerer Rat berufen und am 1792 in den Reichsadelsstand erhoben. Er wurde 1818 zum ersten Bürgermeister gewählt. Er hatte während der vielen Umbrüche in der Montgelas-Zeit große politische Überlebenskunst bewiesen; sogar in der kritischen Übergangszeit vor 1818, als es in München keinen Magistrat mehr gab, fungierte er als Kommunaladministrator. Mittermayr blieb von 1818 bis zu seinem Tod 1836 Bürgermeister von München.
Epilog: Die Familie Destouches
Und es gibt noch eine ähnliche Verbindung vom 18. ins 19. Jahrhundert, wie mein kleiner Epilog auf die Familie meines Vorgängers als Münchner Stadtarchivar Ernst von Destouches (1843–1916) zeigt.
Sein Großvater Joseph Anton Destouches (1767–1832) war nach Abschluss seines Jurastudiums in Ingolstadt 1786 ebenfalls in den Inneren Rat der Stadt München gewählt worden. Danach bat er selber um die Verleihung des Patriziats, was ihm Kurfürst Karl Theodor am 23. April 1787 auch gewährte. Das aufwendig gestaltete Diplom in Form eines Libells mit neun Pergamentseiten in Samteinband und großem Wachssiegel in Metallkapsel führt als Begründung an, „daß allhier in München Stadt-Gebrauch sey, daß die angestelten innere Räthe entweders geadelt seyn, oder wenigsten um einen solchen Caractère sich bewerben sollen, der den geadelten allerdings gleich kömt.“ Und so erhält Destouches die besondere kurfürstliche Gnade, „daß er und seine Deszendenz mann- und weiblichen Geschlechts für Patritios oder hiesiger Stadt-Geschlechtern erkläret“.
Obwohl eine Aufnahme in den Adel mit diesem Diplom nicht verbunden war und spätere Gesuche von Joseph Anton Destouches darum auch abgelehnt wurden, führten er und seine Nachkommen seither das „von“ im Namen. Erst seinem Enkel, dem Historiker, Archivar und Stadtchronisten Ernst von Destouches gelang es dennoch am 25. Januar 1868 in die Adelsmatrikel aufgenommen zu werden.
Salbungsvoll bedankte sich Ernst von Destouches, der nun endlich sein „von“ zu Recht trug, bei König Ludwig II.: „Hoch auf atmet jetzt meine Brust, nachdem meine ganze Jugend wie ein Alp auf mir gelastet, und wie ein Schatten auf meinem Leben gelagert, daß ich dem Vorrechte entsagen mußte, dessen meine Voreltern alle im besten Glauben sich bedient haben. Und es war das gewiß nicht eitle Ehrfurcht von mir, denn nur zu sehr wurzelt die Überzeugung in meinem Innern, daß wahrer Adel nur der sei, der auch mit jenem des Geistes und des Herzens und der Gesinnung verbunden erscheint.“