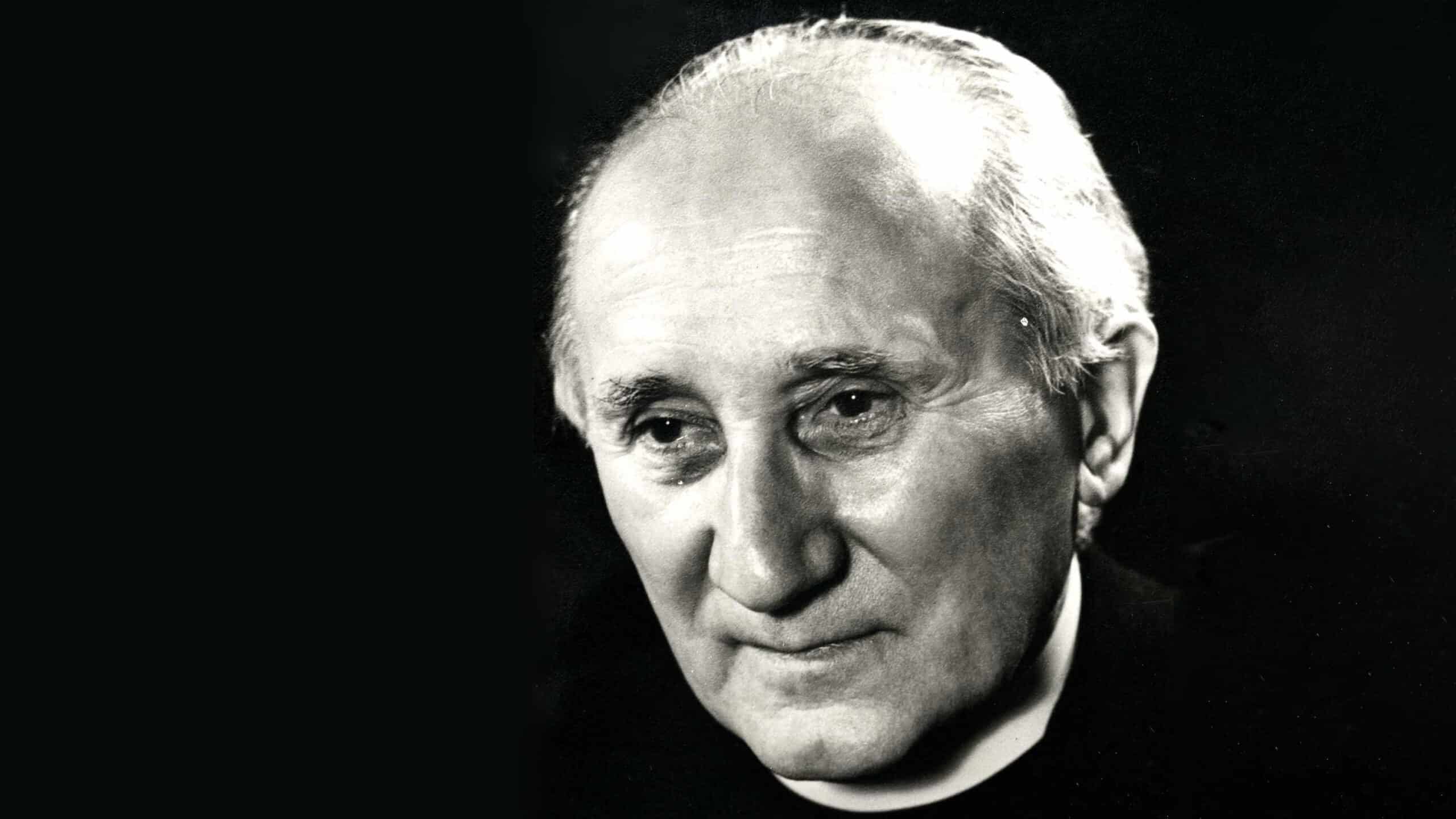Liebe Schwestern und Brüder,
in den autobiographischen Skizzen Romano Guardinis‘ ist mir ein Bericht immer wieder aufgefallen: Als er zum Domvikar in Mainz ernannt wird, trifft er vor dem Mainzer Dom einen Mitbruder. Der Mitbruder sagt zu ihm: Was ist jetzt deine neue Aufgabe? – Domvikar. – Da sagt er, schau einmal ganz oben auf den Turm. Siehst du den Hahn auf dem Turm des Doms? – Ja, sehe ich. – Siehst du, was auf dem Hahn geschrieben steht? – Nein, das sehe ich nicht. – Dort steht: „Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate!“ – „Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.“ Das ist ein Satz aus Dantes „Göttlicher Komödie“ beim Eintritt in die Hölle. Diese kleine Anekdote, die Guardini berichtet, lässt tief blicken: Einmal auf einen gewissen ironischen Umgang des Klerus mit sich selbst. Aber auch darauf, was Romano Guardini empfunden hat, als er diese kleine Geschichte in seine Skizzen aufnahm: auf sein Leiden an der Kirche, sein Leiden am Klerikalismus, an der Selbstherrlichkeit. All das, was damit verbunden ist, hat ihn tief bewegt. Der Blick auf die Kirche war für Guardini immer auch ein Blick auf die große Berufung der Kirche. Aber das Leiden an der Realität der Kirche war unübersehbar, und das hat sich durch sein Leben hindurchgezogen.
Wir sehen es immer wieder, wenn wir in die Geschichte und die Gegenwart hineinschauen, dass die Gefahr groß ist, dass die Kirche nicht den Weg eröffnet, nicht den Blick weitet und alle Herzen der Menschen auf Ihn, Christus, zubewegt, sondern selbst zum Thema wird, zum Hindernis wird, zur Mauer wird, zu einer Verhinderung des Glaubens und eben nicht zu einer Hinführung. Beides ist in der Geschichte der Kirche da. Romano Guardini hat sehr genau gesehen, was zur Geschichte der Kirche gehört, und was auch verändert werden muss. Was wir im Matthäus-Evangelium gehört haben, ist ja eigentlich der Aufruf an die Kirche, an uns, an jeden einzelnen Christen, einzutreten in das Pascha-Mysterium. Der hl. Paulus sagt im Zweiten Korintherbrief: „Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird“ (2 Kor 4,10). Obwohl wir leben, sterben wir jeden Tag um Jesu willen.
Das ist im Grunde eine Beschreibung des Pascha-Mysteriums, der Oster-Katechese: Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer sein Leben verliert, wird es retten. Immer geht es um diese Fragen, ob der Mensch sich auf den Weg macht, wie Christus zu werden, ein neuer Christus, eine neue Schöpfung, die sich öffnet, die sich aufmacht, die in der Liebe lebt, oder ob es der alte Adam ist, der uns beherrscht, der um sich selbst kreist, obsiegen will um jeden Preis, alles für sich haben will, selbstherrlich, arrogant, mächtig, stark, zahlenmäßig, finanziell, wie auch immer. Der alte Adam ist nicht der Weg der Kirche, aber er setzt sich oft durch bei uns selbst, bei jedem einzelnen von uns und auch in der Kirche.
Das war Romano Guardini klar. Deswegen ruft er auch in seinen Schriften auf, von diesem Bild Abschied zu nehmen und es immer wieder zu korrigieren und einzutreten in das Pascha-Mysterium. Wie wichtig war ihm dieser Satz, worin er das Evangelium nahezu wörtlich übersetzt: „Wer seine Seele [die „psyche“] festhält, wird sie verlieren; wer sie aber hergibt, wird sie gewinnen.“ Nur wer bereit ist, einzutreten in die Hingabebereitschaft Jesu, kann eigentlich eintreten in das große Geheimnis von Tod und Auferstehung. Den Weg müssen wir immer wieder von neuem gehen, nicht nur einzelne, sondern wir alle und auch die Institution der Kirche. Alle Institutionen, alles, was die Kirche tut, muss dem Ziel unterworfen sein, dem Evangelium Raum zu geben, dem Evangelium vom Tod und der Auferstehung Jesu, dem Evangelium vom Reich Gottes. Was ein Hindernis ist, muss weggeräumt werden, immer wieder aufs Neue, durch alle Geschichtsepochen hindurch.
Das war die klare Sicht von Romano Guardini; das hat er gesehen. In diesem Sinne verstehe ich eigentlich auch sein berühmt gewordenes Wort: „die Kirche erwacht in den Seelen“ der Menschen. Ist das denn schon passiert? Ist das jemals abgeschlossen? Das war ein großer Satz, den wir im Studium so aufgegriffen haben, als sei das mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil erfüllt. Ist es wirklich erfüllt? Das würde bedeuten, dass eine neue Gestalt der Kirche entsteht, eine neue Gestalt, in der der Glaube wirklich von innen her gelebt wird, in allen Gläubigen, dass Taufe und Firmung uns befähigen, hineinzutreten in die große Gemeinschaft der Kirche, und selbst Kirche zu sein, nicht nur eine Kirche der Amtsträger. Da geht es auch um die Macht. Da geht es auch darum, wie miteinander geredet wird in der Kirche, wie füreinander gebetet wird in der Kirche, mit den unterschiedlichen Begabungen, aber dass alle Kirche sind und mit ihnen, in allen Herzen, Kirche lebendig wird.
Ich glaube, dieses Programm ist noch lange nicht abgeschlossen, bei einigen vielleicht noch gar nicht ernsthaft angegangen worden. Was das für die Gestalt der Kirche bedeutet, eine neue Gestalt der Kirche! Vielleicht merken wir das gerade in Krisensituationen neu. Deswegen ist Romano Guardini durchaus ein Theologe der jetzigen Zeitstunde, im Blick auf die Kirche, im Blick auf uns, im Blick darauf, was heute gefordert ist.
Kardinal Döpfner hat beim Requiem 1968 versucht zusammenzufassen, was er noch einmal angesichts des Todes dieses großen Mannes weitergeben wollte. Dabei nennt er als erstes: existenzieller Glaube. Ich bin der Überzeugung, auch das ist nicht abgeschlossen; im Gegenteil. Nicht nur eine neue Epoche der Kirche muss möglich werden, muss von uns versucht werden in der Kraft des Geistes, sondern auch eine neue Theologie, die den Menschen unmittelbar trifft, eine Theologie, die das Leben beleuchtet, wie es im Prolog des Johannesevangeliums heißt: „Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.“ (Joh 1,9)
Wo ein Glaube nicht existenziell gelebt werden kann, wo er theoretische Spekulation ist, leeres Katechismus-Wissen ohne Blut und Leben, wie kann das weitergetragen werden? Deswegen ist Romano Guardini über manche fachtheologischen Fragen hinweggegangen, so notwendig diese sind. Aber ihm ging es darum, den Glauben der Christen in ihr Leben hineinzustellen, so dass sie spüren: das ist Licht für mein Leben, existenzieller Glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Glaube der Christen wirklich eine Zukunft hat für viele, viele Menschen, wenn er nicht ihr Leben trifft, unmittelbar, und beleuchtet bzw. neue Möglichkeiten eröffnet in der Kraft des Glaubens. Deswegen hat Guardini Menschen aller Schichten angesprochen, nicht nur Theologiestudenten. Manche Fachkollegen haben gesagt: Der Guardini ist ein Essayist, ein theologischer Essayist. Nein, er hat mit den Menschen gedacht. Er wusste: Was nützt alle Theologie, wenn sie nicht mit dem Leben verbunden ist? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Zukunft der Kirche.
Und einen zweiten Gedanken nenne ich von Kardinal Döpfner aus seiner Predigt beim Requiem: brüderlicher Glaube. Vielleicht würde man heute sagen: Geschwisterlichkeit. Glaube, der eben nicht bedeutet, dass einige über den anderen stehen, sondern Glaube, der zusammenführt, nicht exklusiv ist, der die Wahrheit nicht verteidigt wie eine Zitadelle gegen Angriffe, gegen die Feinde, sondern, wie es Papst Franziskus auch sagt, der Glaube als eine Einladung an alle, mitzugehen, zu entdecken, Gemeinschaft zu werden, nicht nur ein Idyll, nicht nur ein Klub, sondern eine wirkliche communio, eine Gemeinschaft.
Und als drittes spricht Kardinal Döpfner vom redenden Glauben. Damals wurde auch der Abschnitt vorgelesen aus dem Zweiten Korintherbrief, den wir eben gehört haben: „Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet.“ (2 Kor 4,13) Ein Glaube, der ins Wort hinein will, das ist natürlich gerade bei Romano Guardini spürbar. Das Wort – mit dem er umgehen konnte, was die Menschen faszinierte; wir vermissen es häufig. Der Glaube muss ins Wort, aber in ein Wort, das verstanden wird. Es muss nicht einfach im Sinne einer Alltagssprache banal sein, es kann hochstehend sein, aber die Menschen spüren: schließt es mir etwas auf, kann ich in dieses Wort hineingehen? Oder ist es etwas, das mich außen vor lässt, weil es exklusiv ist, dieses Wort der Predigt, der Verkündigung? Das Leben der Kirche muss redender Glauben sein, aber eine Sprache, die sowohl öffnet wie auch Menschen ermöglicht, in diese Sprache hineinzufinden und zu verstehen, im tiefsten Sinne des Wortes.
Einen solchen Seligen braucht es für unsere Zeit. Deswegen bemühen wir uns um die Seligsprechung; wir wollen vieles dafür tun. Danke auch, dass die jungen Leute der Katholischen Romano Guardini-Fachoberschule der Stiftung Katholischer Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern heute da sind. Danke, dass ihr mit dabei seid und immer wieder auch auf den Namensgeber der Schule schaut, neu lernt, wer er für euch heute sein kann.
Wir alle, liebe Schwestern und Brüder, sind aufgerufen, diesen Prozess der Seligsprechung mit Gebeten mitzutragen. Aber am besten wäre, wir versuchen, auch seine Worte, die Worte Romano Guardinis, seine Texte, für heute neu zu lesen, nicht einfach nur im Rückblick. Ich glaube – das spüre ich immer wieder, wenn ich in seine Schriften hineinschaue -, dass seine Aktualität eher steigt, eher kräftiger wird. Das gibt mir Mut, auch für den Zukunftsweg der Kirche. Bitten wir den Herrn, dass er uns bald einen seligen Romano Guardini schenkt. Amen.