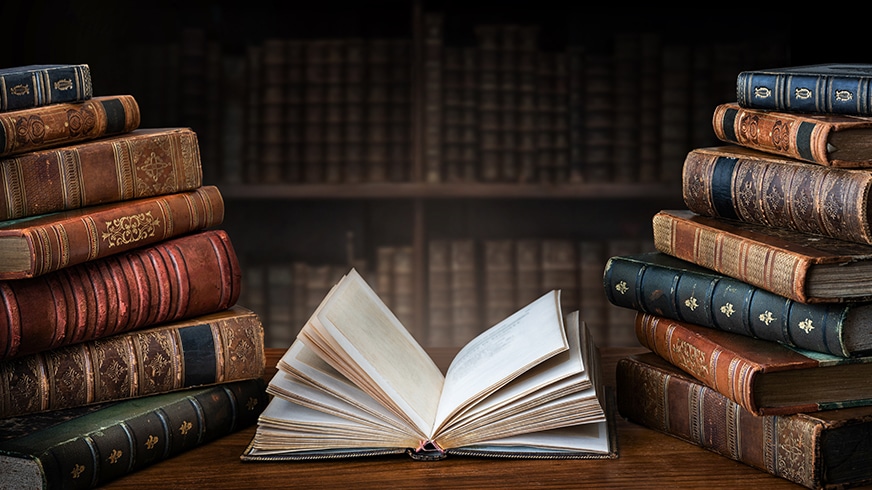Einleitung
Als christliche Heere 1212 die Muslime besiegten, organisierte der Toledaner Erzbischof Rodrigo die Vorbereitungen. Aber er ergriff auch als Historiograph die Feder, indem er mit einer Geschichte über Spanien oder die Goten (Historia de rebus Hispanie sive Historia Gothica) und mit einer Geschichte der Araber (Historia Arabum) aufwartete. Die Rückbesinnung auf gotische Zeiten stiftete Identität und eröffnete Zukunftsperspektiven. Nährte sich die spanische Einheit nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern immer wieder aus dem Blick auf die westgotische Zeit? Wurde hier der spanische Einheitsstaat vorgeprägt? Dann hätte das Thema sogar eine sehr aktuelle Bedeutung. Nicht alles hatte jedoch so zentralistisch begonnen.
Alarich und Theoderich, das sind klingende Namen. Aber welche Gotennamen stehen für das westgotische Reich? Leovigild, Recckared, Reccesvinth, Wamba, Witiza oder Roderich? Wer sich für Könige interessiert, kann aus den Statuen der „spanischen“ Könige auf der Plaza de Oriente vor dem Königsschloss in Madrid fünf Westgoten auswählen. Sie wurden zwischen 1750 und 1753 geschaffen und verdeutlichen, welch frühen Beginn man für die spanische Königsgeschichte im 18. Jahrhundert konstruierte. Im Folgenden geht es aber um die Bedeutung und die Errungenschaften des Westgotenreiches, die Spanien und Europa nachhaltig geprägt haben.
Quellen und Forschungen
Die Quellen fließen für das spanische Westgotenreich nicht allzu reichlich. Von den erzählenden seien drei hervorgehoben: die Historia Gothorum Isidors von Sevilla (+ 636), die Annalen des in Konstantinopel ausgebildeten Abtes Johannes von Biclaro und schließlich für die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts die Historia Wambae regis des Erzbischofs Julian von Toledo (+ 690) sowie mehrere Fortsetzungen der Gotengeschichte Isidors. Die letzten Jahrzehnte des Westgotenreiches sind kaum noch durch erzählende Quellen zu erschließen; über den Untergang des Reiches 711 berichten erst um 754 ein Geistlicher aus Toledo sowie verschiedene Chroniken vom Ende des 9. Jahrhunderts. Vieles wurde hier aus der Rückschau konstruiert und verlangt besonders sorgfältige Quellenkritik.
Neben die erzählenden Quellen treten die Rechtstexte, die Akten einer recht reichen konziliaren Tätigkeit sowie einige Formulae von Königsurkunden und wenige Briefe. Immer wichtiger werden archäologische Befunde, Bauten sowie Inschriften und Münzen, die schon zu einem großen Teil publiziert sind. Neben der Imitation römischer Formen wird deutlich, wie Herrschaftsschwerpunkte anhand der überlieferten Münzen und Münzprägungsstätten erschlossen werden können.
Dies verweist auf die Forschung. In jüngerer Zeit wird das Westgotenreich mit vielen anderen sogenannten Barbarenreichen vergleichend erforscht, vor allen Dingen in verschiedenen Wiener Forschungsprogrammen. Fragen zur Identität, zur Bedeutung von Gewaltgemeinschaften, zur Bedeutung von Sprache oder „Verfassung“ und andere Probleme standen meist im Vordergrund. Das Westgotenreich besitzt jedoch eine gewisse Sonderstellung, zum einen weil es 711 weitgehend unter muslimische Herrschaft geriet, zum anderen weil in Toledo relativ zentralistische Formen von Staatlichkeit entstanden und rechtliche und konziliare Praktiken sich besonders markant ausprägten. Blickt man auf die Kunstgeschichte, so bieten viele kürzlich publizierte Forschungen zu sakralen Bauformen zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert neue Ergebnisse.
507-711 – Etappen, Ereignisse, Interpretationen
Will man die Entwicklung von 200 Jahren kurz skizzieren, so lässt der Blick auf die Karte zunächst drei Befunde erkennen: 1) Teile Südwestfrankreichs (Narbonensis) sind zu berücksichtigen, 2) im Nordwesten bestand zunächst ein weiteres Reich der Sueben und 3) zeitweise (seit Kaiser Justinian) gewann auch Byzanz Einfluss im westlichen Mittelmeerraum.
a) Bis Leovigild (507-569)
Die im 5. Jahrhundert um das Zentrum Toulouse gruppierten Westgoten verlagerten nach der Niederlage gegen die Franken 507 ihren Herrschaftsschwerpunkt nach Südgallien, in die Narbonensis und nach Spanien. Anfangs residierten die westgotischen Könige noch vielfach in Narbonne oder Barcelona. Toledo war zunächst nur kirchlicher Mittelpunkt, erst im 7. Jahrhundert wurde Toledo immer mehr auch zum politischen Zentrum.
Nach 507 war dieses Reich noch keine feste Größe, denn der Ostgotenherrscher Theoderich der Große († 526), der damals über Italien und einen Teil der provenzalischen Mittelmeerküste herrschte, schickte ein Heer bis nach Barcelona, und das Westgotenreich kam zeitweise unter ostgotische Herrschaft. Auch König Theudis (531-548) war Ostgote und Heermeister in der Hispania gewesen. Er war mit einer reichen spanischen Grundbesitzerin vermählt und achtete darauf, dass Goten und Hispani friedlich zusammenlebten. Dieser innere Friede war nötig, denn nach außen musste sich Theudis sowohl gegen weitere Expansionsgelüste der Merowinger als auch gegen die Rekuperationspolitik des oströmischen Kaisers Justinian († 565) zu wehren, der sich für den westlichen Mittelmeerraum stark interessierte. Unter König Athanagild (551-568) gelangten einige Gebiete zwischen Cartagena und Málaga sogar unter byzantinische Herrschaft.
Aber beherrschten diese Könige schon ein westgotisches Reich? Zu Beginn des 6. Jahrhunderts dürften die Wanderungen der Westgoten aus Aquitanien begonnen haben. Außer nach Septimanien scheint die Mehrzahl der Westgoten nach Innerspanien migriert zu sein; dafür sprechen Reihengräberfriedhöfe, vor allem im Gebiet der heutigen Provinzen Segovia, Madrid, Palencia und Burgos. Auch die Münzstätten lassen Schwerpunkte tendenziell erkennen. Neben den Münzen zeigt die Ortsnamenkunde, dass gotische Ortsnamen vor allem dort belegt sind, wo Reihengräber auftauchen (Villatoro: villa Gothorum oder Revillagodos). Inschriften bezeugen gotische Adelige allerdings meist in Andalusien, besonders in spätantiken civitates wie Córdoba und Mérida.
Aber die Anzahl der Goten war begrenzt. Nur wenige gotische Elemente wurden in die romanische Sprache übernommen, offensichtlich war die Romanisierung der Westgoten schon weit fortgeschritten; einige belegte Mischehen deuten auf eine erste Annäherung von beiden Gruppen.
b) Erneuerungstendenzen unter Leovigild und Reccared (569-601)
Unter Leovigild (569-586) und Reccared (586-601) fanden Neubestimmungen auf mehreren Ebenen statt. Johannes von Biclaro umschreibt das Programm Leovigilds wie folgt: „Er stellte das Land der Goten, das durch verschiedene Aufstände verkleinert worden war, in seinen alten Grenzen wieder her.“ Damit meinte er nicht nur die Aktivitäten gegen die Oströmer, sondern auch gegen andere Volksgruppen. Besonders gehörten Erfolge gegen die Sueven in Nordwestspanien dazu, deren Reich Leovigild 585 unterwarf. Im Zusammenhang mit den Eroberungen wurden Städte gegründet, wie Reccopolis in Innerspanien oder Vitoria im Baskenland. Mit der Namenwahl stellte sich Leovigild in kaiserliche Traditionen. In einen ähnlichen Zusammenhang gehört die Prägung von Goldmünzen mit seinem Namen und seinem Bild.
Man hat dies „Verkaiserlicherung des Königtums“ genannt. Laut Isidor von Sevilla saß Leovigild „als erster mit königlichen Gewändern bekleidet auf dem Thron …, denn zuvor hatten die Herrscher die gleiche Kleidung und den gleichen Sitz wie das übrige Volk.“
Entscheidend wurde für die weitere Entwicklung der Übertritt der Westgoten vom Arianismus zum Katholizismus. Die Konzilien von 580 und 589 schufen neue, integrierende Bedingungen, die von mediterranen Verflechtungen, die Integration des Suebenreiches sowie die geistige Vorarbeit verschiedener Theologen und Gelehrter beeinflusst waren.
c) regnum Christianum – Reich, Recht und Gesellschaft im 7. Jahrhundert
Das besonders von Isidor propagierte Idealbild eines regnum christianum wurde seit dem dritten Konzil von Toledo (589) durch weitere Konzilien sowie rechtliche Kodifizierungen konturiert. Konzilien, wie das 633 von Isidor von Sevilla präsidierte vierte Konzil von Toledo, fassten sogar Beschlüsse zur Königswahl, die einen Ausgleich von Adel und Königtum andeuten.
Römische Traditionen blieben bestimmend in der Verwaltung der Provinzen durch duces und comites civitatum. Besonders prägend blieb das römische Vorbild im Finanzwesen, das Bischöfe kontrollierten. Das Heer, während der Wanderungen wohl die wichtigste Institution, scheint im 7. Jahrhundert verfallen zu sein. Nach der Lex Visigothorum mussten auch Unfreie in den Krieg ziehen. Die normativen Quellen suggerieren, dass soziale Spannungen in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts zunahmen.
Diese schwächten aber die fortbestehende spätantike Stadtkultur keinesfalls. Wichtige, schon auf die Römerzeit zurückgehende Städte waren Mérida, Córdoba, Zaragoza und Lugo. Der Fernhandel lag weitgehend in der Hand von Juden und Orientalen, jedoch begann schon 615 eine antijüdische Politik, die im Taufbefehl König Sisebuts gipfelte und auch zur Flucht spanischer Juden ins merowingische Gallien führte.
d) Niedergang und Ende des Westgotenreiches
Am Ausgang des 7. Jahrhunderts sind zunehmende Streitigkeiten, Adelskämpfe und Spaltungen, Revolten und Verschwörungen zu beobachten. So musste sich König Wamba (672-680) mit vielfachen Aufständen auseinandersetzen; bezeichnend ist sein Ende. Ervig, ein Sohn des Oströmers Ardabast, war unter Chindasvinth nach Spanien gekommen, wollte selbst König werden und hatte eine Verwandte des Königs geheiratet. Er gab Wamba einen Trank aus Besenginster, der Wamba das Bewusstsein raubte. Dem nur scheinbar Sterbenden erteilte man die Sterbesakramente und legte ihm ein Mönchsgewand an. Damit war er in den geistlichen Stand aufgenommen und nicht mehr regierungsfähig. Als Wamba erwachte, musste er nur noch das Abdankungsschreiben unterzeichnen und ins Kloster gehen. Ervig wurde neuer König und ließ sich auf einer Synode seinen Regierungsantritt bestätigen; die Akten des 12. Toledanum beschrieben die Art und Weise, wie Ervig gehandelt hatte, recht genau und stellten eine Wiederholung des Verfahrens unter strenge Strafe!
Nach Ervigs Herrschaft kehrte keine Ruhe mehr ein. Verschiedene Personen oder Sippen konkurrierten. Die Krisen wurden durch eine schwere Pestepidemie 693-694 und eine weitere Seuche 701 verstärkt. Fast alle Juden wurden auf dem 17. Konzil von Toledo 694 entrechtet. Spätere Nachrichten machen glauben, dass die Juden angeblich Kontakte zu Arabern in Syrien aufgenommen hatten. Jüdische Kinder wurden ab dem 7. Lebensjahr ihren Eltern weggenommen und in christliche Familien gegeben. Dass Herrschaft offensichtlich nur noch an einigen Orten funktionierte, belegen die wenigen verbliebenen Münzprägestätten dieser Zeit. In die genannten Streitigkeiten ist die Eroberung großer Teile der Iberischen Halbinsel durch arabisch-berberische Truppen ab 711 einzuordnen.
Der Glaubenswechsel 587/9, geistige Blüte und die Konstruktion der Hispania
Wie bedeutend der Wechsel der Westgoten zum Katholizismus war, mag eine kurze Erzählung erläutern: Leovigilds Sohn Hermenegild war mit einer fränkischen Katholikin Ingunde verheiratet, die ihren Mann dazu brachte, mit dem Katholizismus zu sympathisieren. Beide wurden nach Südspanien verbannt und gerieten unter den Einfluss des Mönches Leander von Sevilla, den Bruder des berühmten Isidor. Ab 582 führte Leovigild gegen seinen Sohn Krieg, aber im byzantinischen Córdoba fand der katholische Hermenegild Unterschlupf. Gegen Geldzahlungen zogen die belagerten Byzantiner ab, zusammen mit der Gemahlin und dem Sohn von Hermenegild. Dieser unterwarf sich zwar seinem Vater, legte Herrschaftszeichen ab und wurde dann 585 in Tarragona ermordet. War das ein Tod für den katholischen Glauben? Papst Gregor I. nennt Hermenegild einen Märtyrer.
Der Konflikt verdeutlicht, wie explosiv die Situation war. Leovigild versuchte mit dem arianischen Konzil von Toledo von 580 einen Ausgleich. Durch Konzessionen (keine Wiedertaufe beim Übertritt vom Katholizismus zum Arianismus, Christus sei dem Vater gleichartig (aequalis/ähnlich) sollten Katholiken leichter zum Arianismus konvertieren können. Erfolg hatte allerdings der umgekehrte Weg unter König Reccared (586-601), der schon ein Jahr nach seinem Regierungsantritt, 587, zum Katholizismus übertrat. Das dritte Konzil von Toledo 589 erklärte den katholischen zum einzigen Glauben im Westgotenreich. Im Wechsel des Bekenntnisses spiegelte sich trotz mancher Verwerfungen ein Prozess der Annäherung von westgotischen und hispanoromanischen Führungsschichten.
Der Übertritt war jedoch auch durch verschiedene geistige Entwicklungen mit vorbereitet und gefördert worden. Verständlich ist der Erfolg kaum, wenn nicht die Bedeutung des Suebenreiches im Nordwesten, der Baetica im Süden und die oströmisch-byzantinisch beherrschten Gebiete berücksichtigt werden. In Personen gesprochen: Martin von Braga, Leander und Isidor von Sevilla.
a) Das Suebenreich und Martin von Braga
Die Sueben, deren Reich 585 von den Westgoten erobert worden war, hatten den Schritt zum Katholizismus schon früher vollzogen. Die Konversion wurde unter Martin beendet, der zwischen 561 und 572 Bischof von Braga († 579) wurde. Sein Lebensweg verdeutlicht, wie sehr die Spannweite des alten römischen Reiches noch im 6. Jahrhundert prägend blieb und er unterstreicht zugleich, welche Bedeutung dem nordwestlichen Teil der Iberischen Halbinsel zukam. Martin stammte wahrscheinlich aus Pannonien und erhielt seine monastische Schulung in Palästina. Auf der Reise nach Galicien wurde er mit dem Mönchtum der Schüler des Caesarius von Arles bekannt. Um 550 gründete er ein Kloster zu Dumio bei Braga. Noch vor 572 wurde er dort Metropolit.
In dieser Zeit verfasste er mehrere moraltheologische Schriften für den suevischen König. Mit seiner predigtartigen Schrift De correctione rusticorum (Über die Verbesserung der Bauern) versuchte er nicht nur heidnische Bräuche zu bekämpfen, sondern förderte auch den Übertritt der Sueven zum Katholizismus. Für das praktische kirchliche Leben sammelte er Synodalkanones aus Byzanz, Afrika und Spanien (Capitula Martini) und übersetzte für das Klosterleben eine griechische Apophtegmata (Sinnsprüche)-Sammlung.
Den weiten Horizont Martins belegen auch seine Beziehungen: Als Verehrer des hl. Martin von Tours hatte er sein Kloster nach dessen Vorbild organisiert, eine Basilika für dessen Reliquien gebaut und ihm ein Gedicht gewidmet. Mit Bischof Gregor von Tours, mit Venantius Fortunatus und mit der Königswitwe Radegundis, der Gründerin des Kreuzesklosters in Poitiers, stand er in Kontakt.
b) Die Baetica und Leander von Sevilla
Was Braga für das Suevenreich bedeutete, waren Sevilla und Toledo für das Westgotenreich. Mit Sevilla verbinden sich die Namen der Brüder Leander und Isidor. Schon Leanders († 13. März 600) Lebensweg zeigt, aus welchen Wurzeln sich das geistig-geistliche Leben der südlichen Hispania am Ende des 6. Jahrhunderts speiste. Er entstammte einer vornehmen romanisierten katholischen Familie, die zur Zeit der byzantinischen Herrschaft aus Cartagena ausgewiesen wurde und sich im stärker westgotisch geprägten Sevilla niederließ. Dort wirkte Leander zuerst als Mönch; ab 577/578 als Erzbischof. Leander bekehrte wohl auch den schon genannten Hermenegild zum Katholizismus. Bei einer von Leander geleiteten Legation nach Konstantinopel um 580 traf der Sevillaner Hirte mit dem späteren Papst Gregor I. zusammen. Nach dem Herrschaftsbeginn Reccareds I. bereitete er den Übertritt zum römisch-katholischen Bekenntnis auf dem dritten Konzil von Toledo (589) vor.
c) Isidor von Sevilla
Bekannter als Leander wurde sein jüngerer Bruder Isidor († 636), der um 599/601 sein Nachfolger als Metropolit von Sevilla wurde. Das Konzil 619 und sein Vorsitz beim wichtigen vierten Reichskonzil zu Toledo (633) belegen seine zentrale Position im Westgotenreich, denn hier wurden zahlreiche kirchlich-politische Weichenstellungen in verschiedenen Kanones festgelegt, darunter Bestimmungen zur Judenfrage oder zur Wahlmonarchie.
Besonders bedeutsam wurde Isidor durch sein umfangreiches Werk; Jacques Fontaine kennzeichnet ihn als Epigonen der klassischen Bildung, der als Bindeglied von der Antike zum Mittelalter fungierte. Seine Schriften gliedern sich in naturwissenschaftliche, grammatische, historische und theologische Themenbereiche.
- Die bedeutendste naturwissenschaftliche Schrift sind die für König Sisebut (612-621) geschriebenen Etymologiae. Die Erläuterungen fassen wie eine Art Realenzyklopädie das weltliche und geistig-geistliche Wissen der Antike zusammen. Neuere Forschungen zeigen, dass Isidor vor allem nordafrikanische Schriftsteller und Anthologieen als Quelle nutzte. Damit wurde antikes Wissen vielfach in doppelt gebrochener Form für den lateinischen Okzident verfügbar. Die Etymologiae wurden durch weitere Arbeiten Isidors wie De natura rerum, einen Traktat über Chronologie, Kosmologie und Astronomie sowie einen Liber numerorum ergänzt.
- In einen ähnlichen Zusammenhang gehören Isidors Werke, die schulmäßiges Wissen zu sprachlichen Phänomenen weitervermittelten.
- Für Isidors theologisches Hauptwerk, die Sententiarum libri tres, dienten die Moralia in Job Gregors des Großen als Vorbild. Für die Praxis waren De ecclesiasticis officiis und eine Mönchsregel bestimmt. In De ortu et obitu patrum bietet Notizen zu Personen vornehmlich aus dem Alten und Neuen Testament.
- Die letzte Gruppe der isidorianischen Werke betrifft die Historiographie und muss etwas ausführlicher gewürdigt werden. In De viris illustribus charakterisiert Isidor besonders afrikanische und spanische Schriftsteller des 6./7. Jahrhunderts und nutzte existierende Werke. Eine Weltchronik gliederte den Stoff nach der augustinischen Lehre in sechs Weltzeitalter.
Über die Herrscher dreier Völker seit dem 4. Jahrhundert mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den Goten berichtet Isidor in der Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Sueborum. Dieses Werk thematisiert Annäherungsprozesse zwischen der gens der Goten und der romanischen Bevölkerung. Obwohl Sohn eines Provinzialen aus der Gegend von Cartagena, verfasste Isidor gleichwohl eine Geschichte der Goten, die eine Verschmelzung römischer und gotischer Traditionen erkennen lässt. Angeregt hatte das Werk vielleicht der kulturell interessierte König Sisebut. Isidor war die arianische Vergangenheit der Goten zwar nicht genehm und er brachte diese mit Magog, dem biblischen Feind des Gottesvolkes, in Verbindung. Andererseits pries er die Goten, weil sie Tugend (virtus) besäßen. Der heilsgeschichtliche Weg habe durch diese virtus fast zwangsläufig zur Konversion des Volkes geführt.
Römische Tradition und Gotenherrschaft gingen in diesem Werk eine Symbiose ein. Neben der personellen gab es sogar eine räumliche Perspektive, wie das vorangestellte Lob auf die Hispania zeigt. Spanien werde jetzt vom Volk der Goten glücklich beherrscht. Spanien sei die geheiligte Mutter von Königen und Völkern, die Königin aller Provinzen. Die Goten verbanden sich mit diesem Land wie mit einer entführten Braut. Biblische Vorbilder, so das Aufsuchen des Gelobten Landes, prägen die Darstellung. Es ist zweitrangig, ob Isidor hier eher das von Gott erwählten Gotenvolk oder vor allem das Land beschreibt, wie die Forschung kontrovers diskutiert hat. Neu und wichtig erscheint, dass eine gentile Gemeinschaft explizit in eine römische Tradition gestellt wurde, die Land und gens, Raum und Personen vereinte. Spätere Ansätze zur Rückbesinnung auf die Goten nutzten Isidors Schrift als wichtigen Referenzpunkt.
Mit seinem gesamten Werk schuf Isidor die Verbindung zwischen Altem und Neuem, er war Vermittler antiken Wissens in den Etymologiae, technisch antiken Wissens in De natura rerum, und er verband ebenso römische Traditionen mit der neuen Gotenherrschaft. Somit verknüpfte er das frühe Mittelalter mit der Spätantike; er trug zum Verständnis der antiken Überlieferung erheblich bei und tradierte das System von Bildung und Ausbildung. Diese Bedeutung Isidors zeigt auch die spätere Verbreitung seiner Schriften, die hauptsächlich über Irland ins übrige Europa gelangten, besonders im 8. und 9. Jahrhundert.
Die drei vorgestellten Gestalten sind exemplarisch und zeigen, wie gerade von den Rändern her, vom Nordwesten und vom Süden unter dem Dach des Katholizismus große Integrationsleistungen gedacht, später auch umgesetzt wurden. Die Zentralisierung der Herrschaft in Toledo, die kontinuierliche kirchliche Gesetzgebung, die Ausbreitung des Mönchtums und die Gesetzgebung bauten hierauf auf und nutzten weiterhin Schrift als Medium.
Zu den kulturellen Aspekten dieser Zeit gehören jedoch nicht nur Schriften. Zu Beginn des 7. Jahrhunderts sollen die plastischen Kunstwerke künstlerisch diejenigen anderer germanischer gentes überragt haben. Neben der hispanoromanischen Kunst blieben von der sogenannten westgotischen Kunst Objekte wie Gürtelschnallen, Fibeln, Broschen und Kriegsgerät erhalten. Vor allem im Zentrum der Iberischen Halbinsel gab es verschiedene aulenförmige Bauten; bekannt sind in Oviedo spätere Imitationen, und auch die meisten noch heute erhaltenen kleineren Kirchenbauten in der nördlichen Meseta lassen die Tendenzen dieses Stils erkennen. Die Karte lässt die archäologisch neu untersuchten Bauten deutlich erkennen.
Es ist strittig, ob diese Bauwerke einem spätantiken oder einem spanisch-vorromanischen Stil zuzuordnen sind; es wird um die Terminologie für diese und andere Bauwerke gerungen, byzantinischer Einfluss wurde immer wieder behauptet. Beachtenswert sind weiterhin Goldschmiedearbeiten wie die Arbeiten aus dem Schatz von Guarrazar.
Recht und Kirchenrecht
Der Glaubenswechsel beförderte auch die Weiterentwicklung des Rechts. Schon im Tolosaner Westgotenreich war der sogenannte Codex Euricianus für die Westgoten aufgezeichnet worden. Daneben galt eine Lex Romana Visigothorum für die römisch-romanische Bevölkerung. Leovigild und Reccesvinth schufen einen Codex revisus, der eine Angleichung der Romanen und Goten erkennen lässt. So hob Leovigild das bisher bestehende Eheverbot zwischen Goten und Römern/Romanen auf. Schließlich wurde 654 unter König Recceswind mit der Lex Visigothorum (Liber Iudiciorum) ein für Romanen und Goten gleichermaßen gültiges Recht geschaffen. Dies bedeutete gegenüber anderen gentilen Reichsbildungen dieser Zeit ein Unicum. Allerdings bleibt unsicher, inwieweit die Praxis der Theorie folgte.
Eine gewisse „staatliche“ Eigenständigkeit betraf ebenso den kirchlichen Bereich, denn nach dem offiziellen Übertritt der Herrschaftsträger zum Katholizismus entwickelte sich die römische Provinzial- zu einer Landes- und Staatskirche. Kirchliche Rechtssätze wurden auf einer Vielzahl von Konzilien, meist in Toledo, beschlossen. Sogar die Verfahrensweisen in den sogenannten ordines concilii sind überliefert und die Beschlüsse, Canones, gesammelt.
Die Einteilung in Bistümer orientierte sich an den Strukturen der spätantiken Provinzen. Zum wichtigsten Ort wurde zunehmend Toledo, das seinen Rang wohl vor allem deshalb steigern konnte, weil sich dort nun der Königshof befand. Hier, im Zentrum der Iberischen Halbinsel, fanden im 7. Jahrhundert fast alle Konzilien statt. Seit 633 wurden gleichsam regelmäßige „nationale“ Synoden abgehalten. Der Metropolit von Toledo gewann eine patriarchatsähnliche Stellung (ab 681 mit dem Titel Primas). Dies reizt zum Vergleich mit Byzanz, denn damit ergaben sich parallele Entwicklungen in der Nachfolge des römischen Reiches.
Mönchtum und Klosterwesen nahmen seit dem 6. Jahrhundert einen Aufschwung, vor allem in der Gegend des alten Suebenreiches. Zwar war das benediktinische Mönchtum teilweise bekannt, aber wichtiger wurde für das monastische Leben in Spanien das Regelwerk des Fructuosus von Braga († um 665) oder dasjenige Isidors von Sevilla. Für Nonnen hatte schon Isidors Bruder Leander eine Regel verfasst. Eine Eigentradition blieb die altspanische Liturgie, die später „mozarabisch“ genannt und 633 für das ganze Reich vorgeschrieben wurde. Sie behielt bis ins 11./12. Jahrhundert besondere Bedeutung.
Was Europa den Westgoten verdankt – statt einer Bilanz
Die Frage, inwieweit die Westgoten die weitere Geschichte prägten, ist in dieser Allgemeinheit nicht zielführend, denn jede geschichtliche Entwicklung prägt. Deshalb kann es nur um einige auch subjektiv gewählte Spuren gehen, die nicht nur das politische Leben, sondern auch die kirchliche Entwicklung betrafen; hieran dürften sich durchaus Wege von der Antike ins Mittelalter ablesen lassen.
- Wie auch immer man vor dem Hintergrund neuerer Forschungen zu Ethnogenese, Nation und Staatlichkeit die westgotische Herrschaft einschätzt, so war die Leistung, verschiedene kulturelle und staatliche Traditionen zusammenzuführen, wegweisend. Zwar ist nicht bis ins Einzelne zu belegen, in welchem Maße Goten und Hispanoromanen zusammenfanden, zumindest aber wurde hier ein Weg, anders als in weiteren gentilen Reichen, theoretisch vorgedacht und – wie Konzilsbeschlüsse erkennen lassen – teilweise erfolgreich beschritten. Eine vergangenheitsgestützte Zukunftsvision hatte die Laus Spaniae mit drei Begriffen rex, gens und patria vorgezeichnet. Die westgotische Staatlichkeit verblieb in starken römischen Traditionen. Kurz vor dem Untergang deutet die zunehmende Macht des Adels zwar auf zentrifugale Tendenzen, jedoch baute der Adel abweichend von anderen Barbarenreichen keine Großherrschaften auf; auch blieb das Reich ungeteilt. Da die Thronfolge im Westgotenreich seit dem 7. Jahrhundert durch Wahlen geprägt war, gewann die sakrale Herrschaftslegitimation an Bedeutung. Die Bestätigung von Erhebungen auf Konzilien und die Salbungen belegen dies. Dass dies auf das Frankenreich und die – freilich umstrittene – Salbung Pippins oder die Vorstellung davon einwirkte, ist zumindest denkbar. Die Formen zentraler Staatlichkeit im Westgotenreich basierten zumal an der Wende zum 7. Jahrhundert vor allem auf byzantinischen Vorbildern, wo im frühen Mittelalter Vergleichbares zu beobachten ist. Die im Westgotenreich entwickelten Konzeptionen boten aber Anknüpfungspunkte, um die spanische Geschichte auch später als Einheit und nicht nur als ein Ensemble regionaler Geschichten zu verstehen, so in historiographischen Entwürfen des 9. oder 13. Jahrhundert, die auf die Goten als „Gründungsväter“ der hispanischen Geschichte rekurrierten und den historischen Prozess neu konstruierten. Ähnliches galt für Kreuzzugs- und Reconquista-Konzeptionen, denn waren nicht auch die Goten ins Gelobte Land gezogen? Jedoch ist einzuräumen, dass diese „westgotische Staatsideologie“ eher geistesgeschichtlich wirkte. Rückbesinnung auf gotische Zeiten half nicht nur bei Geschichtskonstruktionen in Asturien, sondern auch in Septimanien und Katalonien. Ob dies sogar aktuelle Bedeutung besitzt?
- Berücksichtigt man neuere Überlegungen, inwieweit die Volksrechte nicht ausschließlich personenbezogene, sondern auch territoriale Aspekte aufwiesen, dann dürfte das Recht im Westgotenreich hervorstechen. Die Zusammenführung von Rechtssammlungen für Goten und Romanen wies deshalb in die Zukunft, weil hier seit dem 7. Jahrhundert zunehmend nicht nur von Personen her gedacht wurde. Westgotisches Recht behielt bis ins hohe Mittelalter Geltung, zuerst am Hof von Oviedo, dann in León. Westgotisches und implizit römisches Recht zitieren sogar arabische Dokumente im 9./10. Jahrhundert, wie spanische Forscher jüngst zeigen konnten. Neben dem weltlichen Recht zeitigten kirchenrechtliche Sammlungen und Konzilsbeschlüsse besondere Langzeitwirkungen. Ein Teil ist in der Collectio Hispana überliefert. Diese wichtige Kirchenrechtssammlung des lateinischen Westens hat von der Iberischen Halbinsel aus unmittelbar Einfluss geübt. Sie wurde sogar ins Arabische übertragen, was ihre Bedeutung im südlichen Teil Spaniens nach 711 belegt. Mit den Kanones-Sammlungen wurden zugleich Vorstellungen über das Verhältnis von Königtum und religiöser Herrschaftslegitimation weitergegeben. Sogar die meisten „Geschäftsordnungen“ west- und mitteleuropäischer Synoden folgten den Konzilsordines, die sich bei den westgotischen Konzilen ausgeprägt hatten.
- Die aus der Antike übernommenen räumlichen Einteilungen samt den Römerstraßen – eine bot die Grundlage für den späteren Jakobsweg – blieben weiterhin vor allem in der Einteilung kirchlicher Provinzen bestehen und gewannen im 11. und 12. Jahrhundert mit Fortschreiten der „Reconquista“ neue Aktualität. Hier galt es immer, den alten oder den vermeintlich alten Zustand der Westgotenzeit wiederherzustellen. Ähnliches galt für Toledo, das nach der „Rückeroberung“ wieder ein Zentrum geworden war. Die Primatsrechte von 681 wurden 1086 erneut bestätigt.
- Besonders wirkten literarische und gelehrte Werke weiter. Isidor wurde nach der Westgotenzeit nicht vergessen: Sein Werk wurde weiterhin geschätzt, besonders – seit der Übertragung der Gebeine 1063 – in León. Abschriften und Fortführungen seiner Gotengeschichte belegen, wie traditionsstiftend sein Werk war. Spuren des kirchlichen Lebens sind teilweise noch heute in „westgotischen“ Bauten zu verfolgen. Im Übrigen blieben auch westgotische Münzen im Umlauf.
- Schließlich wurden westgotische Traditionen im übrigen Europa und im Mittelmeerraum verbreitet. Westgotische Einflüsse auf die lateinische Christenheit sind unter anderem die bereits genannten Aspekte des Rechtes, der Königssalbung und des gelehrten Wissens. Der Rezeptionsprozess in Europa erreichte vor allem im 8. und 9. Jahrhundert einen Höhepunkt. Im Zusammenhang mit der karolingischen Renaissance begegnen zudem gelehrte Köpfe aus der Hispania, zu denen Personen wie Theodulf von Orléans, Benedikt von Aniane oder Agobard von Lyon gehörten.
Prägungen und Nachwirkungen waren folglich keinesfalls gering. Das Jahr 711 brachte zwar Neuorientierungen, war aber vielleicht doch keinen Einschnitt, der eine völlige Umstrukturierung bewirkte, unter anderem auch, weil die Westgotenzeit in vielen, freilich häufig verformenden späteren Erinnerungen lebendig blieb.